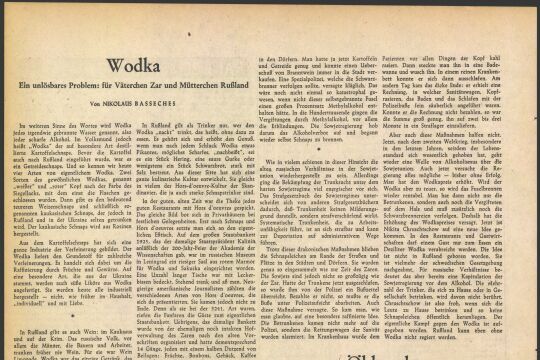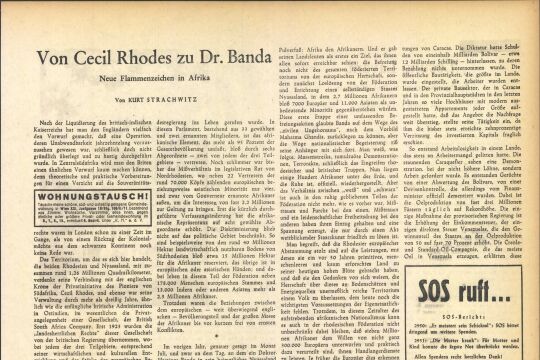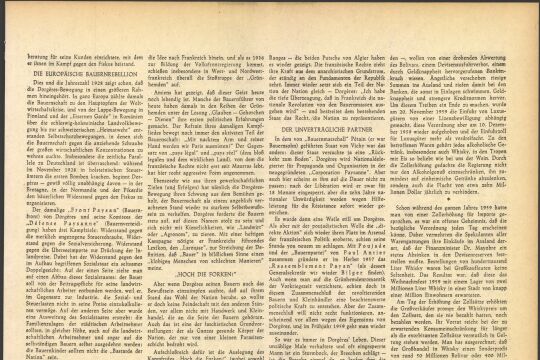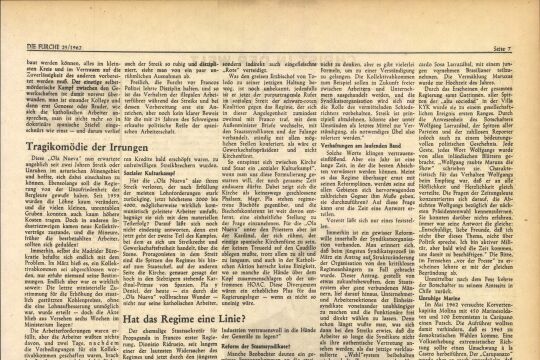Nur 48 Stunden nach dem Putsch gegen den venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez leitete dieser wieder die Geschicke des Landes. Zu seiner Wiedereinsetzung führte eine Massenbewegung, die sich aus den ärmsten Stadtteilen und Gegenden Venezuelas in Bewegung setzte und "ihren" Präsidenten zurückholte.
Hunderttausende Venezolaner gingen, obwohl die Polizei unter Kontrolle der Putschisten stand, für "ihren" gestürzten Präsidenten Hugo Chávez auf die Straßen. Sie stürmten den Regierungspalast, umstellten die Militärkaserne in der Chávez vermeintlich festgehalten wurde und auch die TV- und Radiosender sowie Zeitungen, die den Putsch medial mit vorbereitet hatten. Mit ihnen zusammen reagierten auch Teile des Militärs, die gegenüber dem Präsidenten der "bolivarischen Revolution" loyal geblieben waren.
Der Putsch dieses Bündnisses aus nationalen Unternehmern, korrupter Gewerkschaftsbürokratie, den alten politischen Eliten des Landes und Teilen des Militärs entpuppte sich schnell als im wesentlichen mediales Ereignis. Und zudem eine Ironie der Geschichte. Hugo Chávez scheiterte 1991 mit einem links orientierten Militärputsch gegen die korrupte damalige Regierung und konnte sich nach seiner Haftentlassung Ende 1998 bei den Präsidentschaftswahlen gegen das gesamte traditionelle Parteienspektrum durchsetzen. Nun putschte ausgerechnet das Gesellschaftsspektrum, gegen das der Militär sich erhoben hatte, gegen den mittlerweile demokratisch gewählten Präsidenten Hugo Chávez, dessen Putsch für sie zuvor immer als Beleg für seine antidemokratische Haltung galt.
Zu früh hatte sich die US-Regierung gefreut, die den Putsch in Venezuela als "Regierungswechsel" bezeichnete und sogleich verkündete, Chávez sei an der Entwicklung selbst Schuld, da er das Volk gegen sich aufgebracht habe. Ebenso die Europäische Union, die den Putsch auch nicht beim Namen nennen wollte und - natürlich erst nach dem Putsch - zur "Mäßigung" mahnte.
"Weg mit dem Paria!"
Zu früh kam es auch zu Jubelstimmungen in der internationalen Presse, die Chávez durch eine angeblich breite Volksbewegung gestürzt sah. Das Wall Street Journal erklärte sogleich: Die "USA wurden eine als politischen Paria betrachtete Regierung los", "ein großes Plus für die USA und die Stabilität der Ölmärkte". Und obwohl sie sonst die Karte der Demokratie immer sehr hoch hängen, verurteilten die meisten Staaten der "westlichen Welt" den Putsch gegen den verfassungsmäßig gewählten Präsidenten Chávez nicht. Auch in Kolumbien wurde der Machtwechsel begrüßt und eine "Verbesserung des Klimas" zwischen beiden Ländern erwartet. Einzig die Organisation Amerikanischer Staaten (OEA) wandte sich zähneknirschend gegen die Putschistenregierung. Sie vermied zwar die Forderung nach der Rückkehr Chávez, doch verurteilte sie den Putsch und forderte die Einhaltung der demokratischen Spielregeln.
Unsicher ist nach wie vor die genaue Verwicklung der USA in den Putsch. Nach Angaben des Magazins Newsweek pflegten die Putschisten bereits seit mindestens zwei Monaten regelmäßige Kontakte zur US-Botschaft in Venezuela. Die New York Times berichtet sogar von mehreren Treffen hochrangiger Funktionäre der Bush-Regierung mit Anführern der Putschisten im Verlauf der vergangenen Monate. Die Zeitung beruft sich dabei auf nicht genannte offizielle Quellen und weist darauf hin, dass die Äußerungen der USA zum Putsch nie klar gewesen seien. Doch stimmten die US-Vertreter den Putschisten bezüglich der Notwendigkeit Chávez aus dem Amt zu entfernen grundsätzlich zu. Ein weiterer US-Vertreter äußerte gegenüber der NYT, es sei den Putschisten niemals klar abgeraten worden den Putsch durchzuführen. Nicht umsonst unterstellte im vergangenen Jahr ein Strategiepapier aus dem akademischen Umfeld der Bush-Regierung Hugo Chávez, er habe vor, Kolumbien, Venezuela, Ecuador und Panamá zu einer "sozialistischen Republik" zu einen.
Vieles deutet daher darauf hin, dass die Verwicklung der USA weitergehend sein könnte. Als US-Botschafter für die Bush-Administration befindet sich Charles Shapiro in Caracas. Zuvor bekleidete er das Amt des Verantwortlichen für Kuba-Politik im Außenministerium und davor arbeitete er von 1983 bis 1988 in der US-Botschaft in El Salvador. Während dieser Hochzeit des Bürgerkrieges in El Salvador waren die USA in zahlreiche Aktionen schmutziger Kriegsführung in dem mittelamerikanischen Land verwickelt. Damals bestand eine Zusammenarbeit zwischen dem venezolanischen Militärgeheimdienst DISIP und zum CIA gehörigen Exilkubanern in der Unterstützung salvadorianischer Todesschwadronen. Vor wenigen Monaten wurde mit der Ernennung des rechtsextremen Exilkubaners Otto Reich zum Lateinamerikaverantwortlichen im State Department ein weiterer Anhänger von rechten Militärputschen in die höchsten Sphären der Lateinamerikapolitik Bushs geholt.
Ein Dorn im US-Auge
Chávez ist mit Sicherheit ein Dorn im Auge der USA. Venezuela fügt sich nicht der US-Politik gegen Kolumbien und hat sowohl das Überfliegen des eigenen Territoriums durch die USA, wie auch eine militärische Einkreisung Kolumbiens abgelehnt, die Mitarbeit in Bushs Anti-Terrorallianz verweigert und den Afghanistankrieg verurteilt. Chávez hat sich gegen das ökonomische Prestigeprojekt der USA, das Freihandelsabkommen für ganz Lateinamerika FTTA ausgesprochen, er hat die OPEC - deren Vorsitz Venezuela innehat - wieder geeint und die Ölpreise sind gestiegen (daher fielen sie auch direkt nach dem Putsch) und ist ein persönlicher Freund Fidel Castros. Kuba erhält von Venezuela Erdöl zu Sonderkonditionen und unterstützt Venezuela im Erziehungs- und Gesundheitswesen. Das Budget für das Erziehungssystem wurde verdoppelt und Chávez führte eine Reform des Bildungssystems durch, die über einer Million Kinder zusätzlich erstmals den kostenfreien Schulbesuch ermöglichte. Auch ein kostenloses Gesundheitssystem wurde eingeführt und Schulen und Krankenhäuser, die zuvor geschlossen worden waren, wiedereröffnet.
Tatsächlich unverzeihlich war aber schließlich, dass Chávez mit einem Gesetzespaket im vergangenen Dezember wagte, das Recht der Unternehmer auf gute Geschäfte und ihren vollständigen Zugriff auf die Ressourcen zu beschränken. In den 49 Dekreten verfügte er unter anderem Autonomierechte für die indianische Bevölkerung (inklusive Kontrolle über Bodenschätze und Gewässer in historisch genutzten Territorien), eine Sondersteuer für transnationale Erdölkonzerne, die Einschränkung von Großgrundbesitz und eine bescheidene Landreform, einen Sonderfonds für Erziehung und Gesundheitsversorgung für die Ärmsten und vieles mehr. Eine Woche vor dem Putsch verfügte er außerdem eine Erhöhung des Mindestlohns um 20 Prozent. Hier wird verständlich, warum Chávez immer noch das Vertrauen der Armen Venezuelas genießt.
Venezuelas Unternehmen schmeckte dies nicht, und so kam es trotz einer relativ stabilen Wirtschaft - Venezuela zahlte pünktlich seine Schulden, verzeichnete ein Wirtschaftswachstum und stellte sogar den IWF zufrieden - zu einer politisch motivierten Kapitalflucht. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sollen mindestens zehn Milliarden US-Dollar abgezogen worden sein. Dies führte zusammen mit den geringen Staatseinnahmen aufgrund der schwachen Erdölpreise zu einer ökonomischen Krise. Und so wurde die Stabilität des Wechselkurses des venezolanischen Bolivar zum Dollar Mitte Februar aufgegeben, um die Devisenreserven nicht in Stützungskäufen zu verpulvern. Es folgten verstärkte Kapitalflucht und eine Entwertung des Bolívar um nahezu 30Prozent.
Gleichzeitig führte das konfrontative Auftreten Chávez in Venezuela dazu dass er innerhalb seiner eigenen Regierungskoalition die Unterstützung kleinerer Parteien verlor und heute nur noch auf etwas mehr als die Hälfte der Sitze in der Nationalversammlung zählen kann. Die breite Unterstützung, die Chávez im Gegenzug vor allem in der armen Bevölkerung genießt, fand hingegen keine organisierte Entsprechung und blieb so ohne politische Ausdruck. Auch die starke Fixierung auf die Person Chávez, nahezu ein Personenkult, stößt im In- und Ausland unangenehm auf. Darüber hinaus wirft auch seine stete Verherrlichung der Armee und des Soldatischen, sowie die damit einhergehende Militarisierung der Gesellschaft viele kritische Fragen auf.
Nach der erneuten Übernahme der Amtsgeschäfte schlug Chávez jedoch versöhnliche Töne an, er verkündete er habe während seiner Gefangenschaft viel nachgedacht, "Selbstkritik ist die Tugend eines jeden Revolutionärs", so der Präsident. Er sagte zu, es werde keine Hexenjagd auf Oppositionelle geben, doch die Beteiligten am Putsch sollten ebenso gerichtlich belangt werden, wie die Verantwortlichen für die Schießerei, die als Putschauslöser benannt wurde.
Dem nun aus der Opposition laut werdenden Ruf nach Neuwahlen erteilte Hugo Chávez eine kategorische Absage, schließlich wurde er in den vergangenen Jahren bereits zweimal mit nahezu 70 Prozent der Stimmen zum Staatschef gewählt. Er erkannte aber an, dass es ein Fehler gewesen sei, Ankündigungen über die Auswechslung bestimmter Funktionäre im Rahmen seines wöchentlichen Radioprogramms zu machen und sich zu persönlichen Polemiken hinreißen zu lassen. Außerdem akzeptierte er den Rücktritt der erst kürzlich von ihm eingesetzten neuen Führungsspitze des staatlichen Erdölkonzerns.
Versöhnliche Töne
Gegenüber der Opposition zeigte er Dialogbereitschaft und ließ sogleich Taten folgen: Er berief den "Föderalen Regierungsrat" ein. Der Rat unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten ist gemäß Verfassung zusammengesetzt aus den Ministern der Zentralregierung, den Gouverneuren der Bundesstaaten, jeweils einem Bürgermeister aus jedem Bundesstaat und Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft. In diesem Rahmen richtete Chávez die Einladung auch an die Oppositionsparteien, die Unternehmer und Gewerkschafter, die Kirche und die Medien. Chávez schlug selbst vor im Rat den bereits verabschiedeten "Plan für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Nation 2001-2007" sowie Reformvorschläge hinsichtlich der Verfassung von 1999 zu diskutieren.
Politisch dürfte Chávez - wenn er weiterhin geschickt agiert - aus dem Putsch gestärkt hervorgehen, doch sind die Zeichen für Unruhe in der Armee deutlich. Zwar wird das Gespenst des Putsches nicht so schnell wiederkehren, doch werden Unternehmer, rechte Kreise und allen voran die USA ihren Traum, Chávez zu verjagen, nicht aufgeben. Ob Chávez und seine Regierung es schaffen werden die, politisch wie ökonomisch schwierige Situation zu meistern, ist noch offen. Eine Alternative zu dem noch bis 2006 regierenden Chavez ist bisher jedoch nicht in Sicht, und die Gallionsfiguren der Opposition haben sich in nur 48 Stunden selbst diskreditiert.
Der Autor ist freier Journalist mit Arbeitsschwerpunkt Lateinamerika.