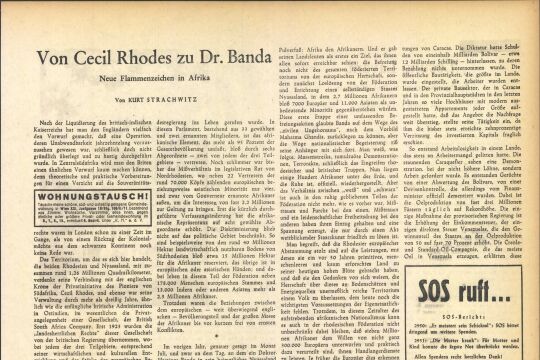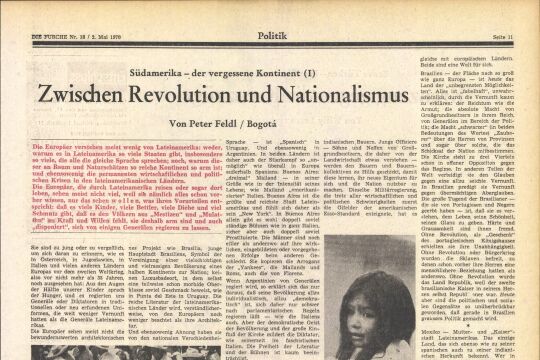Kolumbien gilt in Lateinamerika als der am stärksten gefährdete Staat, der in die Unregierbarkeit abrutschen könnte. Maßgeblich Schuld daran hat der florierende Kokain- und Heroinhandel, der die Kriegskassen der Rebellenorganisationen füllt. Aber auch die Nachbarn tragen ihren Teil zur Instabilität bei.
General Álvaro Caro, Chef von Kolumbiens Anti-Drogen-Polizei, konnte Mitte November einen schönen Erfolg bekanntgeben: Seine Männer schnappten an drei Orten gleichzeitig insgesamt 28 Drogenhändler, die 85 Prozent des in Kolumbien produzierten Heroins in die USA schmuggeln. Einige von ihnen wurden in Cúcuta festgenommen, einer Grenzstadt zu Venezuela. Das Heroin, das neben der Hauptdroge Kokain in Kolumbien auch produziert wird, gelangte über das östliche Nachbarland in die USA. Ein Leser namens Guillermo kommentierte die Nachricht auf der Website der Wochenzeitung "El Espectador" so: "Das ist wie mit der Bäckerei im Barrio. Sperrt die zu, macht bald eine andere auf … Solche Polizeiaktionen bringen nicht viel, und schon gar nicht mit Hugo Chávez als Nachbarn."
Guillermo beschreibt, warum Kolumbien das einzige Land Südamerikas ist, das laut dem Ranking des US-Think Tanks "Fund for Peace" nach wie vor "in Gefahr" ist, zu einem "failed state", zu einem gescheiterten Staat, zu werden: Der Drogenhandel ist nicht auszurotten - trotz der fünf Milliarden Dollar, die die USA im Rahmen des "Plan Colombia" seit 1999 ausgegeben haben. Um dieses Geld kaufte Kolumbien Waffen für Armee und Polizei, ließ seine Soldaten besser ausbilden, besprühte Koka-Felder aus Flugzeugen mit Unkrautvernichtungsmitteln.
Unter Bananenstauden versteckt
Das Fazit, das der US-Kongress in einem Bericht Anfang November zog: Im Vergleich zu 2000 kommt aus den, oft im Dschungel versteckten Labors nun um vier Prozent mehr Kokain. Für den riesigen Aufwand also kein berauschendes Ergebnis. Die Kräfte hinter dem Koka-Anbau sind der Drogenbekämpfung immer einen Schritt voraus: Werden per Satellit Kokafelder ausgemacht und besprüht, pflanzen die Bauern - die selbst am allerwenigsten von ihrem illegalen Tun profitieren - die niedrigen Sträuche unter Bananenstauden, deren Blätter die Sicht auf den Boden verdecken. Oder sie weichen in Nationalparks aus, wo nicht gesprüht werden darf und die Kokapflanzen händisch ausgerissen werden müssen.
In gescheiterten Staaten hat die Regierung über große Teile des Territoriums oft keine Kontrolle, und andere bewaffnete Akteure brechen das staatliche Gewaltmonopol. Beides trifft auf Kolumbien teilweise zu. Trotz der großen Erfolge von Präsident Álvaro Uribe Vélez gegen die Guerilleros der "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" (FARC). Uribes von Menschenrechtsorganisationen kritisierte Politik der harten Hand gegen die Guerilla hat immerhin dafür gesorgt, dass Kolumbien sich in zwei Jahren in dem Ranking um zehn Plätze verbessert hat und die "rote Alarmwarnung" zur "orangen Gefahr" abgeschwächt worden ist. Es gibt weniger Guerilleros, die im Drogengeschäft mitmischen. Nur: Drogenhändler finden sich immer, dafür sind Kokain und Heroin einfach zu lukrativ.
Drogengewinne finanzieren Krieg
Die phänomenalen Gewinne aus dem Suchtgiftschmuggel haben für Kolumbien Folgen, an die keiner von den Stars und Szenemenschen denkt, die in New York oder Madrid Kokain schnupfen. Ohne Drogengeld könnten die FARC längst keine Menschen mehr entführen, morden und ganze Landstriche in ihrer Gewalt halten - genauso wie die rechtsextremen Paramilitärs, die aus den Schutztruppen von Viehzüchtern gegen die FARC entstanden sind und die die Politik bis ins Parlament, wenn nicht weiter hinauf, unterwandert haben.
Wegen des Terrors mussten vor allem Kleinbauern ihre Hütten und Grundstücke verlassen: 2006 räumte die Regierung ein, es gebe an die drei Millionen Kolumbianer, die Vertriebene im eigenen Land seien. Auch dies wiegt schwer in der Abschätzung, ob ein Land in Gefahr ist, unregierbar zu werden. Laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat sind eine halbe Million Kolumbianer in die Nachbarstaaten geflohen, und mit dem "brain drain", der Abwanderung der Wissenschafter, kämpft das Land schon lange.
Wegen der militärischen Erfolge gegen die Guerilla musste sich die FARC in den vergangenen Jahren in die Grenzgebiete zu Ecuador und Venezuela zurückziehen. Die Guerilla destabilisiert dort mit ihrem angeblichen Kampf für die kleinen Leute - den gerade diese am teuersten bezahlen und den schon lange niemand mehr freiwillig mitmacht - die gesamte nördliche Anden-Region.
Anfang März wurde die Nummer zwei der FARC, Raul Reyes, bei einem gezielten Angriff von Kolumbiens Armee einige hundert Meter innerhalb des Gebiets von Ecuador getötet. Ecuadors linkspopulistischer Präsident Rafael Correa hatte Reyes und Co. zumindest indirekt unterstützt. Das hinderte ihn nicht daran, wegen der Souveränitätsverletzung eine diplomatische Krise anzufachen.
"Die Anden-Region ist wie der Nahe Osten" (wo der Iran die Hisbollah unterstützt) "zu einer Zone geworden, in der asymmetrische Konflikte mit staatlichen und nichtsaatlichen Akteuren internationale Grenzen überschreiten und in der terroristische Praktiken durch zwischenstaatliche Feindschaften florieren", heißt es in einem Bericht der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Guillermo, der Leser des "Espectador", hat das begriffen: Mindestens so prekär und chaotisch wie in Ecuador ist der innere Zustand Venezuelas.
Caracas: Höchste Mordrate der Welt
Für die venezolanische Demokratie ist es ein gutes Zeichen, dass Oppositionskandidaten in den Regionalwahlen vom 23. November die Stellvertreter von Präsident Hugo Chávez in fünf von 22 Teilstaaten aus dem Feld schlugen. An der Sorge von Cruz Salazar, Bewohnerin von Caracas' Armenviertel Petare, wird das nicht viel ändern: Dass die Gauner, die das Barrio im Griff haben, sie ausrauben könnten, "weil die Polizei nicht kommt". Zwar bestreitet die Regierung heftig, dass Caracas mit 130 Morden auf 100.000 Einwohner die höchste Mordrate der Welt habe. Aber die Unesco hat schon 2006 festgestellt, dass die Gefahr, durch eine Feuerwaffe ums Leben zu kommen, nirgendwo auf dem Globus höher ist als in Venezuela.
Genauso wenig wie Gewaltverbrechen scheint die Polizei den sprunghaft gestiegenen Drogenhandel unter Kontrolle zu bekommen. 2005 kündigte Hugo Chávez - passend zu seinem antiimperialistischen Kampf gegen den Satan im Norden - Venezuelas Zusammenarbeit mit der US-Antidrogenbehörde DEA auf; diese habe spioniert. Im Jahr darauf sank die Menge des beschlagnahmten Kokains von 58,5 Tonnen auf 39, berichtet das in Wien ansässige UN-Büro für Drogenbekämpfung (UNODC). Eine neue Route nach Europa scheint entstanden zu sein: Das kolumbianische Kokain wird zuerst über die Grenze geschmuggelt. Von Venezuela gelangt es dann oft in kleinen Flugzeugen, die zusätzliche Tanks eingebaut haben, über westafrikanische Staaten wie Mauretanien oder Guinea Bissau nach Europa. Eine solche Ladung kann sechs- bis siebenhundert Kilo ausmachen. Wert im europäischen Kokain-Großhandel: 33 Millionen Dollar.
Zurück zum Ranking des "Fund for Peace" über gescheiterte Staaten. "Auf der Wunschliste eines jeden Autokraten steht wohl, ein Land mit vielen Ressourcen und ein willfähriges Parlament zu haben", heißt es in den Erläuterungen. Vielleicht mit dem gleichen Gedanken im Kopf sprach der venezolanische Diplomat und OPEC-Mitbegründer Juan Pablo Pérez Alfonso schon vor Jahrzehnten statt vom "schwarzen Gold" lieber vom "Exkrement des Teufels".
Dass Präsident Hugo Chávez ohne Venezuelas Erdöl in der internationalen Politik nicht annähernd so mitmischen könnte, wie er es tut, liegt auf der Hand. Aufgrund einer Ermächtigung, die ihm die willfährige Volksvertretung gegeben hatte, erließ er im letzten August 26 Gesetze, die es in sich haben. Der Aufbau von Volksmilizen wird angekündigt, die die Nation beschützen sollen; wann und was das für die Streitkräfte bedeutet, bleibt unklar. Diese Gesetze beinhalten viele jener Verfassungsänderungen, die Chávez in einem Referendum vor einem Jahr beim Volk nicht durchgebracht hat. Nur den Wunsch nach seiner unbeschränkten Wiederwahl hat sich Chávez noch nicht erfüllt - aber das könne noch kommen, stellte er vor wenigen Tagen klar.
Sicher ist eines: Mit dem kaum zu bewältigenden Drogenproblem in Kolumbien und dem autokratischen Regierungsstil von Hugo Chávez in Venezuela bleibt dieser Teil Südamerikas anfällig für Gewalt und Instabilität.
Die Autorin ist freie Journalistin mit Schwerpunkt romanische
Länder und Lateinamerika.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!