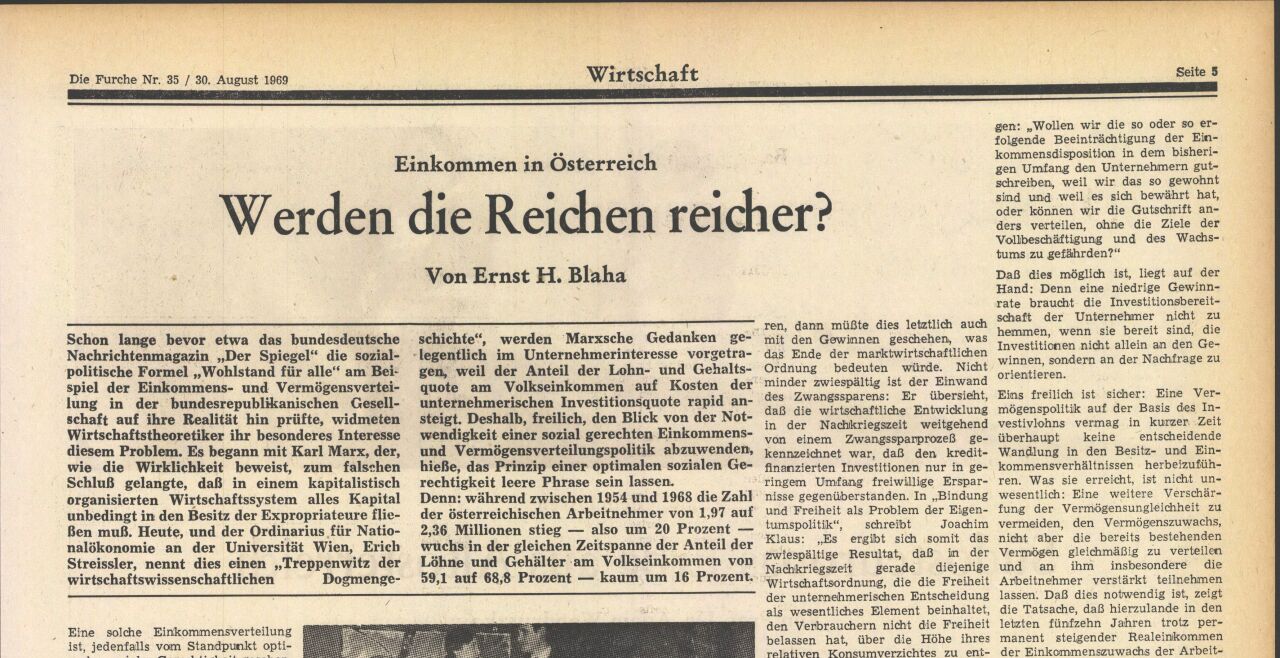
Werden die Reichen reicher?
Schon lange bevor etwa das bundesdeutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ die sozialpolitische Formel „Wohlstand für alle“ am Beispiel der Einkommens- und Vermögensverteilung in der bundesrepublikanischen Gesellschaft auf ihre Realität hin prüfte, widmeten Wirtschaftstheoretiker ihr besonderes Interesse diesem Problem. Es begann mit Karl Marx, der, wie die Wirklichkeit beweist, zum falschen Schluß gelangte, daß in einem kapitalistisch organisierten Wirtschaftssystem alles Kapital unbedingt in den Besitz der Expropriateure fließen muß. Heute, und der Ordinarius für Nationalökonomie an der Universität Wien, Erich Streissler, nennt dies einen „Treppenwitz der wirtschaftswissenschaftlichen Dogmengeschichte“, werden Marxsche Gedanken gelegentlich im Unternehmerinteresse vorgetragen, weil der Anteil der Lohn- und Gehaltsquote am Volkseinkommen auf Kosten der unternehmerischen Investitionsquote rapid ansteigt. Deshalb, freilich, den Blick von der Notwendigkeit einer sozial gerechten Einkommensund Vermögensverteilungspolitik abzuwenden* hieße, das Prinzip einer optimalen sozialen Gerechtigkeit leere Phrase sein lassen. Denn: während zwischen 1954 und 1968 die Zahl der österreichischen Arbeitnehmer von 1,97 auf 2,36 Millionen stieg — also um 20 Prozent — wuchs in der gleichen Zeitspanne der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen von 59,1 auf 68,8 Prozent — kaum um 16 Prozent.
Schon lange bevor etwa das bundesdeutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ die sozialpolitische Formel „Wohlstand für alle“ am Beispiel der Einkommens- und Vermögensverteilung in der bundesrepublikanischen Gesellschaft auf ihre Realität hin prüfte, widmeten Wirtschaftstheoretiker ihr besonderes Interesse diesem Problem. Es begann mit Karl Marx, der, wie die Wirklichkeit beweist, zum falschen Schluß gelangte, daß in einem kapitalistisch organisierten Wirtschaftssystem alles Kapital unbedingt in den Besitz der Expropriateure fließen muß. Heute, und der Ordinarius für Nationalökonomie an der Universität Wien, Erich Streissler, nennt dies einen „Treppenwitz der wirtschaftswissenschaftlichen Dogmengeschichte“, werden Marxsche Gedanken gelegentlich im Unternehmerinteresse vorgetragen, weil der Anteil der Lohn- und Gehaltsquote am Volkseinkommen auf Kosten der unternehmerischen Investitionsquote rapid ansteigt. Deshalb, freilich, den Blick von der Notwendigkeit einer sozial gerechten Einkommensund Vermögensverteilungspolitik abzuwenden* hieße, das Prinzip einer optimalen sozialen Gerechtigkeit leere Phrase sein lassen. Denn: während zwischen 1954 und 1968 die Zahl der österreichischen Arbeitnehmer von 1,97 auf 2,36 Millionen stieg — also um 20 Prozent — wuchs in der gleichen Zeitspanne der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen von 59,1 auf 68,8 Prozent — kaum um 16 Prozent.
Eine solche Einkommensverteilung ist, jedenfalls vom Standpunkt optimaler sozialer Gerechtigkeit gesehen, nicht vollkommen. Das Eigenartige daran ist, daß sie dem Mann auf der Straße nicht auf den Nägeln brennt. Er leidet nicht an seiner relativen Vermögenslosigkeit und auch nicht darunter, daß das Vermögen ungleich verteilt ist und sich fortgesetzt ungleich verteilt. Nicht minder eigenartig ist, daß Gewerkschaftsfunktionäre am Prozeß der Einkommensverteilung mit all seinen Effekten ebenfalls nichts Böses finden; daß sie dessen unverhüllte Problematik bestenfalls hinter verschlossenen Türen diskutieren, sie jedoch recht gewandt aus dem Blickfeld der Diskussion mit Arbeitnehmern zu räumen wissen. Erst jüngst berichtete der „Gewerkschaftliche Nachrichtendienst“, über eine .-Äußerung des >:rHÖGB*Bräaidenten-i Bonya, -wonach' der österreichische Gewerkschaftsbund eine gerechte Einkommensverteilung solange als zweitrangiges Ziel betrachten werde, als die österreichischen Arbeitnehmerbezüge vom westeuropäischen Standard entfernt seien. In der selben Nummer des gewerkschaftsoffiziellen Mitteilungsblattes bestreitet auch Stefan Wiarlander, ehedem ÖGB-Experte für Vermögenspolitik, die aktuelle Notwendigkeit des im sozialistischen Wirhschaftsprogramm postulierten Investivlohnes; jenes Lohnsystem, das den volkswirtschaftlichen Vermögenszuwachs zugunsten der Arbeitnehmer umverteilt. Vielleicht schwingt in solchen Auffassungen noch ein wenig vom harten Kern der marxistischen Theorie mit, wonach eine Politik der sozialen Gerechtigkeit in einer marktwirtschaftlichen Ordnung doch nichts anderes ist, als der Versuch, im Gigan-tenkamipf zwischen Kapital und Arbeit den barmherzigen Samariter zu spielen. Freilich: Seit der Veröffentlichung des Wirtschaftspro-grammes wähnte man solches Denken auch in der SPÖ antiquiert. Daß es jetzt, in der Pulbertätsphase des Wahlkampfes, wieder hochkommt, ist zumindest interessant, wenn es nicht schon beweist, daß das sozialistische Wirtschaftsprogramm sozialistische Politiker zu nichts verpflichtet.
Spart der Arbeitnehmer richtig?
Den Wohlstand unter marktwirtschaftlichen Bedingungen gerechter zu verteilen, also die Einkommensverteilung in der Einkommenspolitik ru verankern, wird seitens der österreichischen Voikspartei jedenfalls anerkannt. Im 1963 beschlossenen „Klagenfurter Manifest“ heißt es, daß die „Schaffung von Eigentum in Arbeiterhand eine soziale Tat jenseits von Kapitalismus und Sozialismus ist“. Eher zufällig als beabsichtigt, fiel der Regierungspartei ein bedeutender Erfolg solchen Denkens in den Schoß: Zwischen 1966 und 1968 stieg der Anteil der Lohn- und Gehaltsquote am Volkseinkommen trotz sinkender Arbeitnehmerzahl fast doppelt so stark als in den Koalitionsjahren zwischen 1963 und 1965. Freilich ist eine solche Entwicklung nicht unbedenklich. Denn
das bestehende Lohnsystam weist den Unternehmern die Funktion des Investierens und den Arbeitnehmern die des Konsums zu. Zwar gelingt es den Arbeitnehmern, bei ständig steigendem Einkommen etwas auf die hohe Kante zu legen, doch das Sparkapital wird bestenfalls zum Erwerb langlebiger Konsumgüter aufgewendet, keineswegs aber risikofreundlich angelegt. Diese äußerst konservative Arbeitnehmermentalität steht einer Vermögensbildung in Arbeitnehmer-■hand recht sperrig im Wege. An dieser Stelle, sicherlich, hat die Politik, sofern ihr an gerechter und volkswirtschaftlich gerechtfertigter Einkommensverteilung gelegen ist, auf den Plan zu treten. Man hat in Österreich nach sehr harten Diskussionen zwischen den Sozialpartnern zu einer von der Arbeitnehmervertretung stillschweigend akzeptierten produktivitätsorientierten Lohnpolitik gefunden, das heißt: Das Wachstum des Sozialproduktes zum Maß der Lohnerhöhungen erhoben. Wenn der Gewerkschaftsbund mit dieser Regelung nicht so ganz einverstanden ist, dann deshalb, weil sie der Regierungspartei nicht zutrauen wollen, optimale Wachstumsraten zu erzielen.
In 10 Jahren 20 Prozent Beteiligung
Dieser Gedankengang muß schnurstracks zu jenem Punkt führen, den, jedenfalls inoffiziell, die SPÖ sich zu verlassen eben wieder anschickt: zum Investivlohn. Er begünstigt die Umverteilung bereits entstandenen Vermögenszuwachses und ist weitgehend frei von den negativen Wachstumswirkungen der Umverteilung sich erst bildender Einkommen.
Der katholische Sozialwissenschaftler Nell-Breuning hat die Wirkung des Investivlohnes an Hand einer
kleinen Berechnung demonstriert: Nimmt man an, der Kapitalstock einer Volkswirtschaft wachse um jährlich fünf Prozent, so würde er nach der Zinseszinsformel in zehn Jahren von 100 auf 163 zugenommen haben. Sollte nun der Arbeitnehmer an dieser Akkumulation mit 50 Prozent teilnehmen, so würde ihm nach zehn Jahren die Hälfte dieses Zuwachses, also 31,5 Prozent gehören; bezogen auf das dann vorhandene Gesamtkapital von 163 wären das 19,3 Prozent. Mit anderen Worten: Nach zehn Jahren wären die Arbeitnehmer mit fast 20 Prozent am volkswirtschaftlichen Produiktionskapital beteiligt, ohne daß das Eigentum der Unternehmer angetastet wäre. Das der ÖVP nahestehende „Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung“ hat in der von ihm editierten Broschüre „Eigentumsstruktur und Eigentumspolitik in Österreich“ dieses Lohnsystem kritisch behandelt: „Bei einer krisenhaften Entwicklung des Unternehmens sind gleichzeitig Arbeitsplatz und Eigentum des Arbeitnehmers gefährdet.“ Daneben weist es auf Neil-Breunings Eingeständnis, das Investivlohnpläne Zwangscharakter haben, genüßlich hin: .Eine Gesellschaft, die die Arbeitnehmer in dieser individuellen Entscheidung behindert und Anforderungen unterwirft, die im übrigen für sie völlig unübersehbar sind, würde unter dem Vorwand der Sicherung des individuellen Eigentums die schlimmste Form des Kollektivismus betreiben.“
Der erste Einwand ist dann fehl am Platz, wenn man akzeptiert, daß eine Vermögenspolitik zugunsten der Arbeitnehmer auch für letztere nicht völlig risikofrei sein kann. Denn wollte man einmal Risken sozialisie-
ren, dann müßte dies letztlich auch mit den Gewinnen geschehen, was das Ende der marktwirtschaftlichen Ordnung bedeuten würde. Nicht minder zwiespältig ist der Einwand des Zwangssparens: Er übersieht, daß die wirtschaftliche Entwicklung in der Nachkriegszeit weitgehend von einem Zwangssparprozeß gekennzeichnet war, daß den kreditfinanzierten Investitionen nur in geringem Umfang freiwillige Ersparnisse gegenüberstanden. In „Bindung und Freiheit als Problem der Eigentumspolitik“, schreibt Joachim Klaus: „Es ergibt sich somit das zwiespältige Resultat, daß in der Nachkriegszeit gerade diejenige Wirtschaftsordnung, die die Freiheit der unternehmerischen Entscheidung als wesentliches Element beinhaltet, den Verbrauchern nicht die Freiheit belassen hat, über die Höhe ihres relativen Konsumverzichtes zu entscheiden.“ Wichtig ist deshalb, so Helmut Meinhold in „Investivlohn und soziale Marktwirtschaft“, zu fra-
gen: „Wollen wir die so oder so erfolgende Beeinträchtigung der Einkommensdisposition in dem bisherigen Umfang den Unternehmern gutschreiben, weil wir das so gewohnt sind und weil es sich bewährt hat, oder können wir die Gutschrift anders verteilen, ohne die Ziele der Vollbeschäftigung und des Wachstums zu gefährden?“
Daß dies möglich ist, liegt auf der Hand: Denn eine niedrige Gewinnrate braucht die Investitionsbereitschaft der Unternehmer nicht zu hemmen, wenn sie bereit sind, die Investitionen nicht allein an den Gewinnen, sondern an der Nachfrage zu orientieren.
Eins freilich ist sicher: Eine Vermögenspolitik auf der Basis des In-vestivlohns vermag in kurzer Zeit überhaupt keine entscheidende Wandlung in den Besitz- und Einkommensverhältnissen herbeizuführen. Was sie erreicht, ist nicht unwesentlich: Eine weitere Verschärfung der Vermögensungleichheit zu vermeiden, den Vermögenszuwachs, nicht aber die bereits bestehenden Vermögen gleichmäßig zu verteilen und an ihm insbesondere die Arbeitnehmer verstärkt teilnehmen lassen. Daß dies notwendig ist, zeigt die Tatsache, daß hierzulande in den letzten fünfzehn Jahren trotz permanent steigender Realeinkommen der Einkommenszuwachs der Arbeitnehmer um ein Viertel hinter dem Einkommenszuwachs der Unternehmer zurückgeblieben ist.
Was Immer die Handlung, ob ernst oder heiter, wer immer die Darsteller, der Regisseur, der Verfasser: wenn man eines von ihnen gesehen hat, hat man alle anderen gesehen. Sie sind alle gleich langweilig in ihrer schwitzigen Psychologie, ihrer peinlichen Intensität und Redseligkeit. Woher dieses Versagen der Dramatik im Fernsehen? Zunächst ist man versucht, es auf die Beschränktheit der Möglichkeiten ■ zurückzuführen Dabei i. ■■kommt man aber darauf, daß das Fernsehen sehr wohl dramatische Spannung hervorzubringen imstande ist, wo es sich um die Übermittlung echten realen Geschehens handelt. Man denke
etwa an die Übertragung der Eishockey - Weltmeisterschaftsspiele zwischen CSSR und Sowjetunion im vergangenen Winter, an gewisse Sozialreportagen, wie die vom Brand des Altersheimes in Klosterneuburg und dergleichen mehr.
Zu Kunst kommt es, wo uns Erleben durch Schaffung neuer Realität ermöglicht wird. Nicht kommt es dazu, wenn über Realität ausgesagt wird. So war die Dramatisierung des Balzacschen Romans „Eugenie Grandet“ kürzlich im Fernsehen so substanzlos und langweilig wie eine Inhaltsbeschreibung in einem Kinoprogrammheft. Mich überrascht immer wieder die Anspruchslosigkeit der Leute, die so etwas herstellen oder als Leiter von dramatischen Abteilungen ins Fernsehprogramm aufnehmen. Diese Leute betrachten das Fernsehen als eine Art Mastgans, die mit Produktionen angestopft werden muß; Fernsehzeit muß ausgefüllt, dem Publikum muß etwas geboten werden. Mit den Impulsen zur „Schaffung neuer Realität“ sieht es spatny aus. Solange das Fernsehen noch jung war, mochte und konnte das erwartungsvoll und in der Hoffnung hingenommen werden, daß schließlich doch etwas Starkes dabei herauskommen würde. Statt dessen wurde daraus eine Masche, vermittels derer Honorare eingestreift werden. Es ist Zeit, daß die Dramaturgen des Fernsehens (soweit sie als solche
anzusprechen sind) ernstlich nachzudenken beginnen. Um das zu ermöglichen, müßte man zunächst ausschließen, was sich in besagter Masche bewegt. Die Programmzeit kann, bis jemandem wirklich etwas einfällt, mit Reportagen gefüllt werden, für die es tausende Anlässe und Möglichkeiten gibt. Der Stummfilm wurde zur Kunst, als er aufhörte, die Schauspielerei und Mimik des Theaters nächzü-3a äftttütt! *und oij tt* tte&forty Js?ch auf den Ablauf von Bildern und Bildeinstellungen zu beschränken. Der Tonfilm hat den Stummfilm bis zum heutigen Tag nicht an Gestaltungskraft erreicht, weil er den Gegensatz zwischen dem zweidimensionalen Bild und der Sprache nicht gelöst hat. Die Sprache ist nicht zweidimensional, sie ist ein sehr reales Ausdrucksmittel, das kaum vom wirklich existierenden Menschen (also von der Buhne) loszulösen ist. Daher ist sie auch im Fernsehen eher eine Belastung als ein künstlerischer Mittler. Was anderes ist's im Hörfunk, wo sie, wie überhaupt Ton und Musik, durch das Wegfallen aller Sichtbarkeit verselbständigt wird. Mit düesen Bemerkungen soll um Gottes willen nicht irgendwelcher geistreicher Krampf ausgelöst werden — wie man ihn uns unlängst mit dem Spiel „Der Frauenmörder“ präsentiert hat. Die darin gemachte Soziafkritik konnte nicht als aufrichtig gemeint empfunden werden. Mit der Kriminalpathologie spielt man nicht, sie ist kein Gag und macht uns gar nicht lustig. „Es kommt uns nicht darauf an, lustig zu sein“, sagen diese jungen Autoren, „eher darum, Vnlust hervorzurufen.“ Die Unlust als dramatisches Element, dos hat uns Brecht eingebrockt. Fs geschah zu einer Zeit, die das als soziale Verpflichtung hinnahm. Brecht spekulierte dabei weit mehr auf diejenigen, die an einem schlechten sozialen Gewissen, als auf jene, die an den sozialen Zuständen litten. Deren Bedarf an sozialer Unlust war und ist zu allen Zeiten gedeckt. Was soll uns das aber alles heute, da Lust und Unlust vergesellschaftet und sozialisiert sind? Von derlei Verallgemeinerungen wieder zum einzelnen Meuchen und seinem Wert zu gelangen, davon handelt die Dramatik; und so möglicherweise auch die des Fernsehens.
JOSEF TOCH



































































































