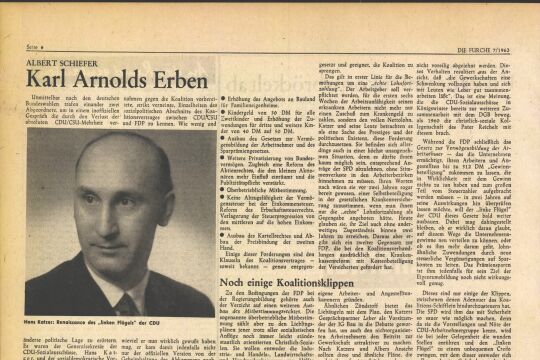Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die rote Grenzlinie
Der Münchner SPD-Unterbezirk, der in den letzten Monaten öfters Anlaß zu überregionalen Schlagzeilen geliefert hat, benutzte erst kürzlich seinen Jahresparteitag dazu, eingehend die Erfahrungen seit der Neuwahl des neuen Vorstands zu diskutieren und Vorschläge zur Abgrenzung gegenüber den Kommunisten, zum Ausländerrecht und sonstigen aktuellen Problemen der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu formulieren. Bei den Debatten wurde deutlich, daß der Graben zwischen dem „konservativen“ und dem „auf antikapitalistische Strukturreformen drängenden“ Flügel unvermindert groß ist. Insbesondere die Spannung zwischen dem eher linksradikalen Vorstand und der noch unter dem Einfluß des ehemaligen Oberbürgermeisters Vogel nominierten Stadtratsfraktion — die bereits in mehreren Fällen gegen Parteibeschlüsse entschieden hat — schafft ständig neue Komplikationen.
Die im Rechenschaftsbericht aufgestellte These, daß es „durch gemeinsames Handeln“ gelungen sei, „die Münchner SPD aus der Krise herauszuführen“, hat sich in der Praxis als wenig stichhaltig erwiesen. Der Münchner Oberbürgermeister Kronawitter sprach im Schwabinger Bräu von der Befürchtung, daß die hiesige SPD eine „Abbruchsgesellschaft“ werde, wenn die Entwicklung weiter so verlaufe. Und der Unterbezirksvorsitzende Schöfberger stellte in seiner Erwiderung fest, daß sich Kronawitter mit seiner Warnung vor dem „Traum der revolutionären
Veränderung“ der Sprache des „Bayernkuriers“ bediene. Mitglieder der Partei müßten es unter Umständen einmal als Vorwurf zu hören bekommen: „Du bist nicht auf der Seite der Freiheit gestanden, sondern auf der Seite.der Ordnung und des Alltags.“
Als Gründe für die Auseinandersetzungen innerhalb der Münchner Partei während der Jahre 1970 bis 1972 wurde vom Vorstand ein ganzer Katalog aufgezählt: theoretische Erstarrung der gesamten SPD in den sechziger Jahren, Ausrichtung der Münchner SPD auf eine überragende Persönlichkeit bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Mitgliederemanzipation, verschleppte Gerierationen-ablöse in Führungsfunktionen mit nachfolgendem plötzlichem Wechsel, breites Einströmen junger Mitglieder aus der studentischen Bewegung einschließlich des mitgebrachten „radikaldemokratischen Bewußtseins“, erneuter Wille zur Diskussion und Mitverantwortung bei den Mitgliedern, wechselseitiges Fehlverhalten von Genossen beim Umgang mit anderen Sozialdemokraten.
Die geführten Auseinandersetzungen drehten sich nach dem Bericht um Zielvorstellungen, Strategie und Taktik der SPD, insbesondere um einige Fehlentwicklungen in der sozialdemokratischen Kommunalpolitik und um unterschiedliche Auffassungen über die Frage der Bindung des Mandats an die Partei. Mittlerweile, so wurde unter Mißachtung der tatsächlichen Verhältnisse versichert, sei die Lage der Münchner
SPD weitaus besser als noch vor einem Jahr. Verschleppte Krisenerscheinungen gebe es nur noch in der Stadtratsfraktion. Problematisch seien ferner die mageren Wahlerfolge sowie die große Finanzierungslücke. Als Aküivum breit herausgestellt wurde dagegen der Erfolg beim Volksbegehren über die Rundfunkfreiheit.
In der anschließenden Diskussion spielte die Frage des imperativen Mandats wieder eine entscheidende Rolle. Oberbürgermeister Kronawit-ter äußerte dabei die nachher als „ungeheuerlich“ qualifizierte These, daß das Wählermandat dem Parteimandat gegenüber den Vorrang be-
sitze. Des weiteren wurde auf die Tatsache verwiesen, daß die SPD bereits eine Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer eingesetzt habe, was für eine „Partei der Arbeiter“ äußerst befremdlich sei. Scheinbar wenig Eindruck machte auch die Mahnung des 3. Bürgermeisters Müller-Heydenreich, daß die Partei in weiten Bereichen Gefahr laufe, den Kontakt mit der Bevölkerung zu verlieren. Breiten Raum in der Diskussion beanspruchte schließlich noch die Behandlung eines Antragskomplexes, der sich mit dem Parteiratsbeschluß bezüglich der Abgrenzung gegenüber den Kommunisten befaßte. In der Ablehnung dieser 1970 vom Parteirat erlassenen Verfahrensregelung, die eine Zusammenarbeit mit den Kom-
munisten weitgehend ausschloß, war man sich in München ziemlich einig. Sehr unterschiedliche Auffassungen bestanden dagegen in der dafür zu liefernden Motivation.
Gestärkt durch das Bewußtsein, daß der bevorstehende Ubertritt einiger Münchner Jungsozialisten zur DKP doch noch eine Trennungslinie markiere, verabschiedete der Parteitag die folgende Beschwichtigungsformel: „Der Parteitag fordert alle Gliederungen auf, die Theoriediskussion über den demokratischen Sozialismus an Hand von konkreten Beispielen anzustreben, um dadurch den Mitgliedern und der Öffentlichkeit die Unvereinbarkeit von Kommunismus und demokratischem Sozialismus zu verdeutlichen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!