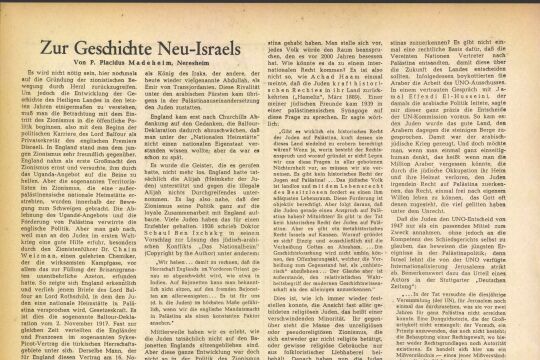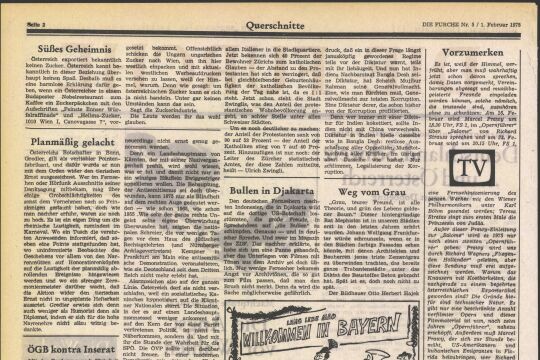Die Wut regiert, und der Frieden ist so weit weg wie die Pessach-Erzählung vom Gelobten Land.
Wer die Juden an ihren höchsten Feiertagen angreift, dem geht es nicht bloß um ein Mehr oder Weniger an Landgewinn. Wer die Juden attackiert, während sie ihr Glas auf Erez Israel erheben, der greift explizit die jüdische Identität an, der zielt auf die israelische Volksseele.
"Was unterscheidet diese Nacht von all den anderen?" fragt das jüngste Kind am ersten jüdischen Pessach-Abend. Und die Erwachsenen antworten mit der Erzählung über Mose, über den Auszug der Hebräer aus Ägypten, über ihre beschwerliche Wanderschaft in die neue Heimat Kanaan. 3.000 und mehr Jahre später wird mit dem diesjährigen Pessach-Fest erneut ein Wendepunkt in der Geschichte Israels markiert. Jeden Tag sprengen sich palästinensische Selbstmordattentäter in die Luft, reißen Aberdutzende mit sich in den Tod und berauben ein Volk der Illusion, Heimat bedeute Sicherheit, Gewalt könne mit Gegengewalt gestoppt oder wenigstens eingedämmt werden.
Die traumatisierten Israelis ringen um Begriffe für das Drama, um schließlich "Pessach-Massaker" durch das Synonym für die definitive und absolute Katastrophe zu ersetzen: "Israels Ground Zero". Der Vergleich mit dem 11. September steht nicht nur für den fassungslosen, hilflosen Schrecken. Der Rückgriff auf die World-Trade-Center-Tragödie beinhaltet und rechtfertigt zugleich auch schon die geplante Reaktion: Krieg dem Terror, kompromisslos, total.
Beide Seiten, Israelis und Palästinenser, sind in diesen Tagen endgültig an einem Punkt angelangt, von dem es vorerst kein Zurück mehr gibt und das Vorwärts auf Schlag und Gegenschlag, auf Vergeltung für Vergeltung sich beschränkt. Damit ist der Konflikt wieder dort, wo er vor über 50 Jahren seinen Ausgang genommen hat. Jetzt geht es nicht mehr um Prozente, jetzt geht es wieder ums Prinzip, nicht mehr um ein Stück Land, wieder um die nackte Existenz. Das schürt die alten jüdischen Ängste der Ausgrenzung. Die israelische Tageszeitung Ha'aretz schreibt über einen palästinensischen Selbstmordattentäter: "Er tat es nicht, um sein Land zu bestätigen, sondern um uns zu verneinen. Nicht um es zu befreien, sondern um uns zu beseitigen. Das ist das Ziel dieses Krieges: uns von hier zu vertreiben."
Meldungen über brennende Synagogen in Frankreich und Belgien, aber auch schon Berichte, Israelis seien in manchen europäischen Hotels nicht mehr willkommen, bestärken das völlig verunsicherte Volk natürlich noch in seiner Existenzangst. Das lässt sogar Friedensbewegte wie Amos Oz, den Gründer von "Peace now", die Forderung erheben: "Das jüdische Volk hat das Recht, an einem Ort in der Mehrheit zu sein, und dieses Recht ist unanfechtbar. Dieses Recht ist verankert in der erlittenen Demütigung, immer und überall eine Minderheit gewesen zu sein."
Wer wollte Amos Oz widersprechen, wenn er klagt, "dass Juden überall mit dem Rücken zur Wand stehen"? Wer wollte seine und die der anderen europäischen Juden während der Flucht vor dem Holocaust gemachte Erfahrung bestreiten, überall auf der Welt unerwünschte Eindringlinge, unwillkommene Bittsteller, "displaced persons" gewesen zu sein? Niemand kann das, darf das, soll das. Die Existenzberechtigung des Staates Israel muss ein für alle Mal außer Frage stehen.
Doch erlittenes Unrecht lässt sich nicht mit Unrecht gegen Andere, Dritte aufrechnen. Genauso wenig wie Europa und die Welt begangenes Unrecht auf Kosten eines Volkes, in diesem Fall die Palästinenser, wieder gut machen können. Nimmt man das Völkerrecht zum Maßstab, dann hat Israel keinen Anspruch auf die nach dem Sechstagekrieg 1967 besetzten Gebiete inklusive Ost-Jerusalem. Und auch wenn es die Israelis nicht sonderlich interessiert: Völkerrecht ist bindend, UN-Resolutionen ebenso. Nicht zu vergessen, dass ein heutiger Palästinenserstaat sowieso höchstens nur mehr ein Fünftel des britischen Mandatsgebiets Palästina vor 1948, dem Jahr der Staatsgründung Israels, umfassen würde. Noch dazu zerteilt in Enklaven durch den israelischen Sündenfall Siedlungspolitik. Produkt des jahrzehntelangen Nachgebens gegenüber den ultraorthodoxen Parteien, die aus der Bibel ein Grundbuchkataster machen. Nüchtern besehen aber eine reine Kolonialpolitik betreiben, mit dem Ziel, Fakten zu schaffen, die den israelischen Anspruch auf die besetzten Gebiete unwiderruflich festschreiben.
Doch das Abwägen von Argumenten, selbst Schuldzuweisungen interessieren jetzt nicht mehr, können im Bombenlärm ja nicht einmal mehr von den Besonnenen gehört werden. Alles, was Israel zu seiner Sicherheit unternommen hat, verkehrt sich jetzt in sein Gegenteil. Die besetzten Gebiete, als Schutzzone und Puffer gedacht, sind zum Nährboden für Selbstmordattentäter geworden. Und Premier Ariel Sharon, der General, der Falke, der wegen seiner Härte und Kompromisslosigkeit gewählt wurde, hat erst das Fass zum Überlaufen gebracht, auch wenn viele Sharon mittlerweile nicht mehr als Ursache der Konfrontation, sondern als Symptom eines aus vielen Gründen gescheiterten Friedensprozesses sehen.
Die Wut regiert. Und jene Wenigen, für die sich Politik auch angesichts der Gewaltspirale nicht auf Vergeltung beschränkt, reden einer strikten Trennung zwischen Israelis und Palästinensern das Wort. Mauern, Zäune, Gräben - das wäre noch kein Friede, aber ein Weg die Eskalation zu stoppen. Und wenn einmal der eine sich nicht mehr jeden Tag vor dem anderen fürchten muss, Sicherheit und Vertrauen wieder wächst, können beide erneut über Frieden reden - ein Wort, das in diesen Tagen zur Schimäre verkommen ist, ein Wort, das in diesen Tagen so ewig weit weg erscheint wie die Pessach-Erzählung vom Gelobten Land.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!