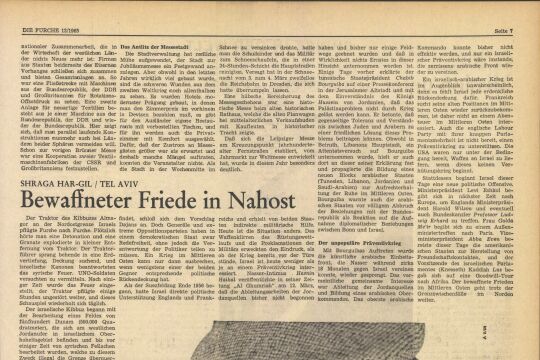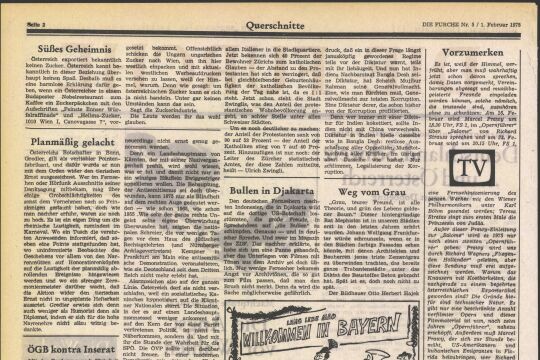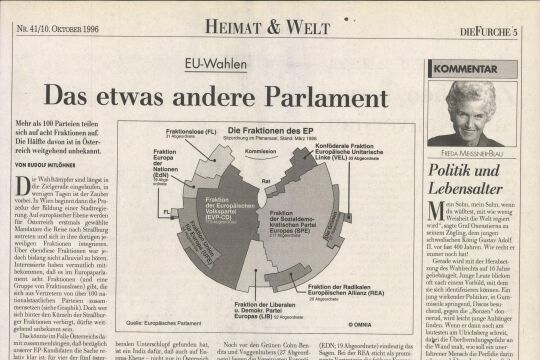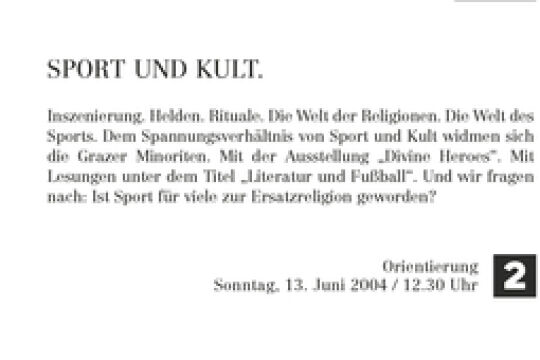Am Jerusalemer Tempelberg, hat die augenblickliche Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern ihren Ausgang genommen. Al-Aksa-Intifada wird das gegenseitige Töten seither genannt und von beiden Seiten als Auswuchs heiligen und von der Religion gerechtfertigten Zorns verteidigt.
Die meisten Israelis glauben nicht an Gott, aber sie sind überzeugt, dass er ihnen ihr Land gegeben hat." Mit diesem Witz antwortet der Nahost-Experte des Österreichischen Instituts für Internationale Politik, John Bunzl, auf die Frage, wie stark religiöse Motive den derzeitigen Palästina-Konflikt bestimmen. Bunzl erinnert im furche-Gespräch daran, dass die Bezeichnung der aktuellen Al-Aksa-Intifada auf den provokanten Besuch Ariel Sharons vor etwas mehr als einem Jahr am Jerusalemer Tempelberg zurückgeht, die unheilige Auseinandersetzung somit an einem heiligen Ort ihren Ausgang genommen hat.
Doch ist es zutreffend, das gegenseitige Töten, die palästinensischen Selbstmordanschläge, den israelischen Staatsterror, "unheilig" zu nennen? Kämpfen Israelis und Palästinenser nicht ihrer Ansicht nach einen heiligen Krieg um heiliges Land? Bunzl: "Die religiöse Komponente spielt eine Rolle und wird von beiden Seiten als Rechtfertigung benutzt." Auffallend ist aber, so der Nahostspezialist, dass während auf palästinensischer Seite religiös-fundamentalistische Gruppen wie die Hamas starken Zulauf haben, Israels Ministerpräsident Sharon die religiöse Komponente momentan nicht sonderlich in den Vordergrund stellt. "Sharon interpretiert die Auseinandersetzung derzeit vor allem als Kampf gegen den Terrorismus - sicher weil er damit auch international besser ankommt." Doch auch wenn Sharon im Moment die Terror-Argumentation als Rechtfertigung bevorzugt, heißt das noch lange nicht, dass er zu Zugeständnissen in der israelischen Siedlungspolitik bereit sein könnte. Da hilft es auch nichts, dass laut Projektkoordinatorin der Friedrich-Ebert-Stiftung in den palästinensischen Gebieten in Ost-Jerusalem, Muriel Asseburg, große Teile der israelischen Bevölkerung den jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten sehr reserviert bis total ablehnend gegenüberstehen. "Mit dem Revolver an der Schläfe wird Sharon in dieser Frage niemals nachgeben, geschweige denn einlenken", ist Asseburg überzeugt.
Einen religiösen Konflikt sieht sie gegenwärtig nicht gegeben. Vielmehr werde die Religion bewusst instrumentalisiert, um damit die Fronten besser abzustecken, den jeweils eigenen Standpunkt zu klären. Als Beleg dafür verweist Asseburg auf das Faktum, dass erst mit der Entstehung des Zionismus, Ende des vorletzten Jahrhunderts, der jüdische Anspruch auf Jerusalem von den Muslimen in Frage gestellt wurde. Nachgefragt, wer von den Streitparteien mehr auf die Religionskarte setzt, spricht sich die Politikwissenschafterin und Juristin für die Palästinenser aus: "Die Verknüpfung der Auseinandersetzung mit dem Tempelberg und die Bezeichnung Al-Aksa-Intifada ruft die gesamte islamische Welt zur Solidarität mit den Palästinensern auf."
Billige Ausrede
Ari Rath, Journalist und langjähriger Friedensaktivist in Jerusalem, wiederum hält die Bezugnahme auf den Tempelberg für "eine billige Ausrede, einen dummen Vorwand". Wäre Sharon damals nicht auf den Tempelberg gegangen, (Rath: "unverständlich, blöd und inakzeptabel"), etwas anderes hätte als Anlass für eine zweite Intifada herhalten müssen, erklärt der frühere Chefredakteur der Jerusalem Post am Telefon lautstark seine Sicht der Dinge. Für Rath handelt es sich um einen politisch-nationalen Konflikt, und die Politiker beider Seiten sollen sich besinnen, eine politische Lösung vorantreiben und nicht die Religion andauernd als Ausrede vorschieben.
Andererseits, dieses Erklärungsschema ist altbewährt. Religion oder Geschichte oder beides ineinander verwoben wird schon seit jeher in Palästina dazu benutzt, eigene territoriale Ansprüche zu rechtfertigen. Seit Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung behauptet jeder, das eroberte Gebiet sei sein historisches Erbe, und mit uralten Vorwürfen wird eine Politik gerechtfertigt, die zu immer neuen Konflikten führt. "Schon vor Jahrtausenden war es offenbar nicht möglich, dem Schatten der Vergangenheit zu entkommen", schreibt die Journalistin des Wall Street Journal, Amy Dockser Marcus, in ihrem aktuell erschienenen Buch "Tempelberg und Klagemauer. Die Rollen der biblischen Stätten im Nahost-Konflikt" (Deuticke Verlag, Wien). Mit der Bibel im Gepäck reiste Dockser zu den jüngsten archäologischen Ausgrabungen im Nahen Osten. Denn in dieser Region, schreibt Dockser, "ist die Archäologie noch heute eine nationale Aufgabe, und die Grabungsbefunde haben politische Folgen".
Eine der ersten Maßnahmen der palästinensischen Regierung bestand nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens 1993 darin, ein Ministerium für Archäologie einzurichten sowie vehement auf ihrem Recht zu beharren, in ihren Gebieten an allen Stellen zu graben und die Ergebnisse nach ihrer Fasson interpretieren zu dürfen. Umgekehrt entstand auch die nationale archäologische Organisation Israels kurz nach der Gründung des Staates. Israelische Archäologen versuchten die historische Wahrheit der Bibel und damit das Recht der Juden auf die erneute Landnahme zu beweisen. Archäologische Funde bildeten die Grundlage für praktisch alle nationalen Symbole, vom Staatssiegel über die Motive auf Briefmarken und Münzen bis zu den von der Regierung verliehenen Medaillen.
Für John Bunzl ist Archäologie "die politischste Wissenschaft" in Israel: "Die graben und graben, um Belege für die jeweilige Geschichtsauffassung zu finden." Doch Bunzls Auffassung scheint, nicht mehr ganz richtig zu sein: Dockser zumindest schreibt, dass sich eine neue Archäologeneration vom Anspruch, "den territorialen Bestrebungen einer Regierung zu dienen oder den Beweis für die angebliche Überlegenheit einer religiösen oder ethnischen Gruppe zu erbringen" befreit hat. Sowohl die biblischen Berichte als auch die Landkarte des Nahen Ostens erscheinen durch die Brille neuer Ausgrabungen betrachtet in einem anderen Licht. Die Quintessenz der Ausführungen von Dockser ist, dass nicht Kampf und Gegeneinander, sondern Kooperation und Koexistenz das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen im Nahen Osten der Antike bestimmt hat.
Ein Modell für die Gegenwart? John Bunzl ist skeptisch: "Stätten, die beiden Seiten heilig sind und die gemeinsame Vergangenheit steigern derzeit eher die Spannungen - aber natürlich könnten sie irgendwann einmal auch das Gegenteil bewirken." Und auch Gerhard Bodendorfer, Judaist und Bibelwissenschafter in Salzburg, gibt sich pragmatisch: Wenn den Israelis die biblischen Philister und Kanaaniter nicht nur mehr als Feinde präsentiert werden, ist das sicher eine Chance für ein vorurteilsfreieres Miteinander. Doch heute stellt sich für die Menschen im Nahen Osten vorrangig die Frage: Wie kann ich überleben? Um sich anderen Fragen zuwenden zu können, bräuchte es einen längerfristigen Waffenstillstand. Und der ist nicht in Sicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!