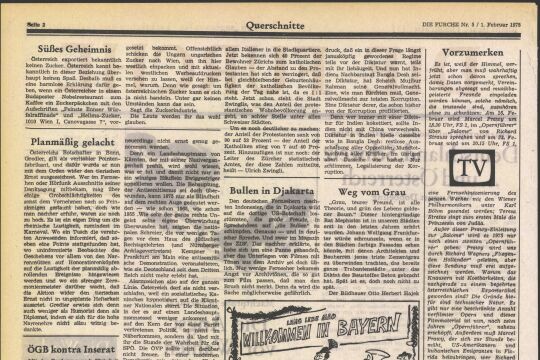Doch lieber Butter als Kanonen
Die Genfer Friedenskonferenz scheint, nach Zustandekommen und korrekter Erfüllung der Truppenentflechtungsabkommen zwischen Ägypten und Israel für die Suezkanalfront und zwischen Syrien und Israel für die Golanfront, in diesem Herbst eine beschlossene Sache zu sein. Amerikas Außenminister Henry Kissinger gelang, worum sich Generationen von Zionisten vergeblich bemüht oder es erst gar nicht versucht haben; er beseitigte Berge von Mißtrauen und Angst zwischen Israelis und Arabern. Im Nahen Osten spürt man gegenwärtig überall, wie sehr man arabischerseits überrascht ist von der „Wandlung Israels“. Der Truppenrückzug aus Teilen der im Junifeldzug 1967 und Oktoberkrieg 1973 besetzten arabischen Gebiete zeigt deutlich, daß man mit den Israelis auch verhandeln kann und daß de sich an gegebene Zusagen und geschlossene Verträge halten.
Die Genfer Friedenskonferenz scheint, nach Zustandekommen und korrekter Erfüllung der Truppenentflechtungsabkommen zwischen Ägypten und Israel für die Suezkanalfront und zwischen Syrien und Israel für die Golanfront, in diesem Herbst eine beschlossene Sache zu sein. Amerikas Außenminister Henry Kissinger gelang, worum sich Generationen von Zionisten vergeblich bemüht oder es erst gar nicht versucht haben; er beseitigte Berge von Mißtrauen und Angst zwischen Israelis und Arabern. Im Nahen Osten spürt man gegenwärtig überall, wie sehr man arabischerseits überrascht ist von der „Wandlung Israels“. Der Truppenrückzug aus Teilen der im Junifeldzug 1967 und Oktoberkrieg 1973 besetzten arabischen Gebiete zeigt deutlich, daß man mit den Israelis auch verhandeln kann und daß de sich an gegebene Zusagen und geschlossene Verträge halten.
In Ägypten und Syrien, den beiden arabischen Hauptexponenten in vier Nahostkriegen, bewirkte das bereits die ersten Anzeichen einer tiefgreifenden psychologischen Änderung in der Beurteilung der Palästinafrage.
Damit sind wir beim Stichwort: Palästina.
Wer Henry Kissingers Marathonläufe zwischen Kairo und Jerusalem, Jerusalem und Damaskus verfolgte, gewann leicht den Eindruck, als handle es sich bei dem Nahostkonflikt lediglich um eine Auseinandersetzung zwischen bereits bestehenden Staaten. Diese Staaten halten, soweit es die Araber angeht, eine friedliche, gerechte und dauerhafte Vernunftlösung zwar nur dann für möglich, wenn sie die berechtigten Interessen der Palästinenser einschließt. In Israel betrachtete man die Palästinenser lange als „nicht existent“ und argumentierte, zwischen Jerusalem und Amman sei „kein Platz für einen dritten Staat“ (Golda Meir), doch seit dem Regierungswechsel wuchs offenkundig auch hier die — durch den extremistischen Terror allerdings immer wieder gebremste — Einsicht in die Notwendigkeit von Verhandlungen auch mit den Palästinensern. Die Sowjetunion hofiert die palästinensischen Freischärler seit längerem, empfängt ihre Anführer im Kreml und gewährt ihnen verbale politische und konkrete finanzielle und waffentechnische Unterstützung. Die USA ignorierten zwar die politischen Ansprüche der bislang aufgetretenen Guerilla-Organisationen der Flüchtlinge lange Zeit, obwohl sie durch ihre Finanzbeiträge an die internationale Hilfsorganisation UNRWA deren Aufkommen indirekt gefördert hatten, und noch auf seiner jüngsten Nahostreise ließ USA-Präsident Richard Nixon alle entsprechenden Äußerungen seiner arabischen Gastgeber unbeantwortet. Erst in Jordanien verstand er sich zu vagen Andeutungen über die zu berücksichtigenden Rechte des palästinensischen Volkes.
Die Palästinenser erfüllt das alles mit zunehmender Enttäuschung und Verzweiflung. Sie glauben zu wissen, und es ist ihnen darin kaum glaubhaft zu widersprechen, daß die arabischen Regierungen vor dem Sechstage- und dem Ramadan-Krieg nur daran dachten, wie sie die erhoffte palästinensische Beute am besten unter sich aufteilen, und danach, wie sie das von ihnen mitverschuldete Problem am leichtesten loswerden könnten; daß die Zionisten ihre eigentlichen palästinensischen Widersacher am liebsten so weit weg wie möglich wüßten; daß die Sowjetunion nur an der Errichtung einer zuverlässigen Machtbasis in der instabilen Nahostregion interessiert sei; und daß Amerika zwar jede humanitäre Lösung des Flüchtlings-, aber kaum eine die zionistischen Interessen beeinträchtigende politische Regelung des Palästinaproblems fördern würde.
Diese „Hintergrundgestaltung“ des hier beabsichtigten palästinensischen Kolossalgemäldes (wahrscheinlich ist sie nicht objektiv, wohl aber in palästinensischen Augen subjektiv richtig) macht die seit den beiden von Henry Kissinger vermittelten Truppenentflechtungsabkommen zu beobachtende Entwicklung erst richtig verständlich.
Alle Beobachter der palästinensischen Szene waren sich seit dem Ende des Ramadan-Krieges im vorigen Oktober darüber einig, daß das seitdem angestrebte und inzwischen zustande gekommene militärische Disengagement durch Entflechtungsverträge zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern und des damit zur greifbaren Chance gewordenen Zustandekommens aussichtsreicher Friedensverhandlungen zwangsläufig die Palästinenser auf den Plan rufen müsse. Die Auguren, die diesmal wirklich das Gras wachsen hörten, prophezeiten sogar exakt die beiden Ebenen der nunmehr unausweichlichen Auseinandersetzung: verstärkter und die Friedensbemühungen wahrscheinlich ernsthaft gefährdender Guerillaterror gegen Israel und blutige Zusammenstöße unter den Freischärlergruppen selbst. Beides ist mit tödlicher Präzision eingetroffen. Die Anschläge von Kiriat Schmona, Ma'alot, Schamir und Na-haria waren weitaus mehr als verzweifelte Versuche isolierter Extremisten zur Störung der bevorstehenden Friedensverhandlungen. Das zeigt schon der Umstand, daß sich an ihnen keineswegs nur Gruppen wie die für die früheren Flugzeugentführungen verantwortliche „Volksfront für die Befreiung Palästinas“ oder der vorwiegend auf Terror innerhalb der arabischen Staaten spezialisierte „Schwarze September“ beteiligten. Diesmal kamen die Einsatzbefehle von der längst übereinstimmend als „gemäßigt“ eingestuften „El-Fatach“ („Die Eroberung“) des PLO-Chefs Abu Ammar, alias Jassir Arafat, und von der „Demokratischen Volksfront“ des marxistischen Ideologen Nedschif Hauetmie, der früher ein friedliches Zusammenleben von Arabern und Juden in Palästina lediglich an die Entstehung eines „sozialistischen“ Israel gebunden hatte.
In Europa hat man sich daran gewöhnt, dem trotz aller vorangegangenen zionistischen Kolonisationsleistungen erst durch die nationalsozialistische Judenverfolgung unausweichlich gewordenen jüdischen Recht auf einen eigenen Staat in Palästina das Recht der muselmanischen oder christlichen Araber Palästinas auf eine eigene Heimat unterzuordnen. Es geschah erst wieder im Juni 1974, daß ein deutscher Botschaftsbeamter der Ehefrau eines Paßantragstellers zumutete, sie sei Jüdin und solle doch auf ihre deutsche Staatsangehörigkeit verzichten. „Die Juden gehören nach Palästina!“ Diese frühnationalsozialistische
Doktrin, die damals schon nicht zu verwirklichen war, ließ und läßt das Schicksal der arabischen Palästinenser im Zwielicht. Soll der Genfer Herbst mehr als eine Hoffnung bleiben, bedarf es einer grundsätzlichen Neuorientierung der Weltmeinung über das Palästinaproblem. Die Entstehung Israels schuf nun einmal kaum noch veränderbare Tatsachen. Die Zionisten können nicht zurück zu einer Art „jüdischem Vatikan“ als bloßer Heimstätte für eine Handvoll Gläubiger oder Verfolgter inmitten einer andersartigen Umwelt. Die Araber müssen akzeptieren, daß dieser Staat die Heimat aller derer ist und bleibt, die lieber dort als anderswo leben wollen. Die Israelis aber scheinen, so sieht das wenigstens in arabischen Augen aus, noch einsehen zu müssen, daß ihr Staat selbst dann ungesichert bleiben wird, wenn ihn die arabischen Nachbarstaaten mit allem diplomatischen Brimborium anerkannt haben werden.
Sind nun die Guerilleros die einzige politische Vertretung der Palästinaflüchtlinge? Diese Frage läßt sich mit dem Hinweis auf Zahlen allein kaum beantworten. Beantwortbar wäre sie und die nach der Zukunft der Palästinenser ganz allgemein nur dann, wenn sich die Beteiligten endlich auf den seit mehr als 25 Jahren ausstehenden Versuch einer systematischen Meinungserforschung unter den rund zweieinhalb Millionen Palästinensern einigen würden.
Doch dagegen sind die meisten Guerillagruppen, angeblich weil sie den eigentlichen politischen Meinungsbildungsprozeß erst nach der Gründung eines Palästinastaates einleiten wollen, tatsächlich aber, weil etwa eine international kontrollierte Volksabstimmung sie auf ihre wirkliche Bedeutung reduzieren könnte. Die Araberstaaten sind nicht dafür, weil sich einige von ihnen, mindestens Jordanien und Syrien, noch immer Hoffnungen auf den Gewinn von Teilen palästinensischen Territoriums machen und weil sie, die heute eher auf eine friedliche Vernunftlösung des Nahostkonflikts hinauswollen, die störende Sprengwirkung eines Palästinastaates fürchten. König Hussein und Israel sind dagegen, weil sie in einem Palästinastaat ein ebensowenig lebensfähiges wie noch auf unabsehbare Zeiten hinaus revanchistisch gesinntes Gebilde erblicken, dessen expansinisti-sche Politik sich nicht nur gegen Israel, sondern sogar in erster Linie gegen das haschimidische Königreich richten müßte. Die Israelis müßten zudem damit rechnen, daß auch die im Norden ihres Landes lebenden „israelischen“ Araber die Gelegenheit eines Plebiszites nutzen würden, um sich aus ihrem Staat davonzumachen. Die etablierten Palästinenser in den arabischen Nachbarstaaten sind nicht daran interessiert, weil sie kaum an eine „Heimkehr“ denken, die Ortsansässigen in den gegenwärtig noch israelisch besetzten Gebieten sind dagegen, weil sie nicht sicher sein können, ob sie ihr traditionelles politisches Gleichgewicht gegen die revolutionäre Sprengwirkung der Freischärlerbewegung behaupten und weil sie voraussehen, daß der Rückstrom von bis zu zwei Millionen Flüchtlingen politische, ökonomische und soziale Probleme aufwerfen würde, die selbst mit ausländischer Hilfe nur schwer zu bewältigen wären.
Es spricht also nur wenig dafür, daß es zur Gründung eines selbständigen Palästinastaates kommt, den nicht einmal die „Fedaijjin“ klar anstreben. Nur wenige von ihnen haben durchblicken lassen, daß sie mit einem Rumpfstaat „Klein-Palästina“ zufrieden wären; die meisten propagieren diesen Rumpfstaat als bloße Etappe auf dem langen Marsch zur vollständigen Revision der seit 1948 geschaffenen Tatsachen.
Man hat das palästinensische nicht selten mit dem deutschen Flüchtlingsproblem verglichen. Daran knüpft sich dann zwangsläufig die Frage, wie sich das auf den Weltfrieden ausgewirkt hätte, wenn die Deutschen ihre Flüchtlinge über ein Viertel Jahrhundert lang in Lagern entlang der Zonengrenze festgehalten hätten? Dieser Vergleich hinkt freilich, wie alle Vergleiche. Die deutschen Flüchtlinge kamen zwar in ein zerstörtes und ausgeblutetes Land, in dem es aber noch immer unerschöpflich scheinende intellektuelle und industrielle Energiereservoirs gab, zu denen sie weitere beisteuern konnten. Hinzu kam der Marshallplan. Die Palästinaflüchtlinge von 1948 kamen aus dem bäuerlichen oder städtischen Lumpenproletariat. Die meisten von ihnen waren besitzlose Landarbeiter, denen die im Ausland lebenden Großgrundbesitzer den Boden unter dem Hintern weg an die „Jewish Agency“ verkauft hatten. Sie kamen aus katastrophalen Lebensverhältnissen und besaßen bestenfalls eine kümmerliche Schulbildung. Die Reichen und die Klugen gingen nicht in die Flüchtlingslager. Doch dank der UN-Hilfe wurde das Lagerleben in ernährungs- und gesundheitspolitischer Hinsicht und auf dem Bildungssektor vielfach besser als das in der verlorenen Heimat. Zudem brauchte man kaum zu arbeiten. Dieser Umstand erklärt viel von der Lethargie unter den Palästinensern und von der magischen Anziehungskraft des Terrorismus auf die Lagerjugend. Wenn man es im Lager besser hat als in der Stroh- oder Wellblechhütte jenseits der Demarkationslinien, warum sollte man sich dann um eine Ansiedlung in einem der Nachbarländer bemühen?
Einer systematischen Flüchtlingsansiedlung standen keineswegs nur psychologische Hindernisse und der Wunsch der Araberstaaten, aus dem Flüchtlingsproblem demagogisches Kapital zu schlagen, im Weg. Im Ägypten, Syrien, geschweige denn Jordanien, der ersten fünfziger Jahre bestand kaum die echte Chance zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung der Flüchtlingsmassen. Das Nilland war ständig selbst vom Hunger bedroht und litt (und leidet übrigens) an katastrophalem Bevölkerungsüberschuß. Syrien hatte nur wenig landwirtschaftliche Reserven und eine denkbar unterentwickelte industrielle Struktur. Jordanien lebt bis heute von westlichen Subsidien an seinen Staatshaushalt. Die ausgebildeten Palästinenser fanden durchaus gute Jobs in einem der Araberstaaten, und manche brachten es dort zu Reichtum, Ansehen und Einfluß. Doch für die Masse der Ungebildeten und Armen bestand keine Chance.
Heute geht es einfach darum, zweieinhalb Millionen Menschen nicht einfach dem „lieben Frieden“ zu opfern, so teuer er auch den Völkern des Nahen Ostens ist. Bestand haben kann ein Friede nur, wenn er kein ungelöstes Problem von solcher Brisanz zurückläßt. Israel allein kann dieses Problem keinesfalls lösen. Als es entstand, verließen nach übereinstimmenden und gesicherten Zahlen knapp 700.000 Palästinenser das Land, während mehr als 600.000 arabische Juden aus den Mittelmeerländern nach Israel einwanderten. Rein zahlenmäßig gibt es also gar kein Problem. Doch die Räumung der Flüchtlingslager ist die wichtigste Voraussetzung eines nicht nur auf dem Papier stehenden Nahostfriedens. Um ihn herbeizuführen, bedarf es eines anderen Papiers, jenes nämlich, auf dem die Notenbank der Vereinigten Staaten von Amerika ihre Dollarnoten druckt. Gegenwärtig hört man überall im Nahen Osten immer wieder die beschwörend klingende Zauberformel von einem „Marshallplan“ für Palästina. Oder, wie es ein palästinensischer Intellektueller ausdrückte: „Wenn wir zwischen Kanonen und Butter wählen können, wählen wir die Butter — doch, ihr müßt uns erst einmal zu dieser Wahl verhelfen!“




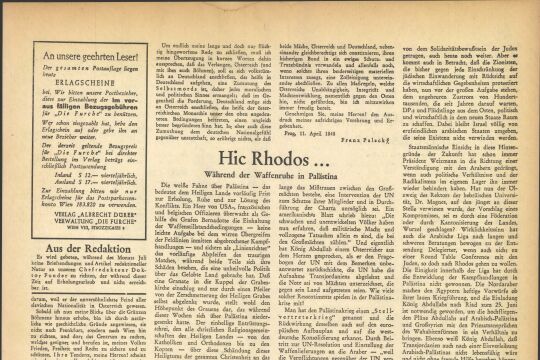

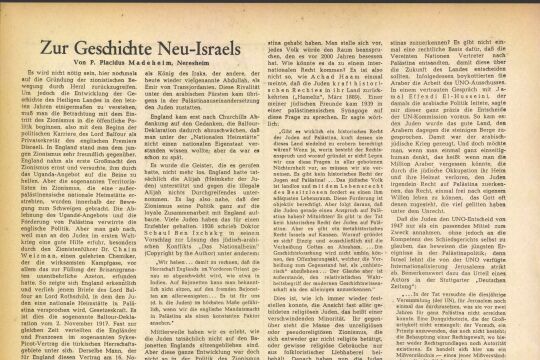













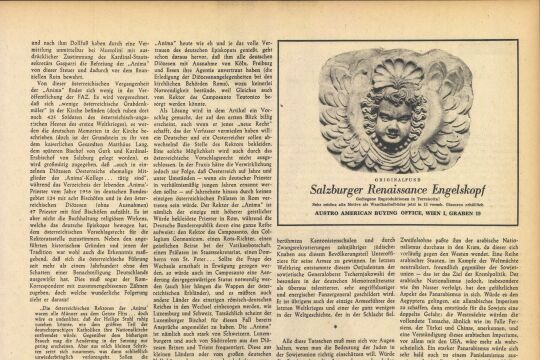



























.jpg)