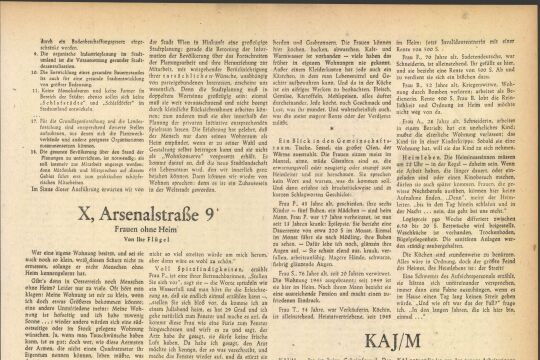Boote randvoll mit Flüchtlingen landen derzeit an Maltas Küste. Malta ist das einzige EU-Land, das Flüchtlinge automatisch einsperrt. Eine Reportage aus dem Internierungslager.
Im Niemandsland zwischen Flughafen und Südküste liegen die beiden maltesischen Internierungslager "Safi Barracks“ und "Lyster Barracks“. Hohe Mauern und viele Meter Stacheldraht trennen die hier lebenden Flüchtlinge von der Außenwelt. Soldaten bewachen das Eisentor und den Schranken am Eingang. Nur Angestellte dürfen den Checkpoint passieren - immer wieder auch Mitarbeiter von NGOs und seit kurzem auch Journalisten.
Im Gebäudekomplex "Safi Barracks“ sind die Männer untergebracht. Einige Flüchtlinge sitzen auf den Fensterbänken und schauen durch die Gitterstäbe auf den Innenhof. Andere bewegen sich trotz Mittagshitze im abgezäunten Hof. "Wir sind zu dieser Jahreszeit randvoll mit jungen Flüchtlingen aus Afrika“, erzählt ein Offizier des maltesischen Militärs. Im Sommer, wenn das Meer nicht so rau ist, landen die meisten Flüchtlingsboote an der Küste. Im Herbst wird das Mittelmeer stürmischer und die Überfahrt von Nordafrika zum lebensgefährlichen Unterfangen. Nach der Katastrophe von Lampedusa mit bereits über 350 Toten ist letzte Woche schon zum zweiten Mal binnen weniger Tage ein Flüchtlingsboot zwischen der italienischen Insel Lampedusa und Malta gekentert. Wieviele Menschen dabei ertrunken sind, ist noch unklar. Die rund 140 Geretteten sind nun hier in "Safi Barracks“ und "Lyster Barracks“ auf Malta untergebracht.
Konflikte zwischen Personal und Insassen
In einem riesigen Schlafsaal sprechen unzählige Stimmen durcheinander. Die Luft steht in dem stickigen Saal. Es riecht übel, überall sind Fliegen. Für 350 Leute stehen laut Angaben der Sicherheitskräfte "etwa acht bis zehn“ Toiletten zur Verfügung. Ein Stockbett reiht sich an das nächste. Die Matratzen sind zerschlissen, die weißen Laken schmutzig.
Rund 700 junge Afrikaner wohnen derzeit hier. Das Personal zählt nur 20 Leute. Im einen Schlafsaal sind die Somalier zusammengefasst, im Saal gegenüber die anderen Nationalitäten: Äthiopier, Eritreer, Nigerianer, Ghaner, Syrier. "Seit einem großen Kampf im Juli bringen wir die Somalier getrennt unter. Wir achten auch darauf, dass Sunniten und Schiiten nicht in Berührung kommen“, sagt der Offizier. Auf dem engen Raum komme es immer wieder zu ethnischen und religiösen Konflikten.
Auch zwischen dem Personal und den Insassen sind Spannungen spürbar. Ende September gab es einen Aufstand gegen das Personal. "Sie haben Steine aus der Wand genommen und nach uns geschmissen, auch mit Bechern gefüllt mit heißem Wasser.“ Wie es dazu gekommen ist? "Wenn sie einen negativen Asylbescheid erhalten, kann so etwas eben vorkommen“, wiegelt der Offizier ab.
Hinter dem hohen Maschenzaun im Hof steht eine Gruppe von neugierig blickenden jungen Männern. Der 18-jährige Mohammed Aabuudkar ist einer von ihnen. Der Somalier erzählt, warum er geflohen ist: "Die Leute sterben in Somalia jeden Tag. Manche meiner Freunde sind geflohen, meine Familie ist noch dort“, sagt er. Eigentlich wollte Aabuudkar nach Italien gelangen. "Aber unser Boot ist in Seenot geraten. Die maltesische Küstenwache hat uns an Land geholt.“ Er flüchtete aus Somalias Hauptstadt Mogadischu, gelangte über Kenia, den Sudan und Libyen nach Malta. Einige Monate hatte er in Libyen gearbeitet, um die nötigen 400 US-Dollar für die Überfahrt nach Europa zu sparen. "In Libyen hat man mir versprochen: In Europa ist das Leben gut. Aber jetzt bin ich wieder eingesperrt.“
Bis zu eineinhalb Jahre können auf Malta gestrandete Flüchtlinge im Internierungslager festgehalten werden. Laut dem Ministerium für nationale Sicherheit und interne Angelegenheiten beträgt die durchschnittliche Anhaltedauer sechs Monate. Dann kommen die Flüchtlinge in "offene Lager“ - wenn sie nicht abgeschoben werden.
Aabuudkar wartet nun auf seinen Asylbescheid. Welche Zukunft er sich erhofft? "Als erstes brauche ich Bildung. Wir bräuchten hier Englisch-Kurse und Computer-Kurse“, sagt er. Das EU-finanzierte Bildungs-Programm "Sparklet“ hat den Flüchtlingen im Lager Englisch-Kurse ermöglicht, ist aber 2012 ausgelaufen. Aabuudkar erzählt, dass er noch nie eine Schule besucht hat. Der junge Mann würde gerne Arzt werden. "Dann könnte ich den Menschen in den Lagern helfen, so wie Doktor Agarwal.“
Keine psychologische Betreuung
Der im Lager tätige Arzt Ravindra Agarwal beendet gerade ein Patientengespräch. Er schließt die Tür seines Zimmers, um ohne Beisein des Offiziers sprechen zu können. Bis zu 40 Patienten behandelt er täglich. Einen eigenen Psychologen gibt es nicht. "Die Menschen hier brauchen mehr als nur medizinische Hilfe. Ich versuche, auch auf ihre psychischen Probleme einzugehen“, sagt er. Viele Insassen klagen über den ständigen Lärm in der Halle und über Schlaflosigkeit. Andere vertragen das Essen nicht. "Stress-Symptome sind allgegenwärtig. Sie vermissen ihre Familie. Wenn sie am Telefon erfahren, dass ein Familienmitglied in der Heimat gestorben ist, werden viele depressiv“, berichtet der Mediziner.
Damit sich keine Epidemien ausbreiten, müssen die Leute genau untersucht werden. "Wir versuchen, Patienten mit ansteckenden Krankheiten zu isolieren, aber es kommt dennoch zu Ansteckungen, weil die Leute so eng zusammen leben“, sagt der Arzt. Die häufigsten Krankheiten sind Krätze, Windpocken, Hautentzündungen. Er checkt die Insassen auch auf Typhus und Tuberkulose hin, nicht aber auf das HIV-Virus.
Manche Frauen kommen mit gynäkologischen Verletzungen oder sind schwanger. "Dann bringen wir sie in die Klinik. Manche berichten, dass sie sexuell missbraucht wurden“, sagt Agarwal. Durch die lange Bootsfahrt haben viele Frauen schlimme Sonnenbrände. Die Männer kommen mit vielfachen Verletzungen und Knochenbrüchen an.
Auch unbegleitete Minderjährige sind hier untergebracht. "Sie sollten eigentlich nicht interniert werden. Leider haben wir in den offenen Lagern nicht genug Platz für sie“, berichtet der Arzt. "Deshalb bitten wir die EU um Hilfe. Wir würden den Flüchtlingen gerne bessere Bedingungen bieten, aber unser kleines Land ist dazu nicht in der Lage“, sagt er. Seit dem arabischen Frühling hat der Flüchtlingsstrom stark zugenommen. Ihm sei es sehr wichtig, dass sich die Flüchtlinge dennoch respektiert und geschätzt fühlen, betont Agarwal: "Wenn sie für mich Patientengespräche dolmetschen, biete ich ihnen immer einen Stuhl an sowie einen Cappuccino und Kekse.“
Vor dem Ärztezimmer wartet der 31-jährige Darlington Ubhimihye. Er ist schon seit sechs Monaten interniert und sichtlich demoralisiert. Der Nigerianer trägt eine Kette mit einem Kreuz. "Ich bete jeden Tag für Freiheit“, sagt er. "Jeder Tag ist gleich: Essen, schlafen, aufwachen. Wir gehen ein bisschen raus, dann wieder hinein. Wir brauchen Freiheit, bitte helft uns!“, ruft er. Der Offizier geht nun dazwischen, sein Ton wird plötzlich scharf. Die Besuchszeit in "Safi Barracks“ sei nun vorbei.
Im nahe gelegenen Gebäude "Lyster Barracks“ sind auf einer Etage Paare untergebracht, auf einer weiteren ausschließlich Frauen. Über 300 Menschen wohnen hier. Kinder gibt es hier keine. "Wenn Mütter mit Kindern oder Kinder alleine ankommen, versuchen wir sie gleich in die offenen Zentren zu bringen“, erklärt die Sprecherin des zuständigen Ministeriums, Ramona Attard.
Erste Rechtsberatung nach Monaten
Im Fernsehzimmer des Frauentrakts sitzt eine Frau mit orangem Kopftuch. Die 27-jährige Somalierin Nadifa Osman sieht älter aus als sie ist. Seit sieben Monaten lebt sie mit ihrem Ehemann hier. Das Paar ist nicht zum ersten Mal interniert. "In Libyen waren wir drei Monate eingesperrt, weil wir keine Papiere hatten. Wir konnten aber fliehen.“
Die Asylanträge der beiden wurden abgelehnt. Inzwischen konnten sie endlich mit einem Juristen sprechen und werden einen Antrag auf Bleiberecht stellen. Dann möchten sie in ein anderes EU-Land weiterziehen. Die Menschenrechts-Organisation "JRS“ (Jesuit Refugee Service) bietet Rechtsberatungen im Lager an. Diese erhalten die Flüchtlinge vielfach erst, nachdem der erste Asylbescheid gekommen ist.
Im Lager hat die junge Frau eine Fehlgeburt erlitten. "Meiner Mutter sage ich am Telefon, dass alles okay wäre. Die Wahrheit wäre zuviel für sie.“ Das Rote Kreuz verteilt alle zwei Monate eine Karte mit fünf Euro Guthaben für das Telefon. Dann ruft sie zu Hause an. "Die Gesprächszeit ist immer zu kurz.“
Neben dem Paar auf der Bank sitzt die 17-jährige Nigerianerin Blossom Ayuba. Sie hat sich alleine auf den Weg nach Europa gemacht. "Die Sicherheitskräfte sind rassistisch“, sagt Ayuba. "Sie geben uns kein Shampoo, kein Duschgel, das Essen ist nicht gut. Sie erlauben es nicht einmal, dass Leute von außerhalb uns Dinge vorbeibringen.“
Sie würde den Flüchtlingen in den Lagern gerne helfen, sagt wenige Stunden später eine ältere Malteserin, die am Kiosk des Touristenortes Sliema Zeitungen verkauft. "Ich würde ihnen gerne Sachen vorbeibringen: Kleidung, Essen, Produkte zur Körperpflege. Viele Malteser würden das gerne tun, aber wir dürfen ja nicht“, klagt sie. Sie würde sich gerne selbst ein Bild von den Lagern machen. Es würden schlimme Geschichten kursieren. "Wissen Sie: Die Behörden wollen weitere Flüchtlinge davor abschrecken, nach Malta zu kommen.“