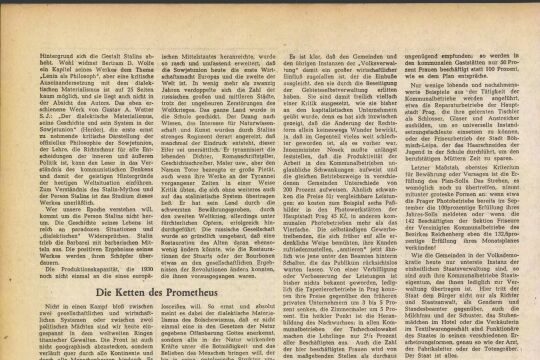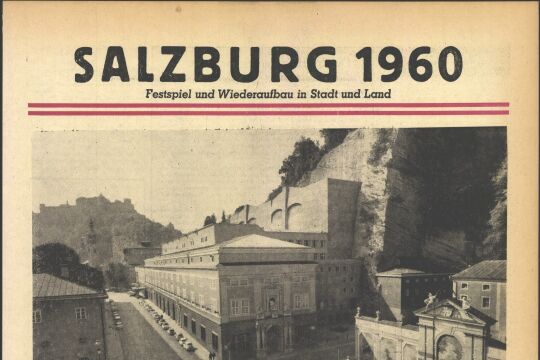Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Bürgermeister als Finanzmakler
Mit diesem kennzeichnenden Attribut vom Finanzmakler schmückte sich nicht etwa der Bürgermeister einer reichen Industriestadt, sondern das kommunale Oberhaupt einer kleinen Stadt, die ihre Haupteinnahmen aus Gewerbe- und Getränkesteuern erhält. Seine Gemeinde hat ein günstiges Flächenausmaß von nur 860 Hektar bei 2800 Einwohnern und eine Finanz- kraftkopfquote, die bei 700 Schilling liegt. Diese Finanzkraftkopfquote (sie wird errechnet, indem die Einnahmen einer Gemeinde durch deren Einwohnerzahl dividiert werden) ist der wichtigste Schlüssel sowohl für den Finanzausgleich als auch für die Bedarfszuweisungen, die von den Ländern an ihre Gemeinden gewährt werden. Finanzausgleich nennt man jenen „Topf“ des Bundes, in den hinein sämtliche Gemeinden bestimmte Steuern und Abgaben zu leisten haben und aus dem die Gemeinden dann je nach ihrer Kopfquotenfinanzkraft kleinere oder größere Anteile zurück- erhalten. AiJchcfür die Höhet ÄsstiJee darfszuweisungen von., selten . ¡.der Länder: ist diese Kopfquote ausschlaggebend, vorausgesetzt natürlich, daß die betreffende Gemeinde durch ihre kommunalen Vorhaben beziehungsweise Leistungen überhaupt Anspruch darauf hat.
Unsere oben erwähnte Gemeinde nun zählt mit der Finanzkraftkopfquote 700 zum kommunalen Mittelstand. Das heißt, der Finanzausgleich gibt ihr ungefähr so viel zurück, als sie einzahlt, während die kommunalen Notständler — Kopfquoten von nur 250 bis 300 Schilling sind keine Seltenheit! — von deij Wohlstandsgemeinden partizipieren. Um einen Vergleich zu nennen: Der reichste Gerichtsbezirk der Steiermark ist Graz, dessen Kopfquote bei 1560 Schilling liegt. Zu den reichsten Gemeinden Österreichs zählen aber auch kleine Gemeinden, wie zum Beispiel Kaprun in Salzburg oder Wattens in Tirol, das lange Zeit sogar als die reichste Gemeinde Österreichs galt.
So demokratisch dieser Finanzausgleich prinzipiell auch ist — der Ärmere braucht eben mehr Hilfe —, so unterschiedlich wird er von den Kommunalpolitikern beurteilt, wobei freilich die Regel die ist, daß jene, die daran profitieren, nichts dagegen einzuwenden haben, während umgekehrt die Bürgermeister reicher Gemeinden nicht selten kein gutes Haar daran lassen. Die demokratische Gesinnung, hier zeigt eich’s, bleibt gar zu oft leider noch Innerhalb der eigenen Gemeindegrenzen isoliert. Der mit der 700- Schilling-Quote urteilt neutral, gibt aber sofort zu bedenken, daß ein künftiger Finanzausgleich, sollte er den Gemeinden weniger geben, ganz und gar unmöglich sei. „An der Mineralölsteuer zum Beispiel müßte der Bund die Gemeinden mitpartizipieren lassen“, fügt er hinzu; und diese Meinung wird generell vertreten. Vor allem geht es hier um eine höhere Dotierung der Gemeindestraßen, für die der Bund keine Mittel aus der Mineralölsteuei bereitstellt. Heftig kritisiert wirc auch immer wieder die Umsatzsteuer von Bier und Milch (die bekanntlich aus der Getränkesteuei herausgenommen sind). Sie fließ' nach Ansicht der Gemeindeverant wortlichen viel zu dünn in den Gemeindesäckel zurück.
Der „finanzmakelnde“ Bürgermeister braucht eben Mittel, denn er will mehr leisten als nur die ihm gesetzlich auferlegten Pflichten (Aufschließung für den sozialen Wohnungsbau, Gemeindestraßen, Beleuchtung usw.), für die ihm ohnedies zu umfangreiche Mittel dotiert sind.
Die Sorgen von arm bis reich
„In einer Gemeinde herrscht immer der Notstand“, postuliert der Bürgermeister einer schon zu den Wohlständlern zählenden Gemeinde mit 950 Schilling Finanzkraftkopfquote. Dabei hat er eigentlich alles in seiner schmucken Stadt; vom modernen Sportstadion über das repräsentative Kulturhaus bis zum luxuriösen Kindergarten. Daß er nicht noch und noch Millionen verbauen könnte, wird ihm kaum jemand bezweifeln. Aber wie müßte erst jener Bürgermeister klagen, dessen Gemeinde flächenmäßig un- tepdljch groß,, jst,,; ogejen,. die Fjrianzkräft ausschließlich aus den Steuern- deg pitar ärmlichen Handwerker, der vier Wirtshäuser und der bäuerlichen Grundsteuer von rund 60 Gehöften resultiert und nur wenig über 200 Schilling liegt? Das Gemeindebudget reicht da nicht einmal für den Wegbau, mit dem allein 35 Kilometer zu betreuen sind, was mehr ist als das gesamte
Straßennetz einer mittleren Stadt! Die neue Volksschule — vor Jahren noch in einer stallähnlichen Keusche etabliert — ist buchstäblich ein Geschenk des Landeshauptmannes. Hier sind die dafür vorgesehenen Bedarfszuweisungen sowie die Förderungsmaßnahmen von Bund und Land einschließlich der Bevorzugung durch den Finanzausgleich das Existenzminimum. Irgendwo bleibt da noch immer eine Diskrepanz, wollen die mit der 1000- Schilling-Quote es auch mit umgekehrten Vorzeichen wahrnehmen!
Der Wohnungsbau wiederum blockiert den Städten, seien sie nun klein oder groß, zu viele Mittel. Die Gemeinde ist ja zum großen Lückenbüßer geworden, seit es keinen privaten Zinshausbau (auch ein Segen des Mieterschutzes) mehr gibt. „120 Wohnungen seit 1956“, triumphiert der Bürgermeister einer zweieinhalbtausend Einwohner zählenden Stadt, „damit übertreffen wir in der Relation selbst Großstädte. wie Graz oder Linz — aber sonst können wir uns dafür nichts leisten.“
Das Heft in der Hand
Inwieweit die einzelnen Gemeinden mit ihren Sorgen zu Rande kommen, hängt — und gerade das müßte die Öffentlichkeit, die mitunter ihrem eigenen Gemeinwohl so indolent gegenübersteht, wissen — zu einem gut Teil von der Gemeindevertretung ab; ganz besonders liegt es an der Geschicklichkeit des Bürgermeisters, was er sich an zusätzlichen Mitteln von Bund und Land erbettelt. Hier soll natürlich nicht verschwiegen werden, wie sehr hauptamtliche Bürgermeister, versiert mit allen Gesetzen und firm in allen Sätteln kommunalpolitischer Möglichkeiten, im Vorteil sind gegenüber jenen, denen für ihre Bürgermeistertätigkeit neben harter' Bauernarbeit bestenfalls ein paar Stunden am Tag verbleiben, während die GemeindeWrizl&f- ‘rtUr von einem7 Sekretär geführt wird? Der hauptamtliche fcBargeri t®' wiederum hat oft die Fäden besser in der Hand, als es manchem recht ist, ist er doch meist der einzige, der sich mit sämtlichen Schriftstücken, Eingaben, geplanten und zur Ausführung gelangenden kommunalen Vorhaben intensivst und bis ins kleinste Detail befaßt. Ohne Um schweife gestand mir in diesem Zusammenhang der Finanzreferent einer 15.000 Einwohner zählenden Stadt: „Genau genommen ist der Bürgermeister der einzige im Gemeinderat, der wirklich etwas unternehmen kann!“ Er ist es, weil er das Heft in der Hand und die Zeit dazu hat. Aber ist er es nicht auch, weil die anderen sich zuwenig mit der Materie beschäftigen? Immerhin, das ist auch eine echte Sorge reicher Großgemeinden.
Der scheele Blick des „Reichen“ auf den „Armen“ (weil dieser relativ mehr Fremdmittel erhält) oder umgekehrt (weil der sich in seiner Gemeinde mehr leisten kann): in beiden Fällen fehl am Platz! Denn die mit der niedrigen Finanzkraft könnten ohne Zuwendungen nur verwalten, aber nichts leisten, womit das Prinzip der Gleichheit arg verletzt würde. Schließlich soll die Kommunalpolitik allen Staatsbürgern annähernd gleiche Möglichkeiten gewähren. Die Landflucht, die Flucht aus den Notstandsbezirken haben ganz gewiß hier ebenfalls ursächliche Wurzeln. Anderseits müssen jene mit dem kleinen Budget und den bescheidenen Möglichkeiten bedenken, wie krisensicher sie selbst, wie unerhört empfindlich und anfällig hingegen etwa eine Industriestadt ist, deren Reichtum mit der wirtschaftlichen Tageslage steht und fällt. Konjunkturschwankungen, Stagnation, Rezession oder Krise können die Gemeindekassen sofort leeren. Wie heikel ist hier auf die Dauer erfolgreiche Kommunalpolitik! Man braucht dabei gar nicht erst das Unglücksgespenst der Arbeitslosigkeit mit ihren deprimierenden Erscheinungen in den Industriegemeinden heraufbeschwören. Aber auch die Industriegemeinaen, die sich, was den Finanzausgleich betrifft, den Fremdenverkehrszentren Westösterreichs gegenüber benachteiligt sehen, müßten wissen, um wieviel tiefer noch hier über Nacht das Barometer fallen kann. Man soll also die demokratischen Ansätze und Möglichkeiten unseres Gemeinwesens — und die sind ohne Zweifel vorhanden — weniger egozentrisch, dafür aus allen Perspektiven sehen.
Dadurch, daß zu umfangreiche Mittel des Gemeindebudgets bereits dotiert sind, sei die Gemeindeautonomie schon eingeschränkt, ist die Meinung des einen. Er will mit seiner Gemeinde wirtschaftlich unabhängig sein — ein Unternehmer also. Der andere steht auf dem Standpunkt, die Mittel müßten in voller Wirksamkeit dem Gemeindebürger zugute kommen. Er meint damit natürlich nur seine Gemeindebürger. Die notwendige Zustimmung der Landesregierung für den Verkauf von Gemeindegrund, die personalpolitische Abhängigkeit und anderes mehr — das sehen viele als krasse Beschneidung der Gemeindeautonomie. Auf dem österreichischen Gemeindetag 1963 wurde vor allem von den westlichen Bundesländern der Ruf nach der Steuerhoheit der Gemeinden laut, womit sicher die extremste Grenze erreicht wurde im Meinungsstreit um die Autonomie der Gemeinde. Denn wer um die Bedeutung der Umsatzsteuer weiß, dieser Säule der österreichischen Finanzwirtschaft, der wird auch die Gefahren klar vor Augen haben, die eine solche Hoheit, übertragen auf den kommunalen Bereich, zu gewärtigen hätte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!