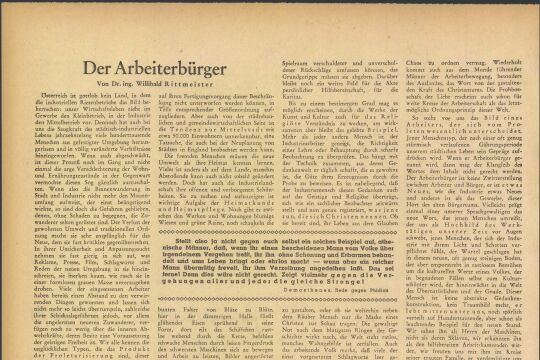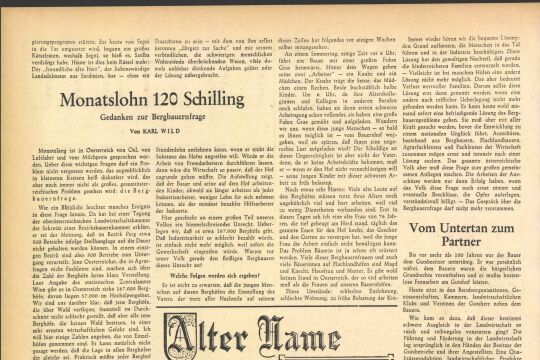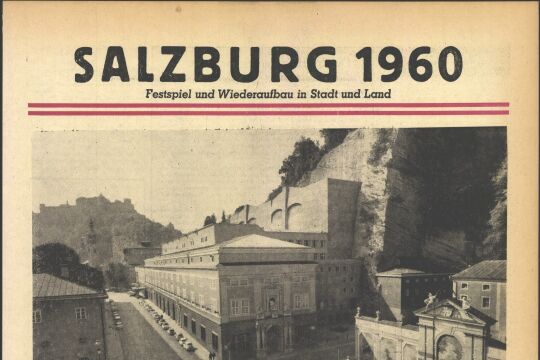Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Waldviertel kämpft man um das Überleben
Lebensfähige Gemeinden sind Voraussetzung für einen lebendigen Föderalismus. Im niederösterreichischen Waldviertel stimmen alle Voraussetzungen nicht: Man kämpft ums Überleben.
„Die Grenzlandbewohner", rief die Katholische Arbeitnehmerbewegung gemeinsam mit der von Kom-merzialrat Josef Umdasch geführten Vereinigung Christlicher Unternehmer der Diözese St. Pölten zu Jahresbeginn auf, „brauchen keine Almosen. Sie fordern nur jene Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die dem Gebiet das Uberleben sichern."
„In ein paar Jahren", orakelt Johann Kössner, „haben wir hier im Waldviertel ein einziges großes Altersheim!" Der Besitzer des Burgstü-berls in Heidenreichstein weiß, wovon er spricht. „Wer ein bisserl Grips hat, kann einfach nicht hier bleiben."
Hier: das ist jener Teil Niederösterreichs, den die meisten Österreicher nur als Umgebung des berühmt-berüchtigten Truppenübungsplatzes Allentsteig kennen. Eine Gegend, die sich - nach den Aussagen leidgeprüfter Grundwehrdiener - besonders durch ihr sibirisches Klima auszeichnet.
Die - durch noch wesentlich mehr Leid geprüften - Bauern kennen die Folgen: „Das einzige, was bei uns wirklich wächst, ist der Wald!" Und selbst der wird dem Namen der Umgebung nicht ganz gerecht. „In Kärnten etwa kann man rechnen, daß ein frisch aufgeforstetes Waldstück nach rund vierzig Jahren genutzt werden kann. Im Waldviertel dauert es aber an die achtzig Jahre, bis der Wald wieder geschlägert werden kann."
Als Alternative zur Forstwirtschaft bietet sich den Landwirten nur die extensive Viehwirtschaft an. Die aber kämpft mit den Absatzproblemen bei Milchprodukten. Die Investitionen des Heidenreichsteiner Landwirtes Johann Hetzendorfer, der sich wie viele Waldviertler auf Milchwirtschaft umgestellt hatte, betrug 500.000 Schilling. Möglicherweise waren aber der Bau von Stallungen und der Milchkammer eine Fehlinvestition: „Durch die Milchkontingentierung, die 1978 eingeführt wurde, wird Mehrproduktion bestraft."
Logische Folge: Der Landwirt sucht sich ein neues Betätigungsfeld. Kaum irgendwo paßt das Wort „suchen" so gut in den Zusammenhang
wie im Waldviertel. Denn wer seine Arbeitskraft zu Markte tragen muß, muß diesen Markt erst einmal finden.
„Bis vor kurzem hat es noch Betriebe gegeben, die nur 15 Schilling pro Stunde gezahlt haben", erzählt ein Bewohner von Thaya, einer kleinen Gemeinde nördlich von Waidhofen. „Das ist inzwischen etwas besser geworden." Aber auch das ist natürlich relativ: Denn das ist noch immer kein Anreiz, zu bleiben.
Da nimmt man noch lieber tägliche Fahrtstrecken von mehr als 60 Kilometern in Kauf. „Nebenbei" läuft dann noch die Landwirtschaft (oft genug nur von Frau und Kindern besorgt) mither, „sonst könnt' man ja gar net überleben". Was nach dem Kassensturz bleibt, ist herzlich wenig. Karl Göller, seit 25 Jahren bei den Bobin-Werken in Gmünd beschäftigt, bleiben etwa 6800 Schilling. Davon muß er allein 4490 Schilling für die Ausbildung seines Sohnes aufwenden, der in Korneuburg einen Datenverarbeitungsberuf erlernt. Veranschlagt er noch kostendeckende Beträge für Auto (die einzige Möglichkeit, zum Arbeitsplatz zu gelangen), Beheizung (im Waldviertler Klima liegen die Kosten dafür natürlich auch überdurchschnittlich hoch) und Lebensmittel, „dann bleibt mir, genau genommen, eigentlich nichts".
Auch das notwendige Kapital gibt es im Waldviertel viel zu wenig. Und es wird tendenziell auch immer weniger.
Die unternehmerische Investitionsfreude wird nicht nur durch verkehrstechnische und technologische Vorbedingungen geschmälert, sondern auch dadurch, daß jeder Arbeitsplatz ein Politikum ist. „Da kommt man dann furchtbar schnell in einen politischen Streit", berichtet Reinhard Bauer, Geschäftsführer einer Kunststofftechnikfirma mit Sitz in Waidhofen, über die Erfahrungen seiner Unternehmensgründung im September, „und ein Investitionsvorhaben kommt dann nur durch zähe Verhandlungen zum Erfolg." Wenn der Unternehmer die entsprechende Geduld aufbringt. Denn er steht ja selbst unter Zeitdruck: „Man sagt uns: ,Sucht's sofort um ERP-Kredite an, denn in einem Jahr geht alles für General Motors auf!' "
Noch ein zweiter Mechanismus der
öffentlichen Hilfe für die Wirtschaft muß im Waldviertel versagen: die öffentliche Investition. Denn der von Keynes gepredigten Forderung, die öffentliche Hand möge in Krisenzeiten verstärkt investieren, scheitert am Bundesfinanzausgleich.
Die Gemeinden haben nämlich viel zu wenig Geld, um es wirtschaften lassen zu können. Da selbst das Geld für elementarste Investitionen den Gemeinden fehlt, können diese auch keine „weiteren Subventionen vom Land bekommen. Es fehlt eben der Sauerteig", versucht der Bürgermeister von Waidhofen-Land den wirtschaftlichen Zusammenhang zu versinnbildlichen. Der Gemeinderat der 1096-Seelen-Gemeinde, die Franz Groß vorsteht, hat sogar eine Beschwerde und Klage beim Verfassungsgerichtshof in Auftrag gegeben, „weil wir glauben, daß die derzeitige Verteilung der Mittel aus dem Finanzausgleich gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Ein Einwohner einer größeren Gemeinde ist offenbar mehr wert als ein Einwohner einer kleineren."
Und die Abwanderung ist kaum zu stoppen. Bürgermeister Groß spürt es in der eigenen (bäuerlichen) Familie: „Von meinen Kindern müssen schon zwei nach Wien arbeiten gehen." Bedenklich an der Landflucht ist nicht zuletzt die Tatsache, daß vor allem die intelligenteren jungen Leute fortgehen. Denn wenn von 33 Schülern der Abschlußklasse einer Handelsakademie bisher nur einer Aussicht auf einen (geeigneten) Arbeitsplatz hat, dann ist abzusehen, daß seine Klassenkollegen bald nach Wien übersiedeln werden.
Daß eine umgekehrte Bewegung eine gewisse finanzielle Erleichterung bringen könnte, ist unbestritten. Nur: Wer fährt schon ausgerechnet ins Waldviertel, wenn dort nichts als gute Luft geboten wird? Von der allein kann kein Fremdenverkehrsbetrieb leben. Und für die notwendigen Modernisierungen („Wer verbringt heutzutage schon einen Urlaub in einem Zimmer ohne Bad?") fehlt - wie ortsüblich - das liebe Geld.
Aus alldem resultiert die Meinung, die der Pfarrer von Thaya, Florian Schweitzer, geschichtsbewußt formuliert: „Dieses Land, das vor 900 Jahren unter so vielen Mühen kultiviert wurde, wird praktisch aufgegeben." ,
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!