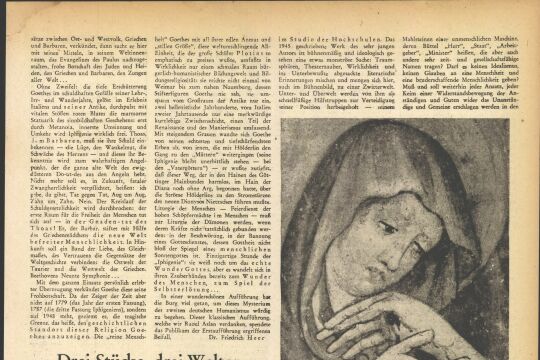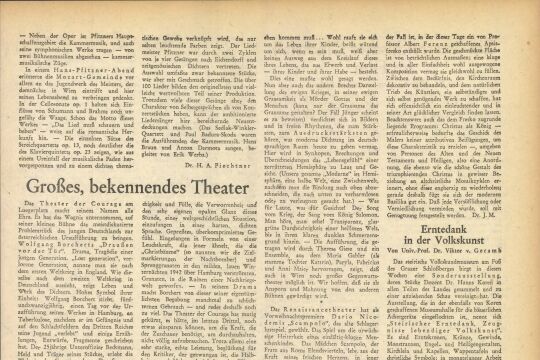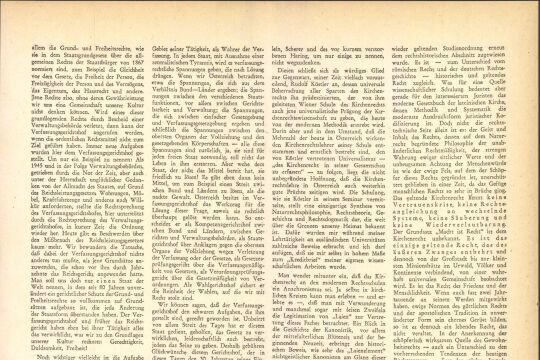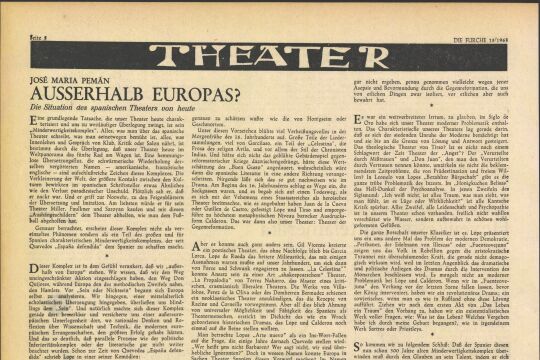Spuren von Aktualität bei Calderon
"Das Leben ein Traum": Sigismunds Läuterung zwecks Sammelns von Gutpunkten läßt an einen Politiker denken, der Kreide frißt.
"Das Leben ein Traum": Sigismunds Läuterung zwecks Sammelns von Gutpunkten läßt an einen Politiker denken, der Kreide frißt.
Calderon gibt im Wiener Theater in der Josefstadt Lebenszeichen, sein "Das Leben ein Traum" gibt Aktualitätsspuren preis. Wegen eines düsteren Horoskops, wonach sein Sohn Sigismund ein grausamer, böser Herrscher sein wird, hat ihn Polens König Basilius weggesperrt. Kaum zu glauben, daß sich ein so lieber, weiser, menschlicher König, wie Hermann Schmid ihn spielt, so verhalten konnte. Ganz traut er freilich doch nicht den Sternen, also testet er Sigismund, der sich der Prophezeiung entsprechend entsetzlich benimmt. Kein Wunder angesichts der angestauten Wut eines legalen Thronerben, der auf Befehl seines Vaters seit Jahren in Ketten liegt. Aber psychologische Charakterzeichnung war Calderons Sache ja nicht, und in diesem Stück schon gar nicht.
Die nächste Chance nützt Sigismund besser. Die Läuterung ist allerdings auf einen Floh zurückzuführen, den ihm der Kerkermeister Clotald ins Ohr gesetzt hat: Moralisches Verhalten im Traum werde dem Menschen besonders hoch angerechnet. Da er Sigismund eingeredet hat, den Test als Herrscher, bei dem er versagt hat, nur geträumt zu haben, hält dieser auch die Rebellen, die in sein Turmgelaß eindringen und ihn auf den Thron setzen wollen, für Traumgebilde. Diesmal wird er niemanden aus dem Fenster werfen und sich auch nicht liebestoll auf Rosaura stürzen, sondern Punkte sammeln und der Staatsraison folgend Estrella heiraten. Die innere Läuterung kommt dann natürlich dazu. Aber die Wut glaubt man Herbert Föttinger viel mehr als die Läuterung. Die Wut kommt aus dem Bauch. Die Läuterung ist brave Schauspielkunst.
Das Wohlverhalten kommt also nicht von innen, sondern der Prinz will damit seine Chancen verbessern: Darin ist schon ein Quentchen Zeitgemäßheit. Ein Publikum, das gelernt hat, aus seinen Klassikern in homöopathischen Dosen Aktualität zu saugen, stellt vielleicht auch die Parallele zwischen dem polnischen Prinzen Sigismund, den die Angst zur Läuterung veranlaßt, und einem heutigen Politiker her, der Kreide frißt, um keine Stimmen zu verlieren. Allerdings wohl ohne innere Läuterung.
Regisseur Janusz Kica hat das spanische Barockspektakel als Bearbeiter so abgeräumt, den Text gemeinsam mit Isabella Suppanz so auf seine statuarisch unterkühlte Inszenierung und dabei aufs Wesentliche zugespitzt, daß sich ein solcher Bezug, wenn er beabsichtigt war, leichter erschließt. Und er war wohl beabsichtigt, denn Polen haben für verborgene politische Bezüge ein feines Ohr. Einen besonders triftigen Grund, den zeitfernen und, wie sich zeigt, trotz aller Reduktion stark angestaubten Pedro Calderon de la Barca zum Saisonauftakt zu spielen, kann man allerdings trotzdem schwer erkennen. Eher schon Futter für alle, die von Aktualität im Theater generell die Nase voll haben. Und deren werden es immer mehr, woran freilich die Theater selber mitschuldig sind - so halbherzig, zögernd, inkonsequent und stets nur zum Schein mutig, wie sie aktuelle Stoffe heute anpacken.
Die Inszenierung wirkt aber immerhin wie ein Versuch, sich vom Regietheater abzusetzen. Ebenso wie Neoliberalismus ist auch Regietheater ein Begriff, der schwer zu definieren ist und trotzdem allseits richtig verstanden wird. Kica greift zu Stilmitteln, die noch in den sechziger Jahren gebräuchlich waren und in einem Theater, dem es um Inhalte geht und nicht um So-tun-als-ob, durchaus wieder zum Ausgangspunkt neuer Entwicklungen werden können. Die Bühne ist leer, der Hintergrund dunkel, der Mond ein hübscher Akzent, die unbarocke Konzentration auf das Geschehen, den Kern, gelingt weitgehend, etliche unmotivierte Gänge im Laufschritt wirken wie ein Gruß vom Regietheater. Die Kampfszenen sind wirklich Theater der sechziger Jahre, im negativen Sinn. Ein großer Lichtblick ist Ronald Kuste in der Rolle des Narren (oder eigentlich: Dieners) Clarin, er balanciert kunstvoll auf dem Grat zwischen Traurigkeit und Komik und ist obendrein ein guter Sprecher. Der Rest ist bewährtes, unauffälliges Handwerk.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!