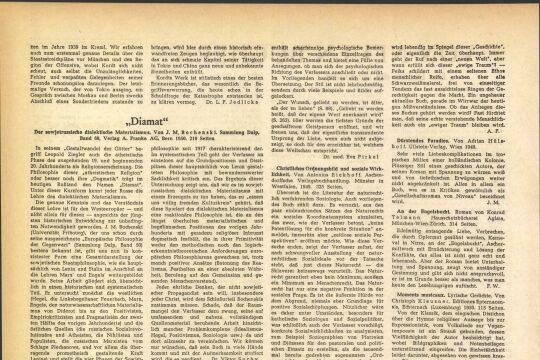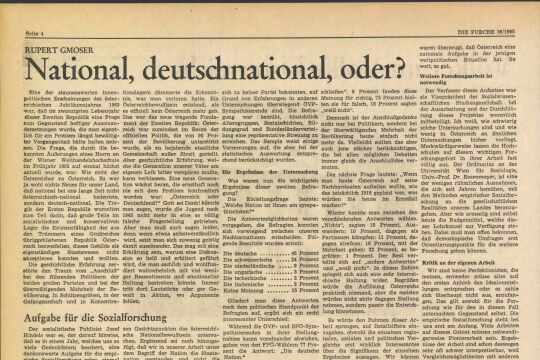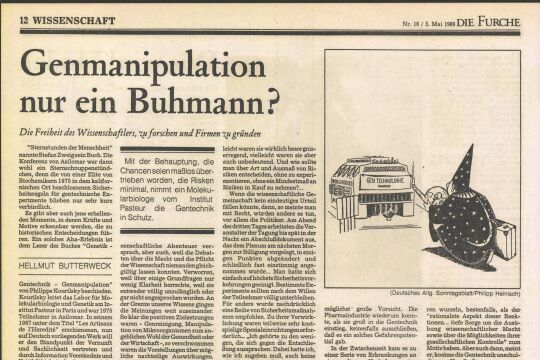Wie man Wissen zum Wachsen bringt
Ein veraltetes Publikationssystem in der Forschung kann für Staaten und Bürger gefährlich werden: höchste Zeit für eine Reform der Wissenschaftskommunikation. Die "Vienna Principles" bemühen sich erstmals um eine nachhaltige Vision.
Ein veraltetes Publikationssystem in der Forschung kann für Staaten und Bürger gefährlich werden: höchste Zeit für eine Reform der Wissenschaftskommunikation. Die "Vienna Principles" bemühen sich erstmals um eine nachhaltige Vision.
US-Vizepräsident Joe Biden hat es zum Grundprinzip seines ambitionierten Krebs-Forschungsprogrammes gemacht. Für EU-Forschungskommissar Carlos Moedas ist es eines von drei Top-Zielen seiner Amtszeit. Die Rede ist von Open Science, zu deutsch "Offene Wissenschaft". Open Science bedeutet, Forschungsergebnisse im Internet frei zur Verfügung zu stellen und offen zu dokumentieren, wie diese erzielt wurden. Was vor über 20 Jahren mit dem Ruf einiger Wissenschaftler nach dem freien Zugang zu Forschungsartikeln begann, hat sich zur größten Reformbewegung in der Wissenschaft überhaupt entwickelt.
Doch warum ist Wissenschaftskommunikation eigentlich reformbedürftig? Um dies zu verstehen, ist ein Blick auf die Defizite des derzeitigen Systems notwendig. Und kaum ein Fall illustriert diese Defizite so gut wie jener, der unter dem Kürzel "Reinhart-Rogoff" in die Forschungsgeschichte eingegangen ist.
Das Beispiel Griechenland
In der Finanzkrise wurde in Schieflage geratenen Staaten wie Griechenland ein strikter Sparkurs vorgeschrieben -als Voraussetzung für die Finanzhilfe der europäischen und internationalen Gemeinschaft. Bei der Begründung für die harte Sparpolitik stützten sich die Spitzen der internationalen Politik auf den Harvard-Professor Kenneth Rogoff. Dieser vertritt die These, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen einer hohen Staatsverschuldung und niedrigem Wirtschaftswachstum gibt. In einer Schuldenkrise sei es daher notwendig, die Staatsausgaben zu senken, um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen.
Im Jahr 2010 untermauerte Rogoff diese These in einem Artikel namens "Growth in a Time of Debt". Mit seiner Kollegin Carmen Reinhart analysierte er die Wirtschaftsdaten von Industrie- und Schwellenländern. Das Ergebnis: Bei einer Staatsverschuldung von über 90 Prozent geht das Wirtschaftswachstum dramatisch zurück. Das durchschnittliche Wachstum dieser Staaten lag nur noch bei -0,1 Prozent. Von da an galten die 90 Prozent als wichtige Schranke, die es unbedingt zu vermeiden galt, um den ohnehin stotternden Konjunkturmotor nicht vollständig zum Erliegen zu bringen.
Der Haken daran: Die Ergebnisse der Studie stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aufgedeckt wurde dies von einem Doktorratsstudenten namens Thomas Herndon. Herndon scheiterte daran, die Ergebnisse von Reinhart und Rogoff nachzuvollziehen. Auf Nachfrage bekam er die verwendeten Daten mit den genauen Berechnungen zugeschickt. Herndon und seine Professoren, die mittlerweile auf den Fall aufmerksam geworden waren, fanden darin einige grobe Fehler. Nach deren Bereinigung lag das durchschnittliche Wachstum bei einer Staatsverschuldung von 90 Prozent nicht mehr bei -0,1 Prozent, sondern bei 2,2 Prozent - also nur noch wenig schwächer als bei niedrigeren Niveaus der Staatsverschuldung. Die magische Grenze von 90 Prozent war entzaubert. Diese Erkenntnisse wurden erst drei Jahre nach "Growth in a Time of Debt" veröffentlicht. 2013 hatten die griechischen Regierungen bereits fünf Sparpakete verabschiedet, mit teils massiven Einschnitten bei den Pensionen sowie im Sozial- und Gesundheitsbereich.
Wie im Fall von Reinhart und Rogoff wird in den meisten Studien nicht genügend Information über die Analyse der Daten veröffentlicht. Ganz zu schweigen von den Daten selbst, welche im Großteil der Disziplinen nicht zugänglich sind. Dies hat wiederum einen negativen Einfluss auf die Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Für die Überprüfung eines Forschungsergebnisses müssen eigene Daten erhoben und die Berechnungsschritte mühsam rekonstruiert werden: zuviel Aufwand in den meisten Fällen. Unbeabsichtigte Fehler in der Berechnung oder gar Datenmanipulationen werden meist erst im Nachhinein aufgedeckt. Dann nämlich, wenn Zweifel an der Richtigkeit eines Ergebnisses aufkommen.
Die "Krise der Reproduzierbarkeit"
In der Wissenschaft spricht man mittlerweile von der "Replication Crisis" - dem Umstand, dass selbst wichtige Forschungsergebnisse nicht immer reproduziert werden können. In einer großangelegten Studie in der Psychologie konnten weniger als 40 Prozent der Originalstudien bestätigt werden. Ebenso problematisch ist, dass Ergebnisse oft nur gegen Bezahlung zugänglich sind. Dabei sprechen wir nicht von Verkaufspreisen von Publikumszeitschriften. Der Artikel von Reinhart und Rogoff, erschienen im American Economic Review, umfasst sechs Seiten und kann online für 19,50 Dollar erworben werden - Zugriff gibt es dann aber nur für 24 Stunden. Jahresabonnements von Zeitschriften sind meist so teuer, dass sie nur von Universitäten und Forschungsinstitutionen bezogen werden. Dies führt zur paradoxen Situation, dass die Mehrheit der Forschung zwar vom Steuerzahler bezahlt wird, die Ergebnisse für diesen aber nicht zugänglich sind. Zudem ist aufgrund mangelnder Kostentransparenz nicht klar, wie viel Geld die öffentliche Hand in Österreich für das Abonnement-Modell ausgibt.
Open Science tritt nun an, diese Defizite zu beheben, mit verstärktem Rückenwind aus der EU. In der niederländischen Ratspräsidentschaft wurde erst kürzlich der "Amsterdam Call for Action" veröffentlicht, der einen raschen Umstieg auf Open Science fordert. So etwa wird der freie Zugang zu allen wissenschaftlichen Artikeln bis 2020 gefordert. Viele der Forderungen wurden im Europäischen Rat auch von den anderen Mitgliedsstaaten abgesegnet. Österreich ist hier zuletzt zu einem Vorreiter geworden. Breite Zusammenschlüsse wie das "Open Access Network Austria"(OANA) sowie aktive zivilgesellschaftliche Bewegungen wie "Open Knowledge Austria" sind weit über die Grenzen des Landes bekannt.
Allen Akteuren ist gemein, dass sie das bisherige System von Wissenschaftskommunikation durch verstärkte Offenheit verändern möchten. Doch das beantwortet noch nicht, wie das System in Zukunft aussehen soll. Offenheit als alleiniges Leitprinzip genügt zudem nicht. Vielmehr ist Offenheit ein Mittel zum Zweck, von dem man sich verspricht, andere Prinzipien zu erreichen: bessere Zugänglichkeit oder einfachere Reproduzierbarkeit. Kurz gesagt: Es fehlt an einer gemeinsamen Vision.
Rendezvous mit der Realität
Ein erster Vorschlag, wie die Wissenschaftskommunikation des 21. Jahrhunderts aussehen könnte, kommt nun aus Österreich. Die "Vienna Principles" aus der Schmiede des OANA umfassen zwölf Prinzipien und beschreiben die Eckpfeiler eines offenen Systems: Neben Zugänglichkeit und Reproduzierbarkeit werden u. a. die bessere Auffindbarkeit wissenschaftlicher Materialien, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sowie Qualitätssicherung und transparente Kontext-Informationen genannt.
Die "Vienna Principles" haben heute bereits weltweit Beachtung gefunden. Sie wurden in den sozialen Medien hundertfach geteilt und mehrfach teilübersetzt. Darüber hinaus hat eine breite Diskussion eingesetzt: Auf der Webseite http://viennaprinciples.org kann das Papier eingesehen und kommentiert werden. Der nächste Schritt muss nun sein, die Vision mit der Realität zu konfrontieren. Dies bedeutet, klare Empfehlungen auszusprechen, wie die Prinzipien im Forschungsalltag umgesetzt werden können. Damit, wie es im letzten Prinzip beschrieben wird, wissenschaftliches Wissen eines Tages tatsächlich ein öffentliches Gut wird - und von allen Mitgliedern der Gesellschaft aktiv genutzt werden kann.
Der Autor ist Forscher am Know-Center in Graz und Mitglied im Open Access Network Austria (OANA)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!