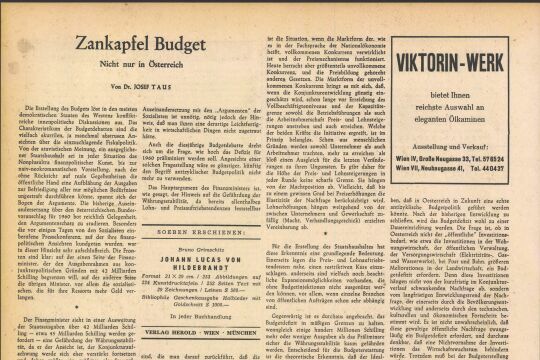Nicht nur deswegen, weil ihm sein Durst schon wieder teurer zu stehen kommt, ist in diesen sommerlichen Tagen der österreichische Normalverbraucher vergrämt. Er zahlt ohnehin seit dem Mai dieses Jahres für jedes Krügel Bier zusätzlich zehn Groschen Steuer, um dadurch den Milchpreis zu stützen. Dies ist letztlich einzusehen, denn Milch ist noch immer wichtiger als Bier. Nun kamen aber kürzlich die Brauereien und meinten, nicht nur den Bauern, Molkereien und Milchhänd-Jern ginge es schlecht, sondern auch ihnen. Sie fänden trotz steigenden Ausstoßes und zunehmenden Verbrauchs — bald an die 80 Liter jährlich pro Kopf in Österreich, Säuglinge inbegriffen — mit ihren bisherigen Preisen kein Auslangen. Zwar brauchten eigentlich nur die kleinen Brauereien höhere Einnahmen, aber auch die Großen des soliden Braukartells nahmen die von der Paritätischen Kommission zugestandene Erhöhung ihres Abgabepreises um mehr als 20 Schilling pro Hektoliter gern in Kauf. Durch eine etwas eigenwillige Interpretation der paritätischen Vereinbarung errechneten sich die Brauereien sogar einen höheren Flaschenbierpreis als vorgesehen.
Die traurige Geschichte vom Bierpreis, hier vor allem wegen ihres symptomatischen Charakters erzählt, und die erstaunliche sommerliche Aktivität des Ministerrates in Angelegenheit des Brotpreises haben die Österreicher aus ihrer saisoneilen Gelassenheit geweckt. Der höhere Brotpreis ist so gut wie ausgemacht. Es geht nur noch darum, ob der Kilolaib um 50, 60 oder mehr Groschen teurer werden soll. Mühlen und Bäckereien drängen schon seit langem auf eine Erhöhung ihrer Spannen, unter anderem mit dem Hinweis auf bereits stattgefundene oder bevorstehende Lohnerhöhungen.
Die Erhöhung des Brotpreises findet in der Bevölkerung stärkere Resonanz als die gleichen Operationen bei Bier, Zucker oder Käse. Man sagt zwar, der Schwarzbrotkonsum gehe zurück, daher könne der höhere Preis umso leichter verkraftet werden. Nun wird aber Schwarzbrot gerade in den cinkommensschwächeren Schichten noch immer mehr gegessen als bei den „Reichen“. Daher geht das teurere Brot in erster Linie zu Lasten der „Armen“.
Aber auch jene, die überhaupt kein Brot essen — falls es solche gibt —, werden sich fragen, welcher Preis noch überhaupt hält, wenn selbst der vom Brot wackelt. Es hat jedenfalls den Anschein, als ob die Periode der relativen Stabilisierung offiziell abgeschlossen wird. Es fällt in diesem Zusammenhang auf, daß zu den Preissteigerungen der ersten Hälfte des Jahres 1963 — von Zucker über Milch bis Brot und Mehl usw. — die auffallend rührige Gewerkschaft der Lebensmittelarbeiter nicht wenig beigetragen hat. Anscheinend ist das während der Präsidentschaft Johann Böhms hochgehaltene Prinzip der solidarischen Lohnpolitik dem stillen Vergessen anheimgefallen.
Auf wessen Konto gehen die Preissteigerungen? Auf das der profitgierigen Unternehmer, der forderungsfreudigen Arbeitnehmer, der Wirtschaftspolitik des Staates oder gar der Konsumenten selbst, die zwar protestieren, schließlich aber doch teurer kaufen? Die Käufer scheiden als Verantwortliche jedenfalls aus, soweit es sich um lebenswichtige, nicht substituierbare Lebensmittel wie Brot und Milch handelt. Bei Bier und Zucker haben sich die Produzenten über die Kostendeckung hinaus mit dem höheren Preis auch eine ansehnliche Gewinnmarge eingewirtschaftet. Den Mühlen und Bäckereien gestand vor kurzem sogar der ÖGB in seinem offiziellen Organ die Berechtigung einer Preiskorrektur zu. Er kritisierte allerdings, daß diese Nachziehung zu lange verschleppt worden sei und nun die labile Situation noch zusätzlich verschärfe.
Die Bundesregierung hat nun wirklich vieles anstehen lassen. Die offenen Preisfragen scheinen jetzt leichter regelbar. Vielleicht auch nur deswegen, weil nicht mehr der „rote“ Innenminister, sondern der „schwarze“ Landwirtschaftsminister die zweifelhafte Kompetenz hat, die Erhöhung bei preisgeiregelten Lebensmitteln vorzuschlagen. Diese formale Verantwortlichkeit des Landwirtschaftsministers für wichtige Preise bietet jedenfalls einen idealen Ansatzpunkt, um im Bewußtsein der Öffentlichkeit den Zuwachs der Volkspartei bei den letzten Nationalratswahlen mit den unpopulären Preissteigerungen zu assoziieren.
Die bereits vollzogenen oder noch bevorstehenden Preissteigerungen verschärfen die Virulenz der schleichenden Inflation. Diese wird von den meisten linken Nationalökonomen und auch von der Mehrheit der sozialistischen Politiker als unabdingbares Opfer für Vollbeschäftigung im Kapitalismus angesehen. In Wirklichkeit dürfte hier weniger der Kapitalismus ausschlaggebend sein, als das in einem demokratisch organisierten Staat unvermeidbare Ringen der verschiedenen Interessengruppen um einen möglichst großen Anteil am Volkseinkommen. Eine Objektivierung dieses Verteilungsprozesses, seine Ausrichtung an Gemeinwohlprinzipien ist1 zwar theoretisch denkbar, in der Praxis jedoch kaum zu erreichen.
Das spezifische Merkmal der heutigen Situation liegt darin, daß die spektakulären Preisveränderungen überwiegend den amtlich regulierten Sektor betreffen. Diese politischen Preise tendieren erfahrungsgemäß dazu, gerade in den Perioden der konjunkturellen Abschwächung erhöht zu werden. Und in einer solchen Periode, wenn auch in relativ milder Ausprägung, befindet sich zur Zeit die österreichische Wirtschaft.
Bei der Diskussion über die bereits vollzogenen oder noch schwebenden Preiserhöhungen hört man von Seiten der fordernden Interessengruppen immer häufiger, die ihnen zugute kommende Preissteigerung erhöhe den
Verbraucherpreisindex ohnehin nur um 0,1, 0,2 oder noch weniger Punkte. Dieses tsolie'te Indexargument ist nur auf den ersten Blick eindrucksvoll, nämlich wenn man vergißt, daß sich eine ganze Reihe von 0,1 usw. addieren. Darüber hinaus kann ein Verbraucherpreisindex niemals die Entwicklung der Lebenshaltungskosten in jedem einzelnen Haushalt anzeigen.
Man könnte sich nun in Österreich mit dem Gedanken trösten, auch in anderen Ländern gäbe es eine „dosierte Inflation“, sogar die Schweiz sei von ihr nicht verschont geblieben. Einige Politiker scheinen bei diesem Gedanken wieder ihr Selbstbewußtsein gefunden zu haben, da ihre hauptsächliche Sorge darauf gerichtet ist, zusätzliche Anforderungen an das Staatsbudget zu stellen. Selbst die Tatsache, daß die Erhöhung des durchschnittlichen Preisniveaus im Laufe des Jahres 1962 etwa 4,5 Prozent betragen hat und von Jänner bis Juni 1963 trotz der im Vergleich zum Vorjahr niedrigen Gemüse- und Obstpreise weitere drei Prozent erreichte, gleichzeitig sich auch das Wirtschaftswachstum merklich verlangsamte, hat bisher keine zielführenden Aktionen der Bundesregierung auslösen können.
Die absolute Geldwertstabilität ist, zumindest nach den bisherigen Erfahrungen, in einer pluralistischen Demokratie leider nur ein schöner Traum. Die Ökonomen haben sich bereits mit einer relativen Stabilität abgefunden und sind zufrieden, wenn bei Vollbeschäftigung das Preisniveau jährlich um nicht mehr als ein bis zwei Prozent steigt. Österreich war in den fünfziger Jahren diesem Optimum ziemlich nahe. Das „magische Dreieck“ von Geldwertstabilität, Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum kann also nur mit gewissen Schönheitsfehlern aus den Lehrbüchern und Parteiprogrammen in die Wirklichkeit transponiert werden. Auch rigorose Planwirtschaft und Sozialisierung bieten hier keine Alternative.
Die entscheidende Position für eine rationale Gestaltung unserer Wirtschaftspolitik liegt bei der Bundesregierung, im weiteren Sinn bei den beiden großen Noch-Koalitionspart-nern. Hierbei kommt es in erster Linie auf das Budget 1964 und die wirtschaftspolitische Gesetzgebung an. Die jüngst beschlossenen Kapitalmarktgesetze sind allerdings gerade so ausgefallen, wie sie nicht hätten sein sollen.
Es wäre nun vermessen, im Falle eines inflationsfördernden Verhaltens des Staates der Nationalbank die Aufgabe zu stellen, korrigierend einzugreifen. Die Nationalbank ist im Effekt nur der verlängerte Arm des Staates. Sie wird in der Regel jede Menge Geld zur Verfügung stellen müssen, die ihr Regierung und Parlament abverlangen. Auch wenn dadurch eindeutig der Prozeß der Geldverdünnung beschleunigt wird.
Das Budget des kommenden Jahres sollte ein möglichst kleines Defizit haben. Die konjunkturelle Lage dürfte sich, nachdem die Prognosen für heuer erfreulicherweise düsterer waren als die Wirklichkeit, einigermaßen konsolidieren. Soweit sich eine Erhöhung der öffentlichen Nachfrage, vor allem nach Investitionsgütern, als notwendig erweist, sollte dies gezielt und nicht global durch eine Erhöhung des gesamten Budgetvolumens erfolgen. Auf jeden Fall wäre es absolut verfehlt, in nächster Zeit an eine Budgetentlastung durch den Abbau der Subventionen für Milch, Brot usw. zu Lasten der Verbraucherpreise zu denken. Abgesehen von dem keineswegs eindeutigen Charakter der Preisstützungen, die im Interesse der Konsumenten wie auch der Bauern liegen und daher nicht nur auf Kosten einer Seite abgebaut werden können, hätte ihre Verringerung einen weiteren empfindlichen Preisauftrieb zur Folge. Dies würde aber alle Stabilisierungsversuche und -appelle zur Farce werden lassen.
Es wird bereits seit Jahren von Konzepten für die Wirtschaftspolitik, von ihrer Koordinierung und Objektivierung gesprochen. Über das Reden ist man bis heute noch nicht weit hinausgekommen. Die Gewerkschaften haben bereits vor längerer Zeit angeregt, die Paritätische Kommission zu einem Koordinierungsinstrument auszubauen. Neuerdings wurde von ihnen die Einführung der „Planificatjon“ nach französischem Muster vorgeschlagen. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat voläufig in beiden Fällen negativ reagiert, weil ihrer Ansicht nach die Pläne des ÖGB im Widerspruch zur Marktwirtschaft stünden. Auch bei der Volkspartei zeigt man sich in diesem Zusammenhang vorläufig zurückhaltend, da — nicht zu Unrecht — auf dem Umweg über die wirtschaftspolitischen Exponenten des ÖGB eine kalte Kompetenzbeschneidung der von ihr besetzten Wirtschaftsressorts befürchtet wird.
Eine weitere Verstärkung der gewerkschaftlichen Mitbestimmung auf wirtschaftlichem Gebiet ist jedoch unerläßlich, weil die Gewerkschaftsführung nur dann bei ihren Mitgliedern genug Autorität besitzt, um zuweilen auch bremsend zu wirken. Dies ist erfahrungsgemäß auch dann nicht leicht, wenn, wie in der jüngsten Vergangenheit, die Realeinkommen trotz der Preissteigerungen zunehmen. Höhere Preise werden nun einmal nachhaltiger erlebt als Lohnverbesserungen.
Dasselbe Ausmaß an Disziplin und Verständnis für die labile währungspolitische Situation wie von den Arbeitnehmern muß man auch von der Unternehmerseite verlangen. Ihre Wettbewerbsfreudigkeit beschränkt sich in vielen Fällen auf formale Bekenntnisse zur Marktwirtschaft. Es ist zum Beispiel auf die Dauer unhaltbar, überlebte Strukturen und nicht mehr wettbewerbsfähige Betriebsgrößen mit Hilfe von Kartellen oder Absprachen ähnlicher Wirkung konservieren zu wollen. Ein wesentliches und für den Konsumenten unmittelbar wirksames Element der Preisstabilisierung wäre eine Senkung der vor allem bei dauerhaften Konsumgütern außerordentlich hohen Handelsspanne. Die Liberalisierung und selbst die gezielten Zollsenkungen haben hier keine fühlbare Abhilfe geschaffen.
Konjunktur und Inflation sind weithin durch unser Verhalten bestimmt. Die Lösung der vordringlichen Probleme — Geldentwertung bei gleichzeitigem geringem Wirtschaftswachstum, leere Staatskassen — setzt Disziplin auf Seiten aller Sozialpartner, Verzicht auf ohnehin nur kurzfristige Einkommensvorteile und Sparsamkeit im Staatshaushalt voraus. Als gelernter Österreicher darf man seine Erwartungen in die wirtschaftspolitische Einsicht der verschiedenen „Pressuregroups“ leider nicht allzu hoch ansetzen. Sicherlich hält unsere Wirtschaft das „Fortwursteln“ noch einige Zeit aus, ohne daß die wirtschaftliche Lebensfähigkeit unseres Landes in Frage gestellt wird. Man müßte jedoch bereits jetzt alles daransetzen, um diese Frage niemals wieder möglich werden zu lassen.