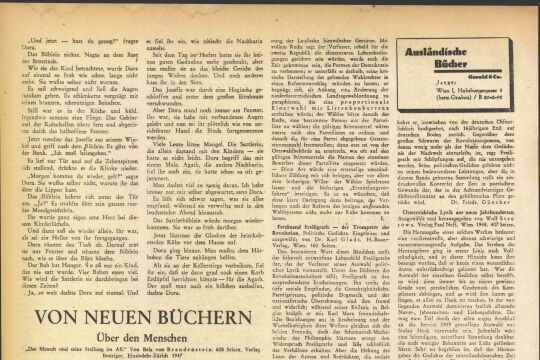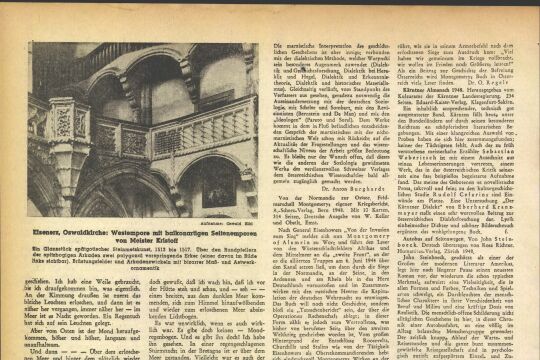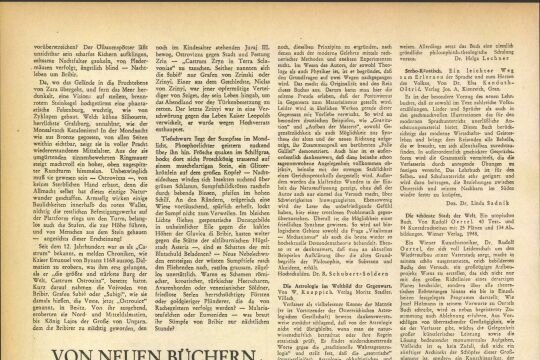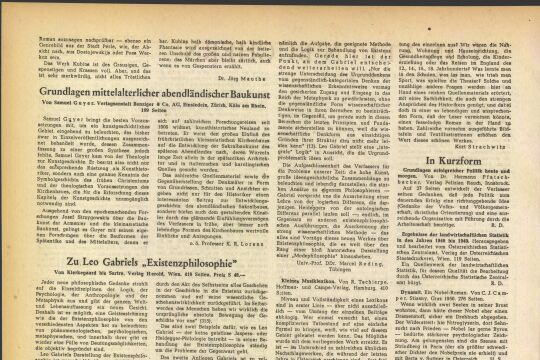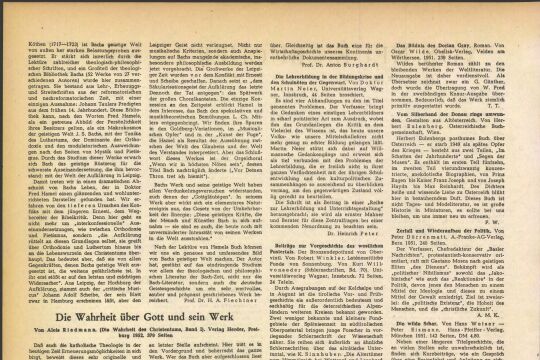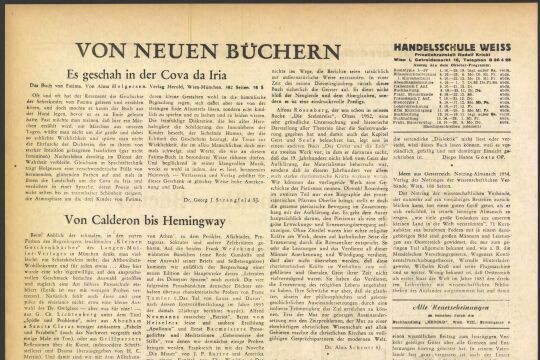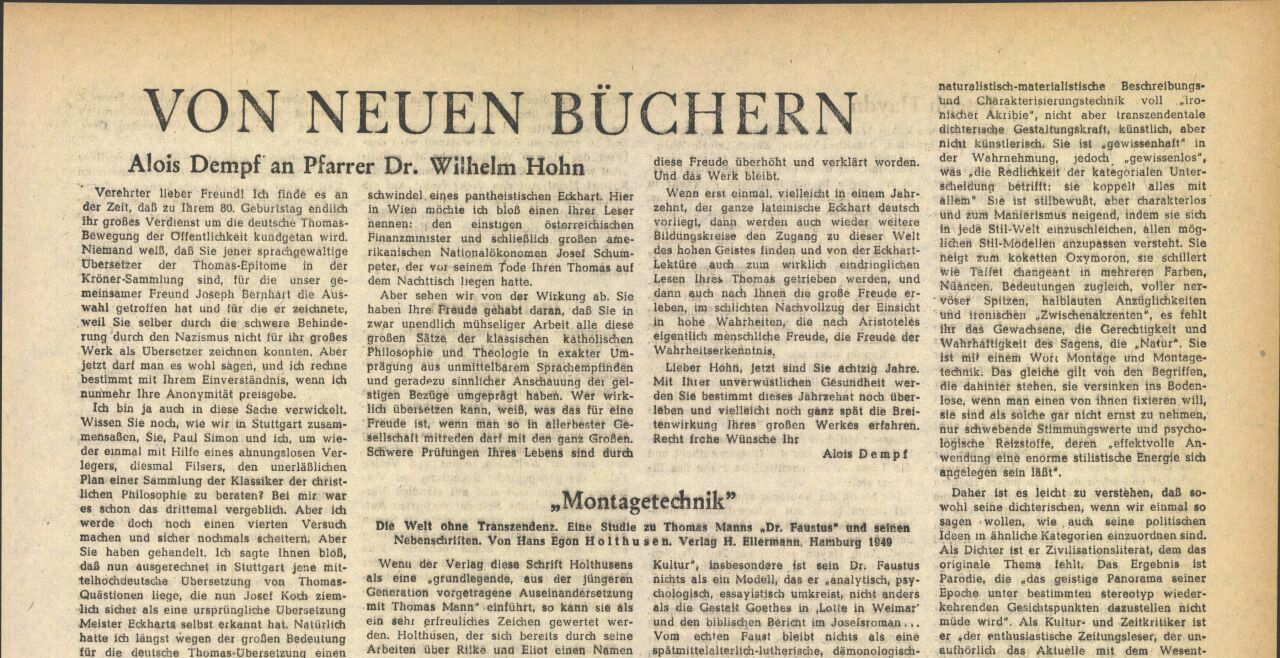
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Montagetechnik“
Die Welt ohne Transzendenz. Eine Studie zu Thomas Manns „Dr. Faustus“ und seinen Nebenschrliten. Von Hans Egon Holthusen. Verlag H. Eilermann, Hamburg 1949
Die Welt ohne Transzendenz. Eine Studie zu Thomas Manns „Dr. Faustus“ und seinen Nebenschrliten. Von Hans Egon Holthusen. Verlag H. Eilermann, Hamburg 1949
Wenn der Verlag diese Schrift Holthusens als eine „grundlegende, aus der jüngeren Generation vorgetragene Auseinandersetzung mit Thomas Mann“ einführt, so kann sie als ein seht erfreuliches Zeichen gewertet werden. Holthusen, der sich bereits durch seine Arbeiten über Rilke und Eliot einen Namen gemacht hat, charakterisiert sofort zu Beginn auf das treffendste Thomas Manns Arbeit und Geist: Wo das Genie in das Wasser der Wahrheit greift, da ballt sich eine Kugel zusammen wie in der reinen Hand der Hindufrau in Goethes Pana-Trilogie, da entsteht eine schöpferische „Idee“, wie Goethes „Ur-pflanze“, Schillers „Freiheit“ und Leibnizens „Monade“ solche Ideen sind. Bei Thomas Mann jedoch ist es ein „Apercu“, ein „Bonmot“, eine „geistreiche“ Assoziation, um alles psychologisch zu nivellieren und dann ironisch oder emphatisch alles mit allem zu verbinden, in Atmosphäre oder, wie Thomas Mann selbst sagt, in „Atmosphärilien“ aufzulösen und damit eine Welt der Obertlächen-und Scheinprobleme ohne echten Wahrheitsbegriff, ohne „Ja, ja und nein, nein“, das heißt in seinen letzten Konsequenzen eben ohne Transzendenz autzubauen. So ist sein Werk alles andere als ein Kunstwerk, höchstens eine virtuose Montage von „Modellen und Versatzstücken aus Wirklichkeit und
Kultur“, insbesondere ist sein Dr. Faustus nichts als ein Modell, das er „analytisch, psychologisch, essayistisch umkreist, nicht anders al3 die Gestelt Goethes in ,Lotte in Weimar' und den biblischen Bericht im Josefsroman... Vom echten Faust bleibt nichts als eine spätmittelalterlich-lut.herische, dämonologisoh-neurotische Atmosphäre“. Und was ist daran deutsch? Holthusen drückt das so aus: von Dürers „Ritter, Tod und Teufel“ wird alles übernommen, nur der Ritter nicht. Und schließlich werden auch Tod und Teufel entkräftet, säkularisiert zum weltlichen Phänomen, ganz zum psychologisch-physiologischen Komplex, Mit Albert Guerard läßt sich dann nur noch hinzufügen, daß Thomas Mann nicht der Ankläger, sondern selbst ein Exponent eines gewissen deutschen Geistes ist.
Was Holthusens Arbeiten auszeichnet, ist die ebenso feinfühlige wie tiefschürfende Sprache und Sprachuntersuchung. So geht er auch der „Delikatesse“ MannScher Sprach-gestaltüng nach. Sie ist im Letzten ebenso eine „Welt ohne Transzendenz“ wie der Inhalt, den sie bringt. Damit fehlt ihr aber gerade das, was eine Sprache zur Dichtung macht. Sie ist „zivilisiert“, aber nicht „groß“, sie ist suggestiv, aber ohne Zauberkraft, sie ist genau im Sinne des stereoskopischen Nahblicks, entbehrt aber der Imagination, sie ist naturalistisch-materialistische BeschreibungsUnd Charakterisierungstechnik voll „iro-nischer Akribie“, nicht aber transzendentale dichterische Gestaltungskraft, künstlich, aber nicht künstlerisch. Sie ist „gewissenhaft“ in der Wahrnehmung, jedoch „gewissenlos“, was „die Redlichkeit der kategorialen Unterscheidung betrifft: Sie koppelt alles mit allem“ Sie ist stilbewußt, aber charakterlos und zum Manierismus neigend, indem sie sich in jede Stil-Welt einzuschleichen, allen möglichen Stil-Modellen anzupassen versteht. Sie neigt zum koketten Oxymoron, sie schillert wie Taifet diangeant in mehreren Farben, Nuancen. Bedeutungen zugleich, voller nervöser Spitzen, halblauten Anzüglichkeiten und ironischen „Zwischeaakzenten“, es fehlt ihr das Gewachsene, die Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit des Sagens, die „Natur“. Sie ist mit einem Wort Montage und Montagetechnik. Das gleiche gilt von den Begriffen, die dahinter stehen, sie versinken ins Bodenlose, wenn man einen von ihnen fixieren will, sie sind als solche gar nicht ernst zu nehmen, nur schwebende Stimmungswerte und psychologische Reizstoffe, deren „effektvolle Anwendung eine enorme stilistische Energie sich angelegen sein läßt“.
Daher ist es leicht zu verstehen, daß sowohl seine dichterischen, wenn wir einmal so sagen wollen, wie auch seine politischen Idaen in ähnliche Kategorien einzuordnen sind. Als Dichter ist er Zivilisationsliterat, dem das originale Thema fehlt. Das Ergebnis ist Parodie, die „das geistige Panorama seiner Epoche unter bestimmten stereotyp wiederkehrenden Gesichtspunkten dazustellen nicht müde wird“. Als Kultur- und Zeitkritiker ist er „der enthusiastische Zeitungsleser, der un-aufhörlidi das Aktuelle mit dem Wesentlichen verwediselt“, der mit seiner „humanitären Gesellschaftsutopie“ (Ernst Jünger) Griechenland und Moskau, Sokrates und Stalin zu verbinden sucht, da ja, wie Thomas Mann sagt, „meines Wissens der Bolschewismus niemals Kunstwerke zerstört hat“.
Holthusen, dessen Buch als Revision zu begrüßen ist, führt dann noch das treffende Wort Kierkegaards von der „Sünde des Dichters, zu dichten statt zu sein“ an, das die „ästhetische Sünde“ des Schriftstellers wie politischen Konferenzredners Thomas Mann charakterisiert, nämlich mit „dichterischen Mitteln polltische Wirkungen anstreben zu wollen“ und umgekehrt, nie aber „Sein und Wirklidikeit“ künstlerisch wahr zu deuten und zu schaffen.
Musiksoziologie. Von Kurt Blaukopf. Verlag Willy Verkauf, Wien 1951.
Die Musikgesdtichte steht nicht im luftleeren Räume, sie ist eingestandener- oder uneingestandenermaßen stets von gesellschaftlichen und geistigen Bedingungen abhängig. So stellt die in ihren Anfängen stehende „Musiksoziologie“ ein überaus wichtiges, weil die musikalischen Erscheinungen in die großen Zusammenhänge eingliederndes Kapitel der Musikwissenschaften dar. Kurt B 1 a u k o p f hat, von Max Webers Entwurf „Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik“ ausgehend und unter besonderer Anzielung der soziologischen Verflochtenheit der Tonsysteme, einen wesentlichen und wertvollen Beitrag geleistet, der die Gesamtentwicklung der Tonsysteme, wie Insbesondere audi die Logik der Gegenwartskonstellation mit der Atonalität und dem Übergange zum Zwölftonsystem in wissenschaftlicher Systematik durchleuchtet. Die historischen Tonsysteme sind auch nach seinen Ergebnissen (siehe etwa auch die von Hermann Pfrogner) „gesetzt“, aber: „Die Annäherung der historischen Tonsysteme an das unendlidie System der reinen Stimmung (eben der naturgegebenen) scheint das .innere' Gesetz des musikalischen Fortschritts zu sein, das sldi konkret manifestiert in der historischen Verringerung der Reinheitsbreite und der ständig steigenden Anzahl der zunehmend genauer abgebildeten Intervalle der Obertonreihe.“ (S. 102.) Je höher wir In der Obertonreihe steigen — und dies ist eben der geschichtliche Entwicklungsprozeß —, desto dissonanter werden die Intervalle. So ist der Prozeß zum gegenwärtigen Zustand gelangt. „Atonalität bedeutet aber nicht etwa ein Verleugnen jeder Art von Gesetzmäßigkeit, sondern bloß die Verneinung einer b e-stimmten Tonalität, im modernen Falle der diatonischen.“ (S. 108.) Das Ringen der Gegenwartstheorie bedeutet demnach eine Bewältigungskrise an der Schwelle zu einem neuen Tonsystem. Wenn bei Blaukopf, entsprechend seiner Weltanschauung, „das ökonomische Prinzip“ der letzte Grund ist, der die ganzen Entwidclungen bestimmt, so betönt er doch mJt wissenschaftlichem Feingefühl, daß dieses nicht plump und unmittelbar wirkt, sondern sich zwischen jenes und die Musikbilder der Epochen die Fülle psychologischer und anderer Faktoren legt. Daher sieht der Autor eine besondere Aufgabe der Musiksoziologie unter anderem in der Klärung dieser „Widersprüche“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!