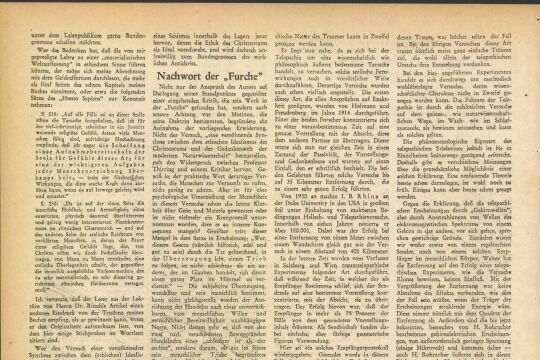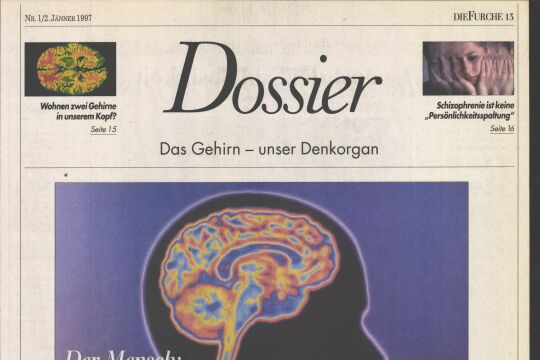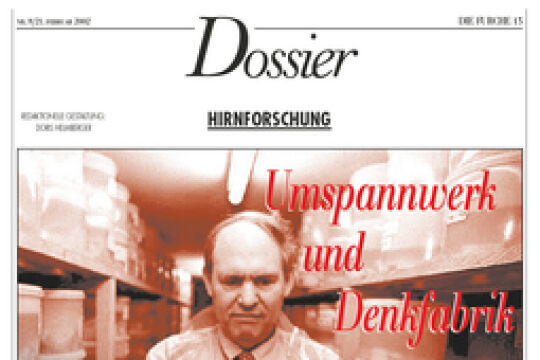Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Enten schnattern im neuen Innenohr
Udo Tschimmel, deutscher Wissenschaftsjournalist, schrieb ein Buch über moderne Operationstechniken. In diesem Beitrag schildert er eine österreichische Innovation.
Udo Tschimmel, deutscher Wissenschaftsjournalist, schrieb ein Buch über moderne Operationstechniken. In diesem Beitrag schildert er eine österreichische Innovation.
Von Kalifornien bis Australien arbeitet ein halbes Dutzend Forscherteams daran, die Technik des elektronischen Innenohrs so zu verfeinern, daß seine Träger auf Anhieb Sätze verstehen und Geräusche identifizieren können — ohne das lange und nervenzehrende Training, das derzeit noch vonnöten ist. Aus Innsbruck kommt die neueste Nachricht: Dort ist es Erwin Hochmair und Ingeborg Hochmair-Desoyer gelungen, ein System zu entwickeln, das in einigen Jahren ein ausgezeichnetes Sprachverständnis garantieren soll.
„Für die Ertaubten ist das erste Einschalten des Geräts ein ungeheuer emotionaler Augenblick“, erzählt Ingeborg Hochmair-Desoyer. „Amerikanische Patienten brechen immer in Tränen aus, die Österreicher und die Deutschen sind da meistens etwas zurückhaltender.“
Auf den Tischen stehen Computer und Bildschirme, liegen halbfertige Schaltungen und elektronische Bauteile. Während sich seine Frau mehr um die Patienten kümmert, ist Erwin Hochmairs Hätschelkind die Technik.
In Wien, 1976, arbeiteten sie mit Kurt Burian zusammen, der sich ander Universitätsklinik der Behandlung von tauben Patienten widmete. Burian war 1973 nach Los Angeles zum Erfinder der Innenohrprothese, William House, geflogen. Zurück in Wien, faßte er mit seinem Team den Plan, ein solches Gerät in einer veränderten und erheblich verbesserten Version selbst herzustellen. Doch das Projekt zog sich unerwartet in die Länge: Wenn die Forscher glauben sollten, was in den Lehrbüchern über den Aufbau des natürlichen Innenohres stand, hätten die Tests mit den Hörsystemen besser ausfallen müssen.
Angestoßen von den Luftwellen, schwingt das Trommelfell. An seiner Innenseite leiten die Knöchelchen des Mittelohres diese, feinen Bewegungen weiter bis zum Felsenbein, dem härtesten Knochen im menschlichen Körper. Dort beginnt der eigentliche Hörvorgang. Im Felsenbein arbeitet die Schnecke, Cochlea. Mit sieben Millimeter Durchmesser und ihrer spiraligen, nach oben auf gekuppelten Form ähnelt sie tatsächlich einem kleinen Schnek-kenhaus. In ihrem Innern winden sich, einer Wendeltreppe ähnlich, drei übereinanderliegende Gänge.
Wenn das Mittelohr Vibrationen überträgt, beginnen die Flüssigkeiten, mit denen die Gänge der Cochlea gefüllt sind, mitzuschwingen. Wie Meereswellen einen Rasen aus Seegras hin und her biegen, bewegen die Flüssigkeitsschwingungen feinste Härchen auf dem Boden eines der Gänge. Diese Haarzellen wandeln die mechanischen Schwingungen in elektrische Signale um und sind so die wichtigste Voraussetzung für das Gehirn, Schallwellen auswerten zu können.
Die 30.000 Haarzellen der Cochlea sind direkt mit dem Hörnerv verbunden; er leitet die Impulse, die ein elektrisches Abbild des Geräuschs darstellen, direkt in das Hörzentrum des Gehirns.
„Erstaunlich ist, daß schon fünf Prozent intakte Nervenfasern ausreichen, um wieder das Wahrnehmen von Geräuschen zu ermöglichen“, sagt Erwin Hochmair.
Das künstliche Ohr funktioniert nur deshalb, weil sich das Gehirn täuschen läßt. Forscher wie William House vermuteten, daß man die elektrischen Signale der Haarzellen imitieren müßte. Auf genau diesem Prinzip basieren denn auch die modernen Cochlea-Prothesen. Am Gürtel trägt der Patient ein walkman-großes Kästchen: den Sprachprozessor. Dessen Mikrofon fängt die Geräusche der Umgebung auf und wandelt sie in elektrische Signale um und leitet sie per Funk an das implantierte künstliche Innenohr weiter.
Einige Patienten empfinden Sprache und Töne als blechern, andere meinen zuerst, eine Schar Enten schnattere einher oder Müllcontainer schepperten beim Ausleeren. Erst durch ein langwieriges, konzentriertes Hörtraining unter der Anleitung von Spezialisten gelingt es den meisten Patienten allmählich, die ungewohnten Geräusche zu identifizieren.
In Wien glaubten Kurt Burian und das Ehepaar Hochmair-Desoyer, die Resultate des House-Implantats verbessern zu können. Trotz der aufwendigen Technologie waren die Ergebnisse nicht ermutigend. Offensichtlich reichte es nicht aus, die unterschiedlichen Tonhöhen nur über unterschiedliche Reizorte zu erzeugen. Vielleicht, überlegten die Hochmairs, sollte man das zweite Prinzip imitieren, nach dem das Ohr Geräusche umwandelt: die Periodizität. Sie ist die zeitliche Struktur eines Geräuschs, die Abfolge der einzelnen Impulse, die einen Ton ausmachen. Man könnte, so vermutete das Forscherehepaar, diese Impulsfolge nachahmen und den Hörnerv damit an einer einzigen Stelle stimulieren.
1978 wagten die Hochmairs den ersten Versuch: Der 22jährigen Conny wurde das erste Modell der Einkanalprothese implantiert. Nach dem Einschalten des Sprachprozessors sagte die Therapeutin - die sich hinter Conny gestellt hatte, um ein Lippenablesen zu verhindern — ein einsilbiges Wort: „Haus“. Conny reagierte augenblicklich: „Ich kann es verstehen: Haus.“
„Da sind wir endgültig auf dieses Prinzip der analogen Stimulation umgestiegen“, berichtet Ingeborg Hochmair-Desoyer. Diesem System sind die Forscher bis heute treu geblieben. Ihre Coch-lea-Prothese, deren neuestes Modell über 200.000 Schilling kostet, wird in vielen Ländern verwendet. Die Elektrode wird meistens außen an der Cochlea befestigt (extracochlear). Zwar mindert diese Implantationstechnik die Hörqualität, doch werden eventuell verbliebene Gehörreste dadurch nicht zerstört.
Für viele Patienten ohne Gehörreste kann gegenwärtig die Entscheidung für ein intracoch-leares System durchaus die richtige sein — mit der Ausnahme von Kindern. Auch wenn Ärzte wie William House auf die Innenelektrode schwören, darf Kindern nicht die Möglichkeit einer natürlichen oder medizinisch-technischen Besserung der Taubheit zerstört werden. Für sie kommt in dep meisten Fällen nur ein System in Frage, das eine extracoch-leare Elektrodenbefestigung erlaubt.
Gehörlose Kleinkinder, meint Ingeborg Hochmair-Desoyer, sollten möglichst vor ihrem zweiten Geburtstag mit einem Kunstohr ausgerüstet werden. Danach ist es meist zu spät, um vollständig sprechen, hören und verstehen zu lernen. So haben denn auch diejenigen Cochlea-Patien-ten die höchsten Erfolgsquoten, die erst nach dem Erlernen der Sprache ertaubt sind.
Das langwierige Training beginnt kurz nach der Implantation. Dann wird der Sprachprozessor auf die persönlichen Bedürfnisse programmiert. Langsam spielt ein Computer die Tonleiter vor; auf einem Bildschirm erscheinen die Töne als Kurve. Nachdem der Techniker den Sprachprozessor auf eine angenehme Gesamtlautstärke eingestellt hat, zeigt der Patient auf diejenigen Töne, die ihm zu laut oder zu leise erscheinen. Sind alle auf dasselbe Niveau eingeregelt, wird der Lautstärketest mit Zahlen und Vokalen wiederholt.
Bereits am nächsten Tag spielt eine Logopädin dem Patienten ein Tonband mit einzelnen Geräuschen vor. Nach und nach wird Hintergrundlärm unterlegt, dann folgen Sprachübungen. Manch ein älterer Patient kommt der Verzweiflung nahe, wenn seine '“Konzentration nachlaßt üTidThe Geräusche zu einem bedrohlichen Chaos verschmelzen. Doch bereits nach wenigen Wochen können Patienten einzelne Wörter versteheri und sich sogar unterhalten, wenn sie ihrem Gesprächspartner ab und zu auf die Lippen schauen. Die Erfolge der modernen Cochlea-Prothesen, die in Wien, Innsbruck, Mainz, Frankfurt, Düren und Hannover implantiert werden, sind erstaunlich. Nach der Rehabilitation können die meisten Patienten problemlos an einem Gespräch teilnehmen, wenn sie das Thema kennen. Nach weiterer Übung versteht etwa die Hälfte unbekannte Sätze auf Anhieb, vielen gelingt es sogar, in Verbindung mit Lippenablesen' alles richtig aufzunehmen.
Ob diese Hilfe erwünscht ist, muß jeder Gehörlose selbst entscheiden. Viele taube oder ertaubte Menschen haben sich nämlich zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschlossen, in denen ganz spezielle Kommunikationsregeln gelten. Freundschaften werden fast nur noch mit Menschen geschlossen, die selbst gehörlos und mit diesen Regeln vertraut sind. Ein elektronisches Ohr zu bekommen heißt, den Rückhalt und die Sicherheit der Gemeinschaft aufzugeben und sich in eine unbekannte, fremdartige Welt hinauszuwagen.
Gekürzt aus: Udo Tschimmel, „Wunder aus dem Operationssaal“. Econ-Verlag, Düsseldorf 1987. 248 Seiten, Ln., öS 310,-.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!