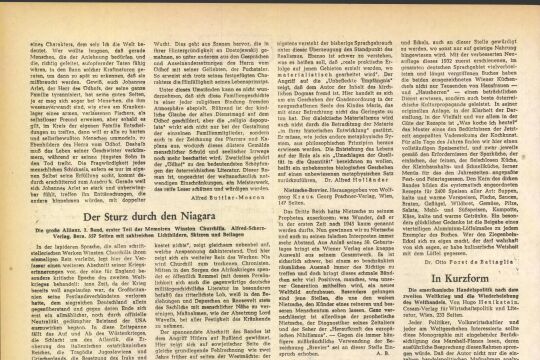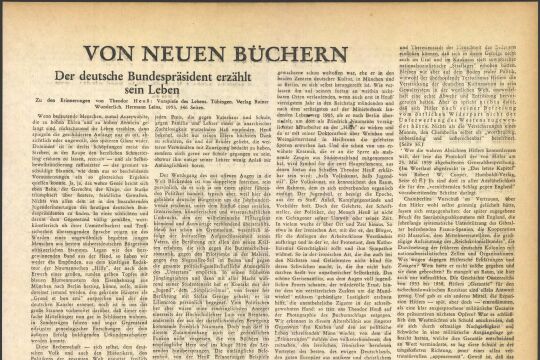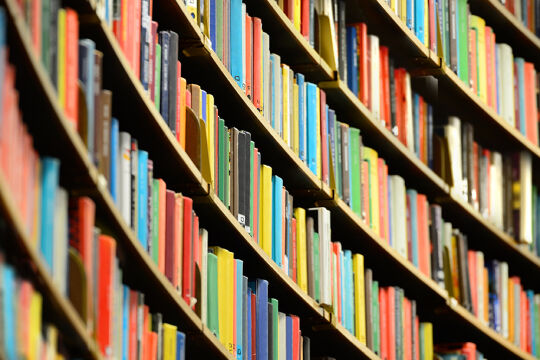Über den Umgang mit Klassikern: Nicht mediale Verordnung, sondern Bewusstseinsbildung und Reflexion halten das tradierte literarische Erbe lebendig.
Mitte der neunziger Jahre war am Wiener Institut für Philosophie eines Tages ein offener Brief mit etwa folgendem Inhalt zu lesen: Der Vorschlag, der kürzlich in einer Sitzung der Studienvertretung diskutiert worden sei, eine Liste mit jenen philosophischen Werken zu erstellen, deren Kenntnis eine Orientierungshilfe durchs Studium bieten könne, sei abgelehnt. Einen verbindlichen Kanon könne es ohnehin nicht geben, und eine derartige Zusammenstellung bewirke bereits eine Beeinflussung der freien Wahl der Lektüre. Darüber hinaus wäre es ja möglich, dass die Professorenschaft auf die Idee verfalle, den unverbindlichen Charakter der Liste zu ignorieren und die Kenntnis der angeführten Werke bei Prüfungen zu verlangen.
Ein geisteswissenschaftliches Studium am Ende des 20. Jahrhunderts erteilte also die Lektion, dass es eine Utopie sei, innerhalb der Scientific community nach einer Verständigung schaffenden Gemeinsamkeit der Lektüre suchen zu wollen. Eine geistige Orientierung an einem tradierten Kanon, erfuhr man, sei einengend, elitär, anderes und andere ausschließend und nach willkürlichen und unüberprüften Kriterien ausgewählt. Die verschworene Gemeinschaft, die sich durch das Parieren hingeworfener "Faust"-Zitate mit "König Ottokar" zu erkennen gibt, habe sich überlebt und durch ihre Dünkelhaftigkeit diskreditiert.
Gefördert wurde dieses Klima auch von selbstgerechten Lehrenden jener Generation, die zwar ihrerseits über das Selbstverständnis einer klassischen Bildung aus dem bürgerlichen Elternhaus oder dem humanistischen Gymnasium verfügten, jedoch ihrer Aufgabe, der nächsten Generation "Allgemeinbildung" im Überblick angedeihen zu lassen, nicht nur nicht nach kamen, sondern sogar mit Skepsis gegenüber standen: vor der Gefahr der Verschulung und der Oberflächlichkeit wurde von jenen Vertretern der Wissenschaft gewarnt, die Spezialisierung und Konzentration auf ein eingegrenztes Gebiet einforderten, zugleich aber mit Empörung von Studenten sprachen, die nicht wussten, was die Pappenheimer mit Schiller und dem Dreißigjährigen Krieg zu tun haben. Zurecht hat Ernst Gombrich in seinem Buch "Die Krise der Kulturgeschichte" vor dieser versteckten und heuchlerischen Überheblichkeit gewarnt, mit der im Zeitalter der Massenuniversität zwar alle sozialen Schichten zur Bildung aufgefordert, zugleich ihnen aber die Hilfsmittel auf dem Weg der Akademisierung vorenthalten werden.
Mit stürmischer Entrüstung protestierte die Studentenbewegung von 1968 gegen den Berliner Vortrag ihres selbst gewählten geistigen Ziehvaters Adorno, "Iphigenie und dem Klassizismus", erschien ihnen doch die in ihren Augen verstaubte Thematik angesichts der brisanten gesellschafts-politischen Lage höchst unangemessen. Die Angriffe auf den überlieferten Lektürekanon durch die nachkommende Generation, der man die akademische Initiation verweigert hat, werden von Argumenten gestützt, die jedoch nicht erst die 68er-Bewegung erfunden hat. Sie haben eine Tradition, die ihrerseits weit über das 20. Jahrhundert hinausreicht.
Bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieb Iwan Turgenjew in seinem Roman "Väter und Söhne" einen Konflikt der Generationen, in dem die "neuen Menschen" die humanistisch-idealistischen Werte der "überflüssigen Menschen" verachteten, zum Beispiel die Lektüre von Puschkin, an deren Stelle sie nach dem gesellschaftlichen Nützlichkeitsprinzip gewählten sozial- und naturwissenschaftlichen Lesestoff setzten. Ihre Attacken richteten sich gegen die Generation der Väter, in deren Gewahrsam das Bildungsgut unbemerkt zur Leerformel erstarrt war, aber weiterhin mit dem Gestus des snobistisch-ästhetisierenden Bildungsdünkels gehortet wurde - ein Protagonist dieser eitlen Hohlheit ist die Figur des Stepan Trofimowitsch Werchowenskij aus Dostojewskijs "Dämonen".
Vielerlei hat sich dann im 20. Jahrhundert zusammengebraut, um dem seit der Aufklärung unangefochtenen Konsens über die kulturelle Notwendigkeit eines Bildungskanons den Todesstoß zu versetzen. Nach der Bücherverbrennung durch die Nazis, die einen neuen Kanon auf rassischen Grundlagen zu schaffen suchten, gelang es nicht mehr, glaubwürdig an die bis dahin gültigen Werte des idealistisch-harmonisierenden bürgerlichen Weltbildes anzuknüpfen, das im Dritten Reich versagt hatte. Darüber hinaus schuf das Zeitalter der Massengesellschaft neue Verbindlichkeiten: es verschwanden die Unterschiede zwischen Hoch- und Subkultur, letztere ist seit den Cultural Studies auch mit dem wissenschaftlichen Gütesiegel ausgestattet. Der sogenannte Kanon wurde um den "Herrn der Ringe" und "Harry Potter" erweitert und durch die mediale Kultur in eine neue Gemeinsamkeit der Kennerschaft eingebettet, und über das Mitspracherecht im zeitgenössischen intellektuellen Diskurs entscheidet inzwischen nicht mehr die Kenntnis der Klassiker, sondern die regelmäßige Lektüre des Feuilletons.
Klassiker-Leitfaden
Umso erstaunlicher ist es, dass das 21. Jahrhundert mit dem Ruf nach dem Kanon antritt. Eingeläutet hat es 1999 der ehemalige Hamburger Anglistik-Professor Dietrich Schwanitz mit seinem Lexikon-Bestseller "Bildung. Alles, was man wissen muss". Diesem Verkaufserfolg reicht nun Christiane Zschirnt in der gleichen Reihe ein neues Lexikon hinterher: kompakt verpackt auf dreihundert Seiten bahnt sie mit "Bücher. Alles, was man lesen muss" eine Schneise durch die Flut der literarischen Standards der vergangenen zwei Jahrtausende. Auf die Diskussion der Kanonfrage im Spiegel, in der Marcel Reich-Ranicki als Ratgeber und Gewährsmann für die Sinnhaftigkeit eines Klassiker-Leitfadens durch den Dschungel der Informationsflut auftritt, antwortet das Profil mit der im Internet abrufbaren Klassiker-Bestenliste, empfohlen von "Literaturkennern" und ergänzt durch die Ergebnisse einer "Publikumswahl". Und die Kurstadt Baden widmet dem Thema "Warum Klassiker - und warum immer noch?" eine ganze Veranstaltungsreihe. Plötzlich suggeriert eine breite Öffentlichkeit den Bedarf eines Kanons oder wenigstens dessen Diskussion.
Misstrauisch macht vor allem die Art der Rezeption, die den Eindruck erweckt, als ob es Bildung in der Verpackung gäbe, nach basisdemokratischem Mehrheitsentscheid eruiert, abrufbar auf der Bestenliste von Hochglanzmagazinen und erfassbar in lexikalischen Werken. Die besondere Beachtung, die Schwanitz' Kapitel "Was man nicht wissen sollte" in Rezensionen geschenkt wurde, deutet darauf hin, dass die Gesetze der Ökonomie und der Effizienz, die im krassen Widerspruch zu geistiger Freiheit stehen, konsequent befolgt werden. Was dabei ins Hintertreffen gerät: Wesen und Wert von Bildung liegen nun einmal in erster Linie in ihrem Selbstzweck.
Um den Wert dieses veruntreuten Schatzes plausibel zu machen, genügt es jedoch nicht, ein Handbuch zum literarischen Weltkulturerbe neben dem Handbuch zur Blumenpflege auf den Ladentisch zu legen. Es bedarf vielmehr erst der Bewusstseinsbildung, um zu begreifen, was den Klassiker über ein dekoratives Museumsstück erhebt, warum die passiv-rezeptive Teilnahme an den im Feuilleton geführten Diskussionen nicht die eigenständige Auseinandersetzung mit dem tradierten literarischen Erbe ersetzt, und welche Bereicherung diese Auseinandersetzung in sich birgt.
Im Kontakt mit Menschen aus den ehemaligen kommunistischen Ländern Osteuropas erstaunt immer wieder deren umfassende Bildung. In der Tradition der Samisdat-Literatur aus der Ära des Sowjet-Regimes hatte die Vertrautheit mit dem literarischen Klassiker-Kanon ein besondere politische Funktion: Shakespeare-Zitate dienten als Code und übermittelten Botschaften, die nur die dissidentische Intelligenzija entschlüsseln konnte, und sie schufen eine Art Geheimsprache, deren Bedeutung der "ungebildeten" Nomenklatura verborgen blieb. Der bis heute nicht in Frage gestellte Wert des "bildungsbürgerlichen" Kulturguts in einem Land, in dem es ein Bürgertum im westeuropäischen Sinn nie gegeben hat, ist umso erstaunlicher. Der Wert, der dort der Literatur beigemessen wurde, war im wahrsten Sinn des Wortes ein verinnerlichter. Im Terror der Stalinära pflegte man Gedichte, die in handschriftlichen Abschriften kursierten, auswendig zu lernen und danach zu vernichten, wie Nadeschda Mandelstamm in ihrer Autobiographie "Jahrhundert der Wölfe" berichtet.
Unantastbares Erbe
In Ray Bradburys Roman "Fahrenheit 451", 1966 von François Truffaut verfilmt, werden Klassiker der Weltliteratur auswendig gelernt, um geistiges Erbe zu retten und unantastbar zu machen. In der fiktionalen Welt einer düsteren Zukunft, in der die Menschen in hochtechnisierter Isolation dahin vegetieren, sind Bücher verboten. Der Feuerwehrmann Montag (im Film von Oskar Werner verkörpert) rückt täglich zu Razzia-Einsätzen aus und veranstaltet Bücherverbrennungen, bis er heimlich zu lesen beginnt, was er eigentlich vernichten soll. Schließlich findet er das Refugium der "Büchermenschen", die ihre Lieblingsbücher memorieren, um sie vor dem Vergessen zu bewahren, und wird einer von ihnen. In dieser apokalyptischen Vision bleibt innerhalb einer steril versachlichten Welt ein kleiner Raum bestehen, in dem Menschen die Antworten auf die elementaren Fragen ihrer Existenz in der Dichtung vergangener Zeiten suchen.
Dabei bedeutet die Auseinandersetzung mit der dichterischen Gestaltung der existentiellen Probleme des menschlichen Daseins zwischen Geburt und Tod, Schuld und Sühne, Liebe und Eifersucht, Macht und Gewalt innerhalb totalitärer Bedingungen für eine überwachte Intelligenz die Basis der geistigen Existenz, und die Metaphern, die die europäische Zivilisation über mehr als zweitausend Jahre hinweg gefunden hatte, einen wichtigen Rückhalt und Nährboden, der die Basis für Verständigung und Austausch schafft, gleichsam ein Bezugssystem für Gegenwärtiges, Neues und Zukünftiges.
Der Rückgriff auf die über Literatur und Kunst vermittelte Wahrheit über die Existenz wird, wie in "Fahrenheit 451", häufig in Grenzsituationen vollzogen. In Aldous Huxleys "Schöner Neuer Welt" - ein Zitat aus Shakespeares "Sturm" - entdeckt der im Reservat aufgewachsene "Wilde" John Savage in den Werken Shakespeares die ethischen Grundlagen der europäischen Kultur, allerdings um den Preis des bewusst auf sich genommenen Außenseitertums. Und der Schriftsteller und Lyriker Walter Mehring rekonstruierte in seinem autobiographischen Werk "Die verlorene Bibliothek" im Exil die Bibliothek seines Vaters und leistet über Bücher die Auseinandersetzung mit seiner Zeit und der Vergangenheit.
Eine bewusst reflexive Interaktion mit dem Fundament unserer Kultur vermag den Blick jeder Epoche neu zu schärfen, und bei Bedarf wird das Gut, das diese Kultur bereit hält, immer wieder gefunden werden - medial verordnet kann eine solche Entdeckung schwerlich werden.
BÜCHER. Alles, was man lesen muss
Von Christiane Zschirnt
Eichborn Verlag, Frankfurt 2002
330 Seiten, geb., E 22,60
Tipp
Das Klassikerforum Baden beschäftigt sich von 25. bis 28. März mit der Frage "Warum Klassiker - und warum noch immer?". Infos beim Kulturamt der Stadt Baden unter 02252/86800-230