Szenisch exzellent und musikalisch durchwachsen präsentieren sich in Salzburg die neuen "Meistersinger“. Die fantastische Perspektive lässt den Nazi-Bezug des Stücks vergessen.
Als Alexander Pereira ankündigte, in Salzburg das Wagner-Jahr mit einer szenischen Opernproduktion zu feiern, gingen die Wogen hoch. Nicht wenige fürchteten eine Auseinandersetzung mit Bayreuth. Dabei hätte man nur in der Geschichte der Salzburger Festspiele nachlesen müssen, um zu sehen, dass sie immer wieder Wagner auf dem Programm hatten. Darunter gleich drei Festspielsommer, von 1936 bis 1938, in denen die "Meistersinger“ aufgeführt und von den beiden führenden Dirigenten dieser Zeit dirigiert wurden: Wilhelm Furtwängler und Arturo Toscanini.
Auf dieses Werk fiel nun auch die Wahl für die Wagner-Hommage dieses Festspielsommers. Jene Wagner-Oper, die so manchen wegen der Deutschtümelei im Finale angesichts der Gräuel der Nazi-Diktatur als kaum mehr spielbar gilt. Tatsächlich, und das ist wohl die wichtigste Botschaft dieser Koproduktion mit der Pariser Oper, ist es nur eine Frage, aus welchem Blickwinkel man sie interpretiert.
Märchenhaft und komisch statt politisch
Erzählt man die Oper aus einer Perspektive wie Stefan Herheim - als einen Traum von Sachs, eingebettet in die Ära des Biedermeier und begleitet von den populärsten Märchenfiguren der Brüder Grimm - kommt einem die zuvor genannte politische Assoziation gar nicht in den Sinn. Dafür wird damit von Anbeginn deutlich, dass Wagner mit seinen "Meistersingern“ eine autobiografisch durchsetzte komische Oper komponiert hat.
So hatte er das Werk auch ursprünglich betitelt. Zuerst als "komische Oper“, später als "große komische Oper“, ehe er nach der Münchner Uraufführung durch Hans von Bülow, den ersten Gatten seiner späteren Frau Cosima, das Werk als "Oper in drei Aufzügen“ bezeichnete. Shakespeares komödiantischer "A Midsummer Night’s Dream“ ist eine der Inspirationsquellen. Ebenso Wagners einstige Begegnung mit einem derben, dem Alkohol sehr ergebenen Tischlermeister namens Lauermann in Nürnberg, dessen Kumpane in eine Prügelei mit den Gästen eines Wirtshauses verwickelt wurde. Hans Sachs später Verzicht auf Eva spiegelt Wagners ebenso schwierige Abkehr von seiner geliebten Mathilde Wesendonck wider.
Gewissermaßen schlaftrunken lässt der zu Beginn und Ende wie eine Spitzweg-Figur in weißem Schlafrock und mit Zipfelhaube erscheinende Sachs die gesamte Handlung für sich Revue passieren, die Herheim in die Entstehungszeit des Werks transferiert hat, das Biedermeier, eine zwischen familienseliger Gemütlichkeit und aufkeimender Revolution changierende Epoche. Oft gelang es nur mit scheinbar spielerischer Attitüde und viel hintergründigem Witz, sich der Starre des staatlichen Systems zu widersetzen und zu versuchen, aus diesem auszubrechen. Besser als mit der Einblendung vieler Grimm’scher Märchenfiguren, wie es Herheim ab dem zweiten Aufzug der Inszenierung zeigt, lässt sich diese Idee, welche den Charakter der "Meistersinger“ als komische Oper hervorkehrt, nicht realisieren.
Bühne mit zweifacher Botschaft
Doppelsinnig wie diese Figuren-Einblendung, die eine zusätzliche poetische Note in das Stück einbringt, ist auch die von Heike Scheele erdachte Bühnenarchitektur. So weitet sich im ersten Aufzug der obere Teil des Schreibsekretärs von Sachs zum von der Nürnberger Kirchenarchitektur inspirierten großen Kirchenoratorium. Im zweiten Aufzug erscheinen Wohnungsrequisiten und Häuser überlebensgroß. Ein Hinweis, wie sehr die biedermeierliche Enge bald größeren Perspektiven weichen wird müssen. Und anstelle der Festwiese wird man mit ebenso monumentalen Bücherregalen konfrontiert. Ein Symbol für das durch Sachs verkörperte universelle Wissen.
Die musikalische Interpretation kann mit der Aussagekraft dieser faszinierenden assoziativen Bilderkette nicht ganz mithalten. Gewiss, Michael Volles intensiver Sachs braucht große Rollenvorbilder nicht zu scheuen, und auch Roberto Saccà konnte schließlich als belcantesker Stolzing überzeugen. Doch zu zurückhaltend agierten Peter Sonn als farbloser David, Anna Gabler und Monika Bohinec als nur bemüht ihre Aufgaben bewältigenden Eva und Magdalene. Aus der Meistersinger-Riege stach Georg Zeppenfelds als markant artikulierender Veit Pogner heraus. Daniele Gatti am Pult der souveränen Wiener Philharmoniker und der gut studierten Staatsopernchoristen sorgte sich um differenzierten Klang, blieb eine auf stete Spannung zielende Tempodramaturgie aber weitgehend schuldig.
Die Meistersinger von Nürnberg
Salzburger Festspiele
2., 9., 12., 20., 24., 27. August
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





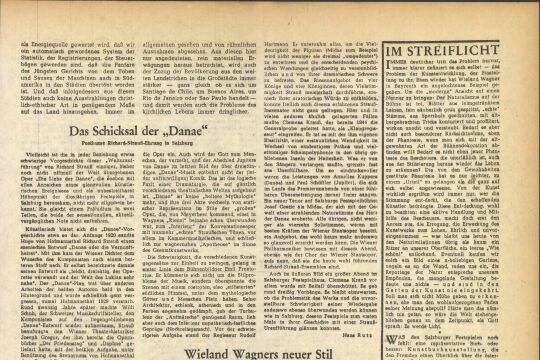




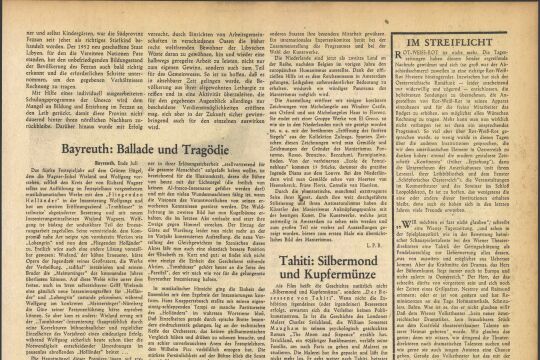





















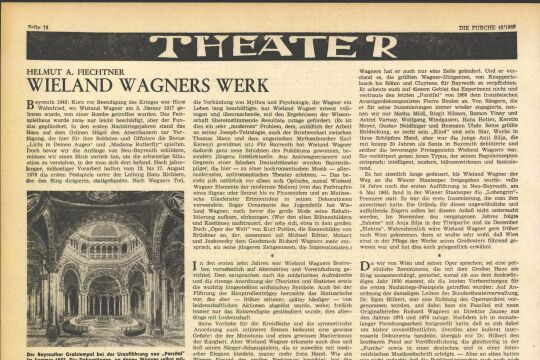


































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)










_edit.jpg)



