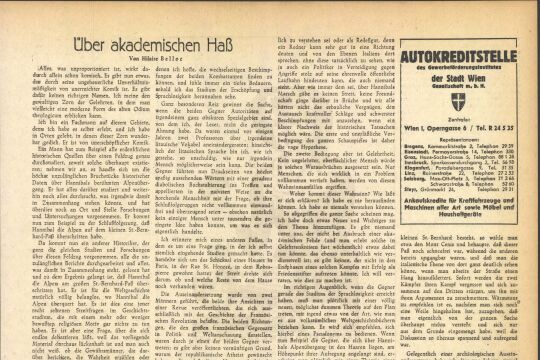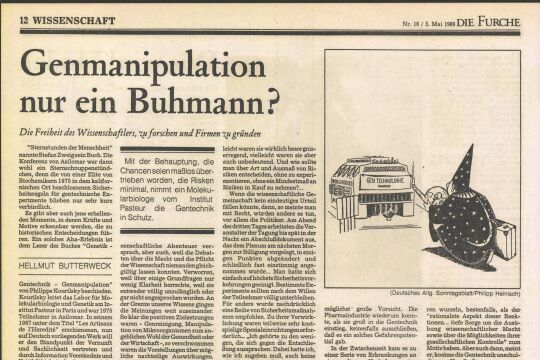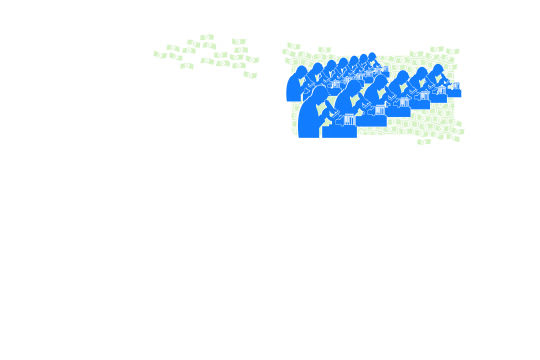Der Österreichische Wissenschaftstag 2007 diskutierte "Einheit und Freiheit der Wissenschaft". "Einheit und Freiheit der Wissenschaft" war das Thema des diesjährigen Wissenschaftstags. Dabei waren sich die Tagungsteilnehmer einig, dass die Universitäten freier werden müssen - von allerlei Zwängen (Über das Frei-Wofür wurde hingegen kaum diskutiert). Strittig blieb, was allen Wissenschaften gemein sein könnte. Und die Kritik Herbert Schnädelbachs am Konzept der zwei Welten, änderte wenig daran, dass die Begriffe Natur- und Geisteswissenschaften weiter verwendet wurden-vielleicht aber mit mehr Vorsicht. Redaktion: Thomas Mündle
Charles Percy Snow formulierte 1959 die These, dass die Wissenschaft in zwei Kulturen zerfällt. Dass die Geistes- und Naturwissenschafter kaum miteinander kommunizieren, geschweige denn einander verstehen, war ihm an seinen zwei Freundeskreisen aufgefallen (er hatte Physik studiert, arbeitete aber als Schriftsteller).
Snow von gestern
Snows These war Ausgangspunkt des Österreichischen Wissenschaftstags, der dieses Jahr von "Einheit und Freiheit der Wissenschaft" handelte und wie jedes Jahr im Hotel Panhans am Semmering stattfand. Und wer am Nachmittag dem Referat des Wissenschaftstheoretikers Herbert Schnädelbach nicht bis ins Detail folgen konnte, warum sich die Zweiteilung der Wissenschaften gerade nicht philosophisch begründen lässt, merkte spätestens beim Abendessen, dass die These der zwei Kulturen unhaltbar ist. Ein dem Autor gegenüber sitzender Professor für Bodenmechanik insistierte zu den Ingenieurswissenschaften zu zählen (O-Ton: "Nein, ich bin ganz sicher kein Naturwissenschafter") und der ihm zur Seite sitzende Rechtswissenschafter wollte auch in keine der beiden Schubladen passen.
Anders wie bei anderen Fachkongressen kommen die Tagungsteilnehmer (und auch die Referenten) des Wissenschaftstags von jeher aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Und da sie stets bereit sind intensiv miteinander zu diskutieren, hatte Snows These von den zwei Welten eigentlich von Anfang an keine Chance. Doch bloß weil man miteinander redet, bildet man noch keine Einheit. Die Soziologin Karin Knorr-Cetina etwa sollte später über "Die eine Vernunft und die vielen Rationalitäten-der gemeinsame Boden der Wissenschaften" sprechen und entschuldigte sich gleich zu Beginn, dass ihr der Titel von den Organisatoren vorgeben wurde. Tatsächlich habe sie große Mühe gehabt den gemeinsamen Boden zu entdecken (siehe Interview S.22).
Quantenphysik in Bildern
Dass einzelne Wissenschaften zu sehr fremd wirkenden Einsichten gelangen können, zeigte der Vortrag des Quantenphysikers Jörg Schmiedmayer von der TU Wien. Der Erkenntnisfortschritt vollzieht sich demnach in der Quantenphysik durch ein Entwerfen und Vergleichen von mathematischen Formeln, Experimenten und - der Laie mag überrascht sein - von Bildern. Beispielhaft führte Schmiedmayer das Bohrsche Atommodell an, bei dem Elektronen auf bestimmten Bahnen um einen winzig kleinen Kern kreisen. Das Modell war nicht nur von besonderer Eleganz - quasi ein Planetensystem im Mikrokosmos -, sondern stimmte auch mit Rutherfords Goldfolien-Experiment und den Maxwellgleichungen überein. Und obwohl sich daraus sogar eine richtige Voraussage herleiten ließ (nämlich der Wasserstoff-Spektrallinien), erwies sich das Modell später als falsch. Doch das änderte nichts daran, dass dieses Modell bis heute gelehrt wird (es wäre auch zu schön, um im Strudel der Wissenschaftsgeschichte unterzugehen).
Jemand aus dem Publikum stellte darauf die Frage, wie weit man mit der Bildsprache gehen darf - konkret bezog er sich auf das Sachbuch "Einstein entformelt" von Cornelia Faustmann und Walter Thirring. Und während man von einem harten Wissenschafter vielleicht eher eine kritische Einschätzung einer solch populärwissenschaftlichen Darstellung erwartet hätte, meinte Schmiedmayer: "Ich finde die Idee fantastisch-obwohl ich das Buch nicht gelesen habe." Die Mathematik allein ist vielleicht doch nicht die exakte Sprache, wenn man mit exakt meint, dass sie am meisten aussagt. So stellte ein Zuhörer (war es ein Mathematiker?) fest: "Die Mathematik sagt irgendwie alles und irgendwie auch nichts." Ein wahrlich quantenähnlicher Zustand (Schrödingers Katze war bekanntlich lebend und tot - das Beispiel durfte natürlich im Vortrag auch nicht fehlen).
Totale Freiheit
Während Schnädelbach ja überzeugt war, dass die Zweiteilung der Wissenschaften letztlich ein strategiepolitisches Unterfangen ist (siehe Interview S.23), so hätte man das auch bei einigen der Diskutierenden vermuten können, die die Forderung nach einer totalen Freiheit an den Universitäten für selbstverständlich erachteten. Zwar wurde immer wieder auf die gesellschaftliche Verantwortung der Universitäten hingewiesen, worin diese Verantwortung aber genau besteht, wurde nicht ausgeführt (Ausnahme war ein Chemie-Professor, der betonte: "Wir müssen vermehrt sehen, ob dem Nachwuchs sein Berufsleben gelingt").
Stattdessen pochten viele der Professoren auf ihre Freiheiten, und amüsierten sich über die Unzulänglichkeiten von Indikatoren wie den Impact Faktoren (die sicher ihre Schwächen haben, aber doch - richtig gelesen - einen Anhaltspunkt über die Qualität von Forschung geben). Eine Professorin von der Universität für angewandte Kunst zeigte sich gar stolz, dass ihre Uni keine Wissensbilanz vorgelegt hatte - mit der Begründung: künstlerische Kreativität lasse sich nun mal nicht messen (es stellte sich natürlich sofort die Frage, wie Studenten dann benotet werden und nach welchen Kriterien Professoren bestellt werden).
Bloß glücklicher Zufall
Auch der Vortrag von Herwig Kogelnik (Bell Labs) wies in diese Richtung: Zahlreiche Entdeckungen beruhen auf glücklichen Zufällen, so die These. Der junge Postdoc Charles H. Townes etwa ignorierte die Ratschläge von zwei Nobelpreisträgern (die seine Bemühungen für fehlgeleitet hielten) - und es gelang ihm trotzdem den ersten Maser und später den Laser zu entwickeln. Faktisch mögen solche Erzählungen ihre Richtigkeit haben. Zum Prinzip für wissenschaftspolitische Entscheidungen erhoben, taugen sie nicht, bedeuten sie doch: Wir Forscher können alle jederzeit große Entdeckungen machen - es hängt viel vom Zufall ab, weshalb unsere Projekte alle gleichermaßen (finanzielle) Unterstützung verdienen.
Als einschränkender Faktor wurden auch unfähige und faule Studierende empfunden. Viele würden ihr Studium nach einem abgewandelten Hamlet-Frage konzipieren: "To google or to think that's the question." Schließlich reichte es einer Studentin, die bis anhin als Mikrofon-Herumreicherin fungiert hatte und nun sich kurzerhand selbst meldete. Sie meinte, dass sie in Mindeststudienzeit Soziologie und Kulturanthropologie (fast) fertig studiert habe und dass manche Professoren den jungen Leuten mehr zumuten und höhere Anforderungen stellen könnten. Die anwesenden Professoren zeigten Humor - und applaudierten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!