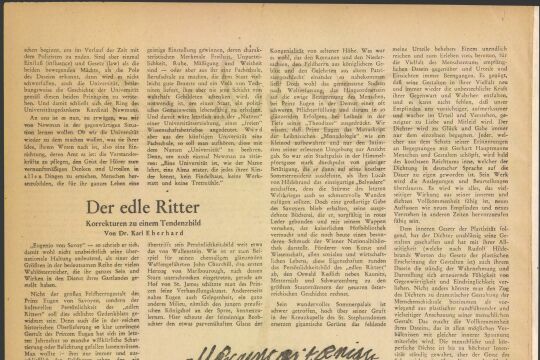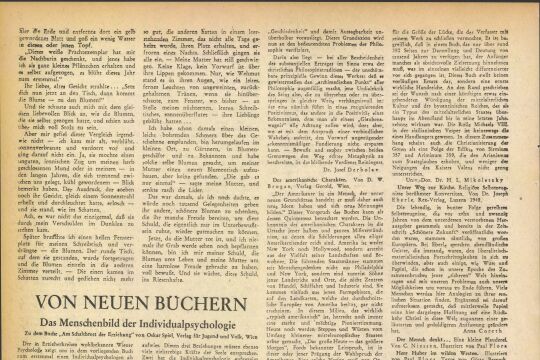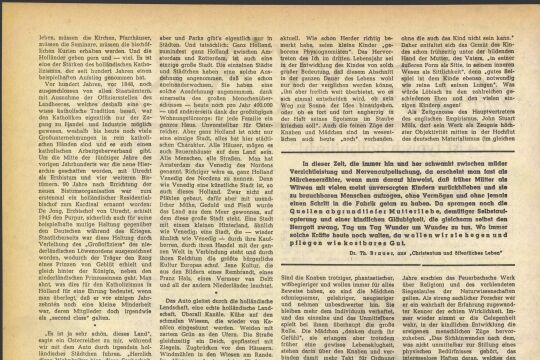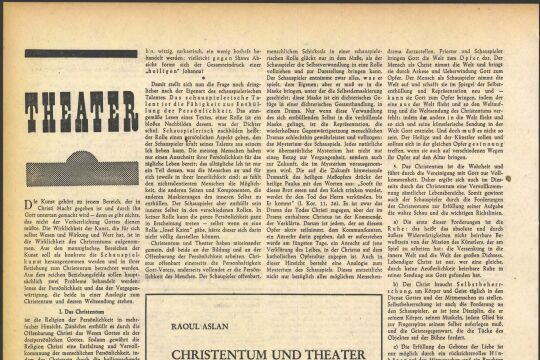Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vom Sinn des Spielens
Spielen* umfaßt ein weites Gebiet: vom Spiel der Kinder, ja der Tiere bis zum erhabenen Spiel der Kunst. Und doch liegen allen diesen Spielen, so verschiedenartig sie auch sind, gemeinsame Wesenszüge zugrunde. Während Jan H u i z i n g a in seinem tiefdringenden Werke „Homo ludens“ den Problemkreis von der ethnologisch-kulturhistorischen Seite aus untersucht, sei im folgenden vom Biologisch-Psychologischen ausgegangen. In diesem Aspekt scheint, daß, ungeachtet zunächst aller Art- und Wertunterschiede im einzelnen, all dies Spielen aus derselben Wurzel entspringt: Spielbetrieb ist eine der Äußerungsformen des Leb ens tr i eb es; denn der Lebenstrieb ist immer auch ein Erlebenstrieb. Jedes organische Wesen hat den Drang nach Selbstbehauptung, aber auch nach Erweiterung seines Daseins; Hunger und Liebe sind es, nach dem bekannten Schiller-Wort, die das Getriebe der Welt zusammenhalten. Liebe aber nicht etwa bloß als Sinngebung des Fortpflanzungstriebes (und damit einer Erweiterungstendenz in zeitlicher Beziehung), vielmehr auch in höherem Sinne, als amor Dei (der eine Erweiterung unserer Existenz ins Ewige und ideell Höchste mit sich bringt). Doch auch Erkenntnisdrang, ja Geltungsbedürfnis, Machtstreben, Habsucht, Neugier und so viele andere ethisch äußerst verschiedenwertige Tendenzen zielervauf Erweiterung unseres so beschränkten Ich. Sie können zu tragischem Konflikt mit der Umwelt und Uberwelt führen im Sinne der Hebbelschen These von der „Ausdehnung des Ich“, sie können als Sehnsucht nach dem Großen, Wahren, Dauernden den Menschen läutern. Immer ist es ein Uberquellen an Phantasie und Gefühl, ein Streben nach Uberwindung der eigenen Begrenzung, die auch dem Spiel zugrunde liegt, und auch das Spiel als solches ist ethisch vorerst indifferent, wird erst durch die „ins Spiel gesetzten“ Kräfte näher bestimmt.
Immer aber steht das Spiel im Gegensatz (ich möchte nicht mit Huizinga sagen: zum Ernst, vielmehr:) zum Leben des Alltags. Es ist eine Welt für sich, eine Welt der Fiktion, des A1 s - o b. Gewiß kann auch das „Leben“, gar das öffentliche Leben, der Fiktion nicht entbehren — man denke an die gesellschaftlichen, an viele wirtschaftliche Formen, an jede Art von Zeremoniell bis zur Anredeform, an Geldwesen und Rechtssatzung: aber während der Fiktionim Leben eine Hilfsfunktion zukommt, hat säe im Spiel die Zentralfunktion inne. Und während wir im Leben gezwungen sind, uns der Fiktion zu unterwerfen, nehmen wir sie beim Spiel freiwillig an. Eine scharfe Trennungslinie scheidet Fiktion und Tatsachenwelt. Wo wir einen Einbruch aus der Spielsphäre in die Wirklichkeit sehen, wie bei einem Spiel zum Zweck des Geldgewinns, bei einem Spiel mit Lebensplänen, gar einem Spiel ums Leben, da wird der Spielcharakter mißbraucht oder zerstört. Was wir Spiel nennen, gehört der Welt des Scheins an, nicht der des Seins. Spiel ist im eigentlichen, oft schönsten Sinne zwecklos.
Die Sphäre des Spiels wird freiwillig betreten. Innerhalb dieser Sphäre aber* herrscht strenge Gesetzmäßigkeit. Ein willkürlicher Verstoß gegen die Regeln zerstört das Spiel. Darin nun gleicht das Spiel dem Leben, daß bei beiden in
fallweise verschiedenem Grade äußeres Schicksal (das wir oft Zufall nennen) und eigene Kraft, Geduld, Geschicklichkeit miteinander oder gegeneinander wirken. Bei den Glücksspielen ist der Anteil eigener Gewandtheit selbst meist fiktivj im Geduldspiel, beim Schach, beim Lösen von Rätseln, beim Sport sind jeweils vorwiegend menschliche Kräfte des Geistes, des Charakters, des Körpers beteiligt; die höchsten Kräfte des Geistes und Gemütes beherrschen den Bereich der Kunst. Daraus ergibt sich bereits eine gewisse, zunächst noch primitive Wertskala. Immer aber gilt es, im Spiel wie im Leben, einen Widerstand zu überwinden; daher auch zum Beispiel das Wort .Sieger“ im Sport, das Wort Held* in der Bühnensprache.
Suchen wir nun dem Wesen des Spiels näherzukommen, so drängt sich die Frage auf: Wer spielt? Es spielen Katzen, Hunde, Bären; es spielt in der Menschenwelt vor allem das Kind: ein Stück Holz bedeutet ihm einen Baum, einen Mann, eine Lokomotive, und ein technisch raffiniertes, mechanisch bewegtes Spielzeug macht ihm viel weniger Freude als jene einfachen Dinge, an denen es — Hauptkennzeichen des Spiels — seine Selbsttätigkeit entfalten kann. Was der Psycholog „Gestaltsqualität“ nennt, das Ergänzen von Andeutungen aus eigener Kraft, ist der Ausgangspunkt für jedes Spiel. Diese Kraft aber ist vor allem die der Phantasie und des Gefühls. Sie spielt im Erwachsenen weiter: das „Kind im Manne“ spielt im Wachtraum,
in der Unterhaltung; es freut sich an Spannung und Lösung und der dadurch gegebenen Bereicherung seiner inneren Existenz, es findet in dieser durch Fiktion hervorgerufenen Spannung — Entspannung aus den ehernen Forderungen des Lebens. Und der Mensch spielt im höchsten Sinne in der Kunst; auch hier muß er, selbst als Empfangender, elbst-tätig sein, und darin liegt ja die beglückende Wirkung: selbsttätig ist er, wenn er die einzelnen aufeinanderfolgenden Töne geistig zur Linie der Melodie verbindet, wenn er vor einem Bilde die dritte Dimension aus eigenem ergänzt. Und jede Art von Stilisierung gibt seinem Geist jene fruchtbare Anregung, die seine Kräfte weckt; sie gibt ihm die wohltuende „Illusion“, deren tiefer Sinn von ludus, das heißt Spiel herrührt. So begleitet das Spiel auch den Erwachsenen durchs Leben — bis der Spieltrieb mit dem Lebenstrieb im Alter allmählich schwindet.
Wir haben nun, glaube ich, die wichtigsten Wesensmerkmale des Spiels gewonnen; als bedeutungsvollstes erscheint mir die Zwecklosigkeit, durch die sich die Spielhandlung von der Lebenshandlung scheidet. Aber vom Spiel gilt dasselbe, was Romano Guardini von der Liturgie 3agt: Es ist „zwecklos, doch sinnvoll*. Sein eigentlichster Sinn liegt in der Befriedigung des Erlebenstriebes, in der Erweiterung der Erlebensamplitude, in der seelischen (oft auch geistigen) Bereicherung. Wenn eine schlichte Frau aus dem Theater oder Kino kommt und ihren Eindruck in die
oft belächelten Worte faßt: „Sehr schön“ war's, ich hab' so viel g'weintl“, so weiß sie den „Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen“ besser zu deuten als die vornehmen Lächlerj denn die bewegte Teilnahme an fremdem (sei es auch fingiertem) Schicksal weckt schlummernde Seelenkräfte, legt das vom Alltag verschüttete Ich frei, führt so zur Selbstbesinnung, zur Selbsttätigkeit, zum Innewerden der eigenen Kraft — und es gibt keine höhere Beglückung als diese.
Dazu kommt ein Weiteres: es gibt nur wenige Einzelspiele, wie Patiencelegen; den weitaus meisten Spielen wohnt eine gemeinschaftsbildende Kraft inne, sie sind Brücken, durch welche die einzelnen miteinander in Beziehung treten, und so bieten sie eine Ablenkung vom oft Trennenden des Lebens zum Gemeinsamen der Fiktion. Dies bedingt Ritterlichkeit gegenüber dem Partner (Sportl) und damit eine wertvolle • Entgiftung der Atmosphäre. — All dies ist Sinn, ist mittelbare, im Grunde unbeabsichtigte, unbezweckte Wirkung des Spiels, das diesen Sinn einbüßte, wenn er zum Zwecke würde; auch der Scherz kann nur als spontane Äußerung seinen Sinn erfüllen, ein zweckhafter Scherz verläßt die Sphäre des geistigen Spiels.
Natürlich können Spiel Veranstaltungen Zwecke verfolgen, das Spiel in sich nicht. Dies gilt auch von den musischen Künsten, mit Recht sagt Oscar Wilde: „Alle Kunst ist unnütz.“ Dagegen sind die plastischen Künste bis zu gewissem Grade zweckgebunden) aber darin liegt kein Widerspruch, denn auch sie sind Kunst nur insofern, als sie sich über den Zweck erheben. In der Kunst entheiligt der Zweck die Mittel; wo das Bekenntnis zur Tendenz wird, liegt die Grenze der Kunst. Diese ist eine Welt der Fiktion über dem Leben, eine Welt, in der der Mensch Schöpfer und die ihm allein zugänglich ist. „Die Kunst, o Mensch, hast du allein.“ Sie macht die bewegenden Kräfte sichtbar, die „die gemeine Wirklichkeit der Dinge“ verhüllt, die Ideen der Schicksalsnotwendigkeit, der ethischen Impulse, und offenbart dadurch jene Wahrheit, die höher steht als die Wirklichkeit des Lebens.
Wenn noch des Laienspiels und des Laientheaters im besonderen gedacht sein soll, so sei darauf verwiesen, daß der Sinn des Spielens sich um so stärker erfüllt, je mehr der einzelne selbsttätig ist. Sei es, daß uralte, ehrwürdige Volks-
spiele, die in geistlichem und weltlichem Brauchtum wurzeln, im Kirchenjahr und im Rundlauf der Jahreszeiten zeitnah erneuert werden, sei es, daß die aristokratisch gewordene Theaterkunst (die gleichwohl nicht minder volkstümlichen Ursprungs ist) mit bescheidenen Mitteln und unter Vermeidung zu hoch gestellter Aufgaben vom Volke nachgestaltet wird: jeder Versuch dieser Art vermittelt zwischen Kunst und Volk, und dies ist der einzige Weg, der Kulturkrise wirksam zu begegnen. Man hat oft gesagt, das Laienspiel sei Bekenntnis, auch Bekennntis der Spieler, während das Theaterspiel Kunst der Selbstverwandlung sei. Aber das heißt, meiner Meinung nach, die Dinge in unerlaubter Weise zuspitzen; denn auch die Selbstdarstellung, die Selbstentblößung stößt auf die Hemmung der seelischen Scham, die sie nur durch die Fiktion der Verwandlung überwindet. Niemals können und wollen Laienspieler den Berufsschauspielern Konkurrenz machen, im Gegenteil: aus dem geweckten Verständnis werden die Laienspieler oft erst den Weg zur Aufnahmsbereitschaft für hohe Bühnenkunst finden, aus ihrem schlichten Versuch wird der Wunsch rege, nun als Empfangende ins Reich des Theaters einzutreten. Die Berechtigung solcher Versuche ist gerade heute evident; Kunst und Volk haben sich in verhängnisvoller Weise einander entfremdet. Wenn das Volk wieder in voller Breite zur Kunst finden soll, wird auch die Kunst wohl daran tun, die Stimme des Volkes nicht zu überhören!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!