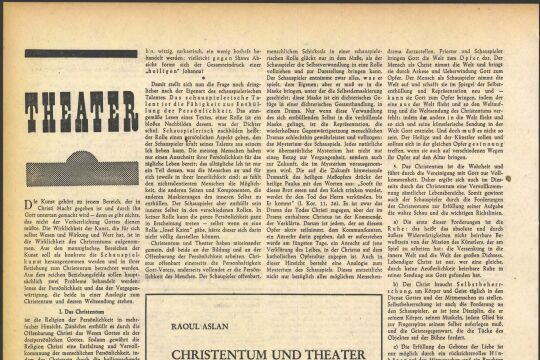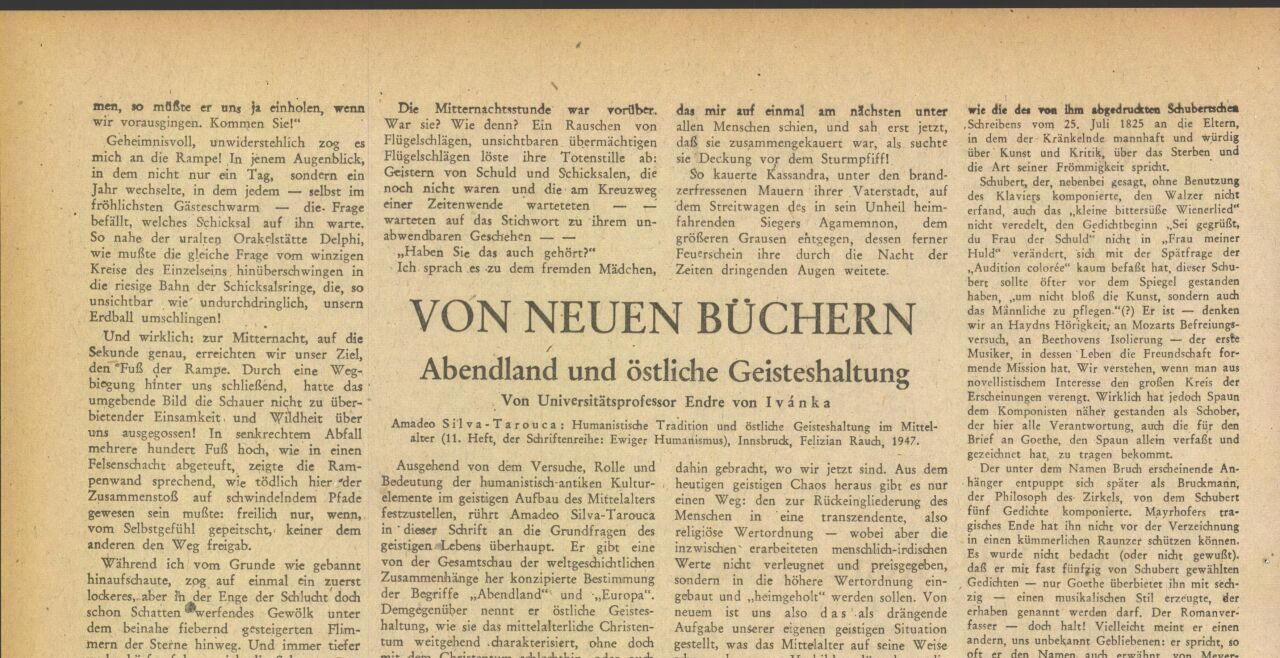
Abendland und östliche GeisteshaltungVON NEUEN BÜCHERN
Amadeo Silva-Tarouca: Humanistische Tradition und östliche Geisteshaltung im Mittelalter (11. Heft, der Schriftenreihe: Ewiger Humanismus), Innsbruck, Felizian Rauch, 1947.
Ausgehend von dem Versuche, Rolle und Bedeutung der humanistisch-antiken Kulturelemente im geistigen Aufbau des Mittelalters festzustellen, rührt Amadeo Silva-Tarouca in “ dieser Schrift an die Grundfragen des geistigen Lebens überhaupt. Er gibt eine von der Gesamtschau der weltgeschichtlichen Zusammenhänge her konzipierte Bestimmung der Begriffe „Abendland“ und „Europa“. Demgegenüber nennt er östliche Geisteshaltung, wie sie das mittelalterliche Christentum weitgehend .charakterisiert, ohne doch mit dem Christentum schlechthin, oder auch nur mit dem mittelalterlichen Christentum überhaupt gleichgesetzt werden zu können, jene Geisteshaltung, die dem Transzendenten gegenüber die Nichtigkeit des Irdischen, Weldichen, Menschlichen klar erkennt. In Weltflucht und Weltüberwindung aus dem, Irdischen zum Jenseitigen emporstrebend, wertet sie alles Geistig-Sittliche nur als Mittel dieses Emporstrebens und weist auch der Kunst nur die Aufgabe zu, durch das Irdisch-Sichtbare hindurch die Schönheit des Transzendenten durchscheinen zu lassen.
Diese Geisteshaltung tritt im Mittelmeerraum nicht erst mit dem Christentum auf; sie lebt schon in den orientalischen Mysterien der Spätantike, im Mithraskult und ähnlichen Erscheinungen, und überwältigt die eigentlich hellenische antike Tradition, die ein in sich geschlossenes, , harmonisch-schönes, in sich ruhendes Weltliches, ein verklärtes Irdisches, eine auf sich“ beschränkte, in sich selbst Genügen findende, im Natürlich-Schönen sichtbar gemachte Menschlichkeit vertritt. Aber diese anderen Strömungen konnten, die hellenische Haltung nur bekämpfen und unterdrücken — erst das Christentum, die Religion des „mensd^gewordenen Gottes“, konnte zwischen östlicher Geisteshaltung und hellenischer Gesinnung eine Synthese schließen, in der die hellenische Wertschätzung von Welt und Natur in die Hinordnung des Menschen und überhaupt aller Dinge zum Transzendenten und Jenseitigen so ,ein-gebaut wurde, daß eine neue, die typisch „abendländische“ Haltung entstand. Für sie ist die Ein- und Unterordnung der weltlichnatürlichen Werte in eine auf das Jenseitige ausgerichtete Werthierarchie bezeichnend. Sie bedeutet eine allgemeine „Heimholung des Irdischen zu Gott“ und erzeugt die Gesinnung eines „Weltlebens ohne Weltgesinnung“, die Weltumgestaltung an Stelle der Weltflucht setzt. Die Uberbetonung des Menschlich-Natürlichen, des Irdisch-Individuellen führt- aber dann — über den eigentlichen Humanismus hinweg, in dem noch viel von der christlichen Hochschätzung der Person als dem Gegenstande des göttlichen Heilsplans lebendig ist — zu einer Aufhebung dieser Synthese. Zunächst zwar wird das Menschenbild immer weiter, immer höher gefaßt, da es ja nicht als ein bloßes Nichts dem unendlichen Göttlichen gegenübergestellt werden soll,- sondern in sich, als das endliche und sichtbare Gefäß des Göttlichen und ^ Unendlichen, der Ort der Erfüllung des Jenseitigen im Diesseits, der Treffpunkt zwischen Gott und dem Irdischen ist ^— und deshalb steht auch die Renaissance in vielem rein menschlich höher als die Antike, die sie (mit erhöhten Ansprüchen an den Begriff des Menschen) zu erneuern bestrebt ist. Aber, im weiteren Verlaufe wird das Menschliche“ immer mehr rein auf sich selbst gestellt, soll es — ohne jede Beziehung auf einen überirdischen Sinn seines Daseins — als Eigen wert begriffen werden, bis man schließlich, wie wenn dies selbstverständlich wäre, unter Menschlichem nur mehr das Untermenschliche versteht, als ob die geistige Erhebung im Gebet eine weniger menschliche Lebensäußerung wäre als das zügellose Sichausleben der Triebe und Leidenschaften. An diesem Absinken des Menschenideals, des geistigen Bildes vom Menschen, ist unsere europäische Kultur zerbrochen, der Mangel einer Bindung des Menschlichen an letzte Werte hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Aus dem heutigen geistigen Chaos heraus gibt es nur einen Weg: den zur Rückeingliederung des Menschen in eine transzendente, also religiöse Wertordnung — wobei aber die inzwischen1 erarbeiteten menschlich-irdischen Werte nicht verleugnet und preisgegeben, sondern in die höhere Wertordnung eingebaut und „heimgeholt“ werden sollen. Von neuem ist uns also d a s als drängende Aufgabe unserer eigenen geistigen Situation gestellt, was das Mittelalter auf seine Weise schon als unser Vorbild gelöst hat: die Synthese zwischen den irdisch-menschlidien Werten, zwischen der liebevollen Bewertung und Auswertung des Natürlich-Diesseitigen und zwischen der transzendenten Ausrichtung und Hinordnung unseres eigenen Daseins und alles Seins auf einen höheren, jenseitigen Sinn, mit einem Wort die Verwirklichung des Ideals totalen Menschentums, wie es in der christlichen Grundidee gegeben ist: der Idee vom Mensch gewordenen Gott. Die Frage des Verhältnisses zwischen dem Humanismus und dem Mittelalter hört damit auf, eine bloße Frage der geschichtlichen Betrachtung und des historischen Rückblicks zu sein, und erhält eine ganz aktuelle, programmatische und exemplarische Bedeutung; sie wird zum Paradigma unserer eigenen geistigen Lage und unserer eigenen geistigen Aufgabe. Diese großen geistesgesdiichtlichen Zusammenhänge, mit reichem historischem, literar-geschiditlichem und — einer vorwiegenden Interessenrichtung des Verfassers entsprechend — kunstgeschichtlichem Material illustriert, in kurzer, prägnanter Formulierung dargestellt zu haben, ist das große Verdienst der überaus anregenden, ja oft zu letzter geistiger Verantwortung aufrufenden .Studie.
„Das Herz der Welt.“ Ein Christusbuch. Von Hans Urs von Balthasar. Verlag Arche, Zürich.
Ein Christusbjild, wie wenige entworfen worden sind. Die Christusliteratur der letzten Jahrzehnte geht vom kritischen Zweifel aus, ^auch das am weitesten verbreitete Christusbuch von Karl Adam. Man sucht sich auf dem rationalen Weg des historischen und psychologischen Beweises an das Rätsel Christus heranzutasten. Urs von Balthasar geht den umgekehrten Weg. Wer seine früheren Arbeiten über Origines und Gregor von Nazians kennt, der fühlt sich im neuen Christusbuch wohl beheimatet; denn hier findet er Theologie der Väter in modernem Kleide. Dies gilt sowohl von, der inhaltlichen wie auch von der formellen Seite, dieses Christusbuches. Wie die griediischen und syrischen Väter, geht auch Urs von Balthasar aus von dem unfaßbaren Staunen, daß G o 11 ^ ein Mensch geworden ist und als solcher das Herz aller Welt. Auch das sprachliche Gewand erinnert an die Blütezeit der Vätertheologie. Dem äußeren Anschein nach ist es zwar in Prosa geschrieben; wer aber näher hinhorcht, der spürt, daß das ganze Buch ein einziger, Hymnus ist, ähnlich der hymnischen Sprache des „Hoheliedes“ des hl. Gregor von Nazians oder der „Christusreden“ des hl. Ephram des Syrers; so ganz voll von Gewalt der Spradie, die in ihrem Jauchzen und in ihrem Stammeln an das unfaßliche Mysterium heranführen will, daß' Gott in dem“ Menschen-Christus das Herz der Welt geworden ist. DDr Claus S c h e d 1
„Schuberts Lebensroman.“ Von Ottokar Janetschek, Amalthea-Verlag, Wien, 2. Auflage, 1946.
Das Buch, von handlichem Format, gut auf gutem Papier gedruckt, gut bebildert und gut gebunden, genügt dem Anspruch eines nicht allzu verwöhnten Liebhabers vollauf- er wird an der schönen Leistung des Verlegers Freude haben. Nicht ganz so am Inhalt. Das Vermögen, ein Künstlerschtfksal durch das Stadfum der Kunst zu sehen, ist dem Erzähler nicht gegeben. Ein Fremder, der Schubert beherbergte, Anton Ottenwaljd in Linz, hat nach einer dem Musizieren folgenden nächtlichen Unterhaltung mit ihm in ein paar Briefzeilen ein echteres, das heißt aber höheres %Bild der geistigen Persönlichkeit entwor fen, die auch hier den Lebensroman formt; schade, daß die schützende Kraft dieser Darstellung dem Buchverfasser ebenso entgangen ist wie die des von ihm abgedruckten Schubert!che
.Schreibens vom 25. Juli 1825 an die Eltern, in dem der Kränkelnde mannhaft und würdig über Kunst und Kritik, über das Sterben und die Art seiner Frömmigkeit spricht.
Schubert, der, nebenbei gesagt, ohne Benutzung des Klaviejs komponierte, den Walzer nicht erfand, auch das „kleine bittersüße Wienerlied“ nicht veredelt, den Gedichtbeginn „Sei gegrüßt, du Frau der Schuld“ nicht in „Frau meiner Huld“ verändert, sich mit der Spätfrage der „Audition coloree“ kaum befaßt hat, dieser Schubert sollte öfter vor dem Spiegel gestanden haben, „um nicht bloß die Kunst, sondern auch das Männliche zu pflegen.“(?) Er ist — denken wir an Haydns Hörigkeit,- an Mozarts Befreiungsversuch, an Beethovens Isolierung — der erste Musiker, in dessen Leben die Freundschaft formende Mission hat. Wir verstehen, wenn man aus novellistischem Interesse den großen Kreis der Erscheinungen verengt. Wirklich hat jedoch Spaun dem Komponisten näher gestanden als Schober, der hier alte Verantwortung, auch die für den Brief an Goethe, den Spaun allem verfaßt und gezeichnet hat, zu tragen bekommt.
Der unter dem Namen Bruch erscheinende Anhänger entpuppt sich später als Bruckmann, der Philosoph des Zirkels, von dem Schubert fünf Gedichte komponierte. Mayrhofers tragisches Ende hat ihn nicht vor der Verzeichnung in einen kümmerlichen Raunzer schützen können. Es wurde nicht bedacht (oder nicht gewußt), daß er mit fast fünfzig von Schubert gewählten Gedichten — nur Goethe überbietet ihn mit sechzig — einen musikalischen Stil erzeugte, der erhaben genannt werden darf. Der Romanverfasser — doch halt! Vielleicht meint er einen andern, uns unbekannt Gebliebenen: er spricht, so oft er den Namen auch erwähnt, von Meyer-hofer. — Dr. Th, W. W e r n e r.
„Leise Dinge.“ Gedichte von Rudolf Feilander. Andermann-Verlag, Wien.
' Die ganze Tiefe und Innigkeit eines in Gott beschlossenen Herzens spiegelt sich in den klaren und reinen Versen des Dichters. Die Natur erscheint nicht mehr als ein Mythos des Unbewußten, sondern als die weise und mäßige Führerin zum Göttlichen. — Sagen, was ist! Ein seltener Weg zum Erfassen des Menschen, einer realen Humanität in der geistigen Tat: den unhörbar leisen Dingen des Seins das Wort zu verleihen, das Symbol des Geistes. Die Bedeutung der Gedichte Feilanders liegt vielleicht mehr im Metaphysischen als im Ästhetischen. Die Behauptung mag zuerst verwundern, sieht man sich den unsagbar zart hingehauchten Versen gegenüber. Und doch! Erst in der geistigen Wertung der Natur durch das Wort rückt sie in das richtige Verhältnis zum Geistwesen Mensch, erst dann bleibt sie ihm nicht mehr Gefahr des Dämonischen, sondern wird das einzigartige Medium Gottes. In schlichten und treffenden Worten wird Oskar Maurus Fontana dem Dichter Feilander in einem Vorwort gerecht und bereitet den Boden für die Lektüre eines wertvollen Buches. Hans M. L 6 e w
„Briefe um ein Bildnis.“ Von Noesen Paul, P. Lindau, Luxemburg 1946.
Das Wesen und das Schicksal eines jungen Menschen, mehr aus einem Bild herausgeholt als aus dem Leben. Persönliche Neigung und gute Erzählkunst formen daraus eine wirklichkeitsnahe und liebenswerte Gestalt. Dahinter, skizzenhaft und doch in prägsamer und klarer Darstellung um Persönlichkeiten der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts geführt, entrollt sich ein Bild Luxemburgs in Landschaft, Wirtschaft und Kultur. In anschaulichen Zusammenhängen weiter greifend, zeigt das Buch — immer in der plastischen Herausstellung bedeutender Menschen — Wandlungen von Auffassung 'und Erfahrung (namentlich in Technik und Kunst), die den Eingang einer neuen Zeit ankündigen. Erschütternd ist der Ausklang: die Tragik der jungen Generation von heute, die sich freilich dort zu heroischer Größe steigert, wo der Blick nach aufwärts geht. Dr. A. M o t z k o.
„Betrachtet die Lilien des Feldes.. .“ Aus dem Leben der Blumen. Vnn Dr. Robert S t ä g e r. Rex-Verlag, Luzern 1946.
Der Verfasser bietet eine Blütenbiologie, die nicht nur für den Fachmann geschrieben sein soll, sondern für . jeden Blumenliebhaber. Das Werk dient der finalen Betrachtungsweise, die auf Zweck und Urpaarung zugleich gerichtet ist. Es führt in den Wundern der Natur zur Ursache alle Dinge und kann besonders heute — wenn wir ruch nicht in der Form zu allem Ja zu sagen braudien — ein Wegweiser sein, der uns aus dem verkrampften phänomenalen materialistischen Denken, das zur Katastrophe von heute geführt hat, zum Denken an Gott und die Übernatur leitet. Dr. Anna M a t h ä
Märchenbücher aus dem Verlag Carl Überreuter. Dieser Verlag (Wien, IX., Alserstraße), der bisher schon durch mehrere, nach den gegenwärtigen Verhältnissen ungewöhnlich gut und mit Geschmack ausgestattete Jugendbücher aufgefallen ist — so durch seine „Ledertrumpf“-Ausgabe und sein „Tausendundeine Nacht“ — hat diesen einen „Robinson Crusoe“, einen Band Wilhelm Hauff — sämtliche Märchen, und Dickens „O 1 i v e r Twist“ folgen lassen. Die 250 bis 350 Seiten umfassenden Bände, zeigen das emsige und auch erfolgreiche Bemühen der Herausgeber, alle technischen Voraussetzungen eines schönen Buches mit gutem zeichnerischem Schmuck zu vereinigen. Wo es am Platze ist, wie bei „Oliver Twist“ oder „Tausendundeine Nacht“, hat eine Bearbeitung für die Jugend eingegriffen. Alle diese Bände sind Geschenkbücher, die mit bestem Rahmen den nie-alternden Reiz ihrer Meistererzählungen ura-* fassen. F. Greiffenburger.