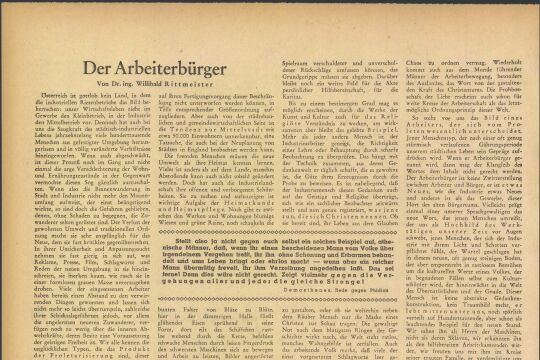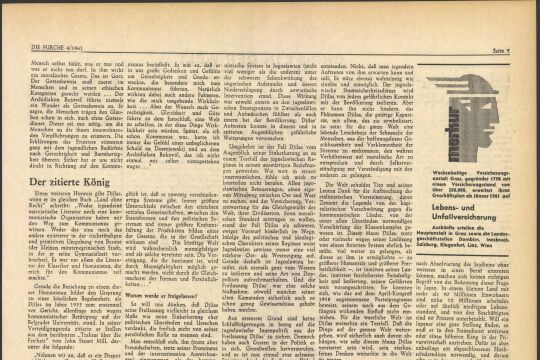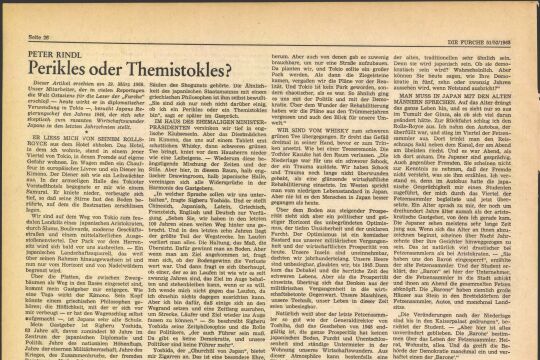Das JapanbiM des Europäers reicht von Verständnislosigkeit bis zu verständnisloser Bewunderung. Eine seltsame Erscheinung, wenn man die engen politischen, ökonomischen und nicht zuletzt touristischen Beziehungen bedenkt, die Japan mit der westlichen Welt verbinden. Grund für viele grobe Fehleinschätzungen ist wohl die gesellschaftstheoretische Forschungslücke, die es uns so schwierig macht, ein völlig andersgeartetes Gesellschaftssystem unvoreingenommen und adäquat zu beurteilen.
Die Identität des japanischen Volkes mit sich selbst ist ziemlich einmalig in der Welt, sogar verglichen mit anderen Inselstaaten, wie etwa England. Japan ist seit Menschengedenken ausschließlich von Japanern bewohnt, es gibt weder nennenswerte ethnische noch (nach der großen Christenverfolgung im sechzehnten Jahrhundert) religiöse Minderheiten. Alle Japaner sind klein, schwarzhaarig und sprechen dasselbe, kaum durch Dialekte differenzierte Japanisch. Politisch herrschte immer das Prinzip der Einstaatlichkeit.
Diese ausgeprägte Identität (die Gleichheit der einzelnen Elemente ist größer als ihre individuelle Verschiedenheit) ließ eine Gesellschaftsstruktur entstehen, deren Dominante das Kollektiv und deren Organisationsprinzip die reibungslose Reproduktion des Kollektivs ist. Der Japaner realisiert sich weitgehend im Kollektiv und nicht als Individuum. Viele Ausländer meinen, es sei schwierig, mit Japanern Kontakt zu finden. Es ist nicht schwierig; die Japaner sind kontaktfreudig und entgegenkommend, selbst bei geringen Sprachkenntnissen. Es ist vielmehr unmöglich. Denn dort, wo in der europäischen Gesellschiaftsstruktur eine besetzte Stelle ist, das Individuum, ist im japanischen System eine Leerstelle. Die besetzten Stellen sind in Japan die vielfältigen Beziehungen, die den Einzelmenschen mit dem Kollektiv verbinden und durch die er voll definiert wird. Bezeichnend etwa, daß es fünf verschiedene Wörter für „ich“ gibt, deren Verwendung nach dem sozialen Kontext variiert. So gebraucht ein junger Japaner, der mit gleichaltrigen, sozial gleichgestellten Japanern spricht, „boku“, im Verkehr mit Älteren, sozial Höhergestellten jedoch „watakushi“. Frauen gebrauchen das etwas weniger ausdrucksvolle „watashi“, wenn sie ihre Unterwürfigkeit besonders betonen wollen, „atashi“; „ore“, mif einem für japanische Ohren unschön klingenden, rollenden „r“ gesprochen, ist ausschließlich auf die rauhe Männersprache und den Gaunerjargom beschränkt.
In dieser Aufspaltung des Einzelmenschen in kollektive Funktoanem spiegelt sich eine äußerst diffizile, verfeinerte hierarchische Gliederung, in der der Ältere dem Jüngeren übergeordnet Ist und der Mann der Frau, doch an verschiedenen Punkten des Systems (Familie, Arbeitsplatz, gesellschaftliche Beziehungen) kann der einzelne auf ganz verschiedenen Stufen der Hierarchie stehen. So genießt der ungelernte Bauarbeiter den absoluten Respekt seiner Familie, die Ehefrau ist souverän in allen Haushaltsentscheidungen, der jüngste Büroangestellte fühlt sich als white-collar-man allen Arbeitern überlegen. Diese sich überschneidenden Hierarchien bewirken soziologisch eine bemerkenswerte Konfliktlosigkeit und individuell ein hohes Sdcherhedts- gefühl.
Mehr als drei Viertel der Heiraten werden auch heute noch vermittelt. Die Eltern (seltener Verwandte oder Freunde) suchen einen passenden Partner, ein Treffen wird arrangiert, zwei- oder dreimal wiederholt, nach zwei bis vier Wochen wird Hochzeit gehalten. Beide haben das
Recht, den anderen abzulehnen, davon wird auch Gebrauch gemacht, obwohl der elterliche Drude natürlich eine Rolle spielt. Es gibt Fälle, in denen mehr als dreißigmal erfolglos „Miai gemacht“, also heiratsvermittelt wurde. Auch in der Ehe wird die Hierarchie lückenlos reproduziert — die Frau entscheidet über alle Dinge innerhalb des Hauses, außerhalb befindet sie sich in totaler Abhängigkeit. Selbst Ehefrauen mit Universitätsabschluß dürfen sich außerhalb des Hauses ohne Einwilligung des Mannes weder gesellschaftlich noch kulturell betätigen oder gar einem Beruf nachgehen. Über diese Situation empfindet die Jugend ein zunehmendes Unbehagen, und es gibt wohl kein Land, in dem die lose Form des Zusammenlebens von J. P. Sartre und Simone de Beauvoir so populär ist wie in Japan — wenn sie auch keine Nachahmer findet.
Die schwach entwickelte Individualität der Japaner ist auch der Grund dafür, daß sie keine „eigene Meinung“ haben. Die europäische Persönlichkeit definiert sich ja gerade durch einen Komplex aufedn- ander abgestimmter Werturteile, in denen die unverwechselbare Stellung des Individuums zu allen Erscheinungen der „Realität“ zum Ausdruck kommt. Es fällt Europäern auch gar nicht schwer, Meinungen über neuauftretende’ Erscheinungen zu produzieren, da dem vorhandenen Wertsystem eine große Integrations- fähtgkeit eigen ist und bereits vorhandene Meinungen zur Analogiebildung heramgezogen werden, können. Für einen Japaner hingegen ist es völlig überflüssig, eine eigene Meinung zu haben, Meinungsproduzent ist das hierarchisch strukturierte Kollektiv, das Erscheinungen entweder integriert oder negiert. Es ist sehenswert, wie perplex Japaner reagieren, wenn man sie danach fragt, wie sie über den Kaiser denken. Nach längerem Nachdenken kam eine im Umgang mit Europäern bereits gewitzte Japanerin zu der Aussage, sie könne keine Meinung über den Kaiser äußern, da sie ihn nicht kenne.
Japaner sprechen gerne und viel, aber ihre Gespräche dienen hauptsächlich zur Reproduktion der kollektiven Harmonie. Sehr interessant ist auch die japanische Form des decision-making. Entscheidungen werden immer von einem möglichst großen Kollektiv getroffen oder, besser gesagt, nicht getroffen. In vdelstündigen Diskussionen wird Entscheidungsstoff angehäuft, bis die Entscheidung unaufschiebbar geworden ist und das inzwischen erschöpfende Argumentenmaterial sich kaum merkbar einer Möglichkeit zuneigt und damit die Entscheidung praktisch ohne persönliches Zutun der daran Beteiligten fällt. Für einen Europäer ist dieser Vorgang zermürbend und unverständlich, und meist merkt er gar nicht, daß die Entscheidung schon getroffen ist und wie sie ausfiel.
Naitürlich leidet der einzelne oft unter dem Drude der durchorganisierten gesellschaftlachen Verhältnisse, und dazu hat er viel weniger Möglichkeiten als ein Europäer, sein Unbehagen zu formulieren oder Er- satzhandlungen zu setzen. In Grenzsituationen, die nicht in das System einbezogen sind, wie etwa in der Sexualität, im Krieg oder im Straßenverkehr, kann die höfliche japanische Sanftheit daher unerwartet in Sadismus und Brutalität Umschlagen. Auch ist Japans Selbstmordrate, besonders unter der Jugend, eine der höchsten der Welt. Dabei spielt natürlich eine Rolle, daß Selbstmord im japanischen System nicht tabuiert ist Die Bewertung des einzelnen ist ja sehr niedrig. Die hohe Selibst- mordrate kann aber auch als Systemfahler interpretiert werden, insofern, als für den einzelnen keine Möglichkeit besteht, auf irgendeine Art legitim zu leiden. Verzwedf- lungsauabrüche sind in Japan undenkbar. Der Platz des einzelnen ist weitgehend vorausdeftniert. Glück, Zufall oder Leistung spielen im individuellen Dasein eine viel geringere Rolle als dm europäisch- amerikanischen System. Deshalb enden individuelle Schwierigkeiten oft in einer Katastrophe.
Vor leerer, nicht ausgefüllter Zeit scheinen die Japaner einen Horror vacui zu haben. Japaner sind immer beschäftigt oder beschäftigen sich immer. Viele Japaner arbeiten sechzig Stunden in der Woche und mehr, gehen natürlich nie in die Ferien, machen höchstens zwei, drei Tage Urlaub im Jahr. Nicht Geldgier ist der Grund für diese unaufhörliche Betriebsamkeit, die Japaner arbeiten nämlich nicht sehr effektiv, ein Großteil der „Arbeit“ ist bürokratische Prozedur. Grund für die Aktivität ist eher ein dumpfes Angstgefühl, daß Nichtstun gleich Nichtexistenz ist.
Da das Individuum dm System eine sehr schwach besetzte Stelle ist, sind die Japaner unfähig zu individueller Einsamkeit und der europäischen Vorliebe für ziellose Spaziergänge stehen sie verständnislos gegenüber. Individuelle Einsamkeit nimmt in der Teezeremonie die Form eines bis in minuziöse Details festgelegten Rituals an. Spaziergänge, Kontakt mit Natur oder historischer Umgebung finden als zeitlich und lokal genau definierte Massenbegehungen statt. In Gruppen, die Gruppen angeführt von einem Führer mit erhobener Fährte und nicht selten mit Trillerpfeife.
Die japanische Bürokratie hat es zu einer sonst nirgends erreichten Verfeinerung gebracht. Jeder kleinste Sachverhalt wird bürokratisch reproduziert. Ein freundlicher Fünk- tionär ersetzt in Rußland leicht zehn Formulare. Anders in Japan. Nichts kann in Japan geschehen, ohne daß es gleichzeitig und genauester« auch in der bürokratischen Metasprache geschieht. Wenn die bürokratische Sekundärhandlung ordentlich mitvollzogen wird, ist jedoch alles möglich, im Gegensatz zu kommunistischen Ländern, wo man in bürokratische Sackgassen geraten kann, die unüberwindlich sind. Diese Bürokratie — von allen akzeptiert, von niemandem angezwedfelt — ist offenbar auch ein Ausdruck des Horror vaoui vor chaotischer Leere, die mit sinnlosen Reproduktionen aufgefüllt und auf diese Weise domestiziert werden muß.
Die bildhafte Fülle des japanischen Denkens, welche aus der soziologischen und sprachlichen Situation folgt, verhaif der japanischen Literatur zu einem bemerkenswerten Reichtum an Ausdruck’smäglichkei- ten für eine detaillierte Schilderung psychischer Zustände und Naturbeschreibungen in unendlich feinen Abstufungen. Doch ist die Reproduktion der Realität in einem sehr viel geringeren Ausmaß durch zwischengeschaltete formale Prozesse (Darstellung der Wirklichkeit durch ein anderes logisches Modell, ironische Verzerrung) deformiert als in westlichen Literaturen, ihr Verhältnis zur gesellschaftlichen Realität ist ungebrochener, enger. Die japanische Literatur kennt, primitiv ausgedrückt, weder das moralische Pathos eines Schiler noch die geschichtsphilo- sophische „Tiefe“ der russischen Literatur noch die existenzielle Entfremdung eines Kafka, erreicht aber in ihren Höchstleistungen eine luzide Schönheit van höchster Perfektion, Westliche Betrachter vermuten oft, japanische Kunst enthalte tiefe, ihnen nur leider unverständliche Aussagen. Sie befinden sich im Irrtum. Fis steckt nichts dahinter. Ales ist gesagt.
Die japanische Geschichte kennt zwei großangelegte Versuche, die hierarchische Struktur des in sich ruhenden statischen Kollektivs zu transformieren: Zen-Buddhismus und modernen Konsumkapitalismus. Für das japanische Gesellschaftssystem war Zen ein Versuch, die durch die Aufspaltung der Einzel- persönllchkeit in hierarchisch festgelegte Fünktionen zutage getretene Flntfremidung zu überwinden, tieses Ziel wurde nicht erreicht, Zen blieb die Ideologie der herrschenden aristokratischen Kriegerkaste der Samurai. Bleibende Resultate erzielte Zen in der Architektur und im Gartenbau. Ehe Schönheit eines Palastgartens in Kyoto, in dem jede Hügelkurve, jeder Stein und jeder Baum in ihre ideale Form und Beziehung zueinander gebracht werden, ist vollkommen, aber gleichwohl beklemmend. Die absolute Harmonie, die in diesem gestalteten Environment zum Ausdruck kommt, unterdrückt durch ihre Vollkommenheit jede ind’i- viduele Freiheit. Alle Japaner lieben diese Gärten, manche finden sie „zu schön“. Die Tempel und Paläste mit ihren Gärten führen jedoch eine ziemlich isolierte Existenz im Weichbild der Stadt, und vor dem Tempeltor verbinden sich alte Autoreifen, schäbige Neubauten und Zivilisation smüll zu einem Chaos un- strukturierter Häßlichkeit, das durch die Kontrastwirkung um so auffälliger ist.
Das zweite große Experiment, dem die japanische Gesellschaft unterwarfen wurde, ist die Übernahme der modernen kapitalistischen Imdu- striegesellsebaft. Vor dem zweiten Weltkrieg wurde das Mehrprodukt der japanischen Industrie von den gewaltigen Rüstungsanstrengungen aufgezehrt, die Japan unternahm, um seinen schmalen ökonomischen Lebensraum mit militärischen Mitteln zu erweitern. Erst nach der Kapitulation, als Amerika den Japanern eine demokratische Regierungsform und weitgehende militärische Abstinenz auferlegte, nahm das Mehrprodukt die Form von all- gemeinzugänglichen Konsumgütern an. Eine hochentwickelte Konsum- güterinduistrie wirkt automatisch egalisierend. Die Japaner akzeptierten die Freuden des Konsums mit Begeisterung. Der Umgang mit technischem Spielzeug (Elektrogeräte aller Art, Photoapparate, Autos, Schnellbahnen) erfüllt sie immer und immer wieder mit kindlicher Freude. Aber die Werbung legt in Japan sehr viel mehr Gewicht auf den technischen Gag als auf die Schaffung eines Image wie in Europa, wo der Verbraucher mittels Identifizierung mit dem Produkt seine Individualität betonen soll.