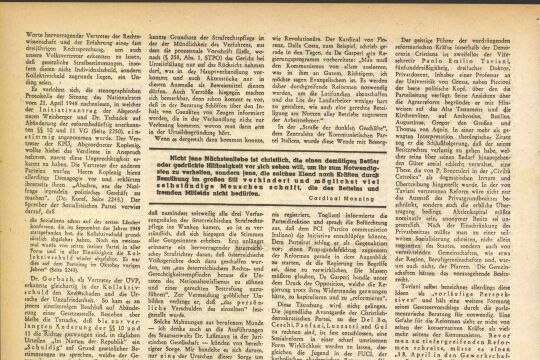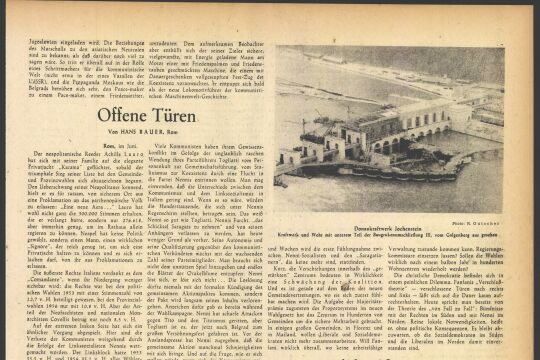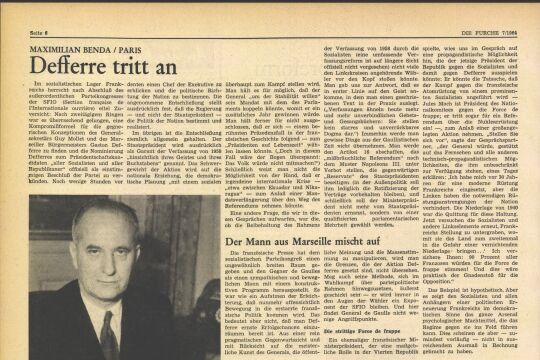Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zuviel Lärm um nichts ?
Der Reigen der Parlamentswahlen in den Demokratien Europas geht weiter. Nach Großbritannien ist am 26. Juni unser südliches Nachbarland Italien an der Reihe. Unser Italien-Korrespondent Hansjakob Stehle analysiert die Ausgangslage dieses Urnengangs.
Der Reigen der Parlamentswahlen in den Demokratien Europas geht weiter. Nach Großbritannien ist am 26. Juni unser südliches Nachbarland Italien an der Reihe. Unser Italien-Korrespondent Hansjakob Stehle analysiert die Ausgangslage dieses Urnengangs.
Von den Tausenden, die als Urlauber in diesem Monat nach Italien reisen, wird sich mancher verwundert fragen, was in diesem Land — das noch vor Jahren politisch so erregt und erregbar erschien — vor den wichtigen, unvermeidlichen Wahlen vor geht. Gelangweilt und nicht etwa aufgerüttelt vom Wahlkampf, erscheint Italien wie eine ruhende Mitte, die seine Parteipolitiker eifrig von links und rechts umkreisen.
Oder trügt dieses Bild? Steckt hinter der vierten vorzeitigen Parlamentsauflösung in elf Jahren, hinter der sechsten Regierungskrise in vier Jahren doch ein alarmierender Befund? Wird die noch „unfertige Demokratie“, von der man in Italien nach 38 Jahren christdemokratischer Dauerführung spricht, allmählich doch unregierbar?
Nicht wenige Italiener glauben heute, daß der späte, aber umso kräftigere Sprung ihres Landes ins industrielle Zeitalter trotz des sichtbaren Aufschwungs poli-
tisch und sozial mißglückt ist, bezahlt mit dem Bankrott eines halbstarken Wohlfahrtsstaates.
Dennoch: Vor kurzem erst sah man Amintore Fanfani — sogar noch als gestürzten Regierungschef — in Williamsburg unter den sieben Wirtschaftsriesen der Welt auch Italien repräsentieren. Der große atlantische Bruder lobte den kleinen Herrn aus Rom als „exemplarischen Verbündeten“. Und Fanfani ist in der Tat selbst ein Exempel für jene bleierne Stabilität, die Italiens Standbein zwar schwanken, aber bislang nicht straucheln läßt.
Blicken wir kurz zurück: Auch auf ihrem Tiefstand 1975 hatte seine christdemokratische Partei mit über 35 Prozent der Wählerstimmen ihre relative Mehrheit nicht verloren, während die Kommunisten auch nach ihrem bisher größten Stimmengewinn 1976 (über 34 Prozent) weit genug von jener Wende entfernt blieben, die viele befürchteten oder erhofften.
Damals trat die Democrazia Cristiana dem „historischen“ Kompromißvorschlag des Kommunisten Enrico Berlinguer näher — nicht, um diesem den Weg zur Macht zu ebnen, sondern um die Kommunisten in der Mitverantwortung zu zähmen und sich selbst eine stabilere Basis zu schaffen.
Der Versuch scheiterte. Nicht nur, weil der Erfinder dieses Konzeptes, Aldo Moro, 1978 ermordet iXmrde; auch, weil dem allgemeinen Bedürfnis nach „Reformen“, die das revolutionäre Potential der marxistischen Linken hätte entschärfen können, außer verbalen Bekenntnissen kein wirksames Programm entsprach.
Dennoch war die damalige Parole der „nationalen Solidarität“ keine bloße Koalitionsformel. Der Christdemokrat Gulio An- dreotti, der als Regierungschef zum Testamentsvollstrecker Moros wurde, benutzte sie damals, um die Krise praktisch in den Griff zu bekommen — und zwar mit Hilfe und Duldung jener Kommunisten, denen Andreotti — anders als es Mitterrand später in Paris tun würde — keine Ministerposten als Trostpreis bieten durfte.
Als die KPI deshalb die Flucht zurück in die Opposition antrat, da verlor sie bei den Wahlen 1979 auch gleich wieder vier Prozent Stimmen. Ihr Traum vom lateineuropäischen „Eurokommunismus“ ist seitdem immer mehr verblaßt.
Allzu spät, erst nach dem afghanischen und polnischen Schock, hatte KPI-Chef Berlinguer eindeutig den Trennstrich zu Moskau gezogen; es konnte nicht mehr Italiens innenpolitischer Stabilisierung zugute kommen, ja nicht einmal den Kommunisten selbst. Denn sie müssen jetzt ihre innerparteilichen „Verdauungsstörungen“, die sich erst nach ihrem Kongreß vom März dieses Jahres halbwegs beruhigten, durch einen umso schärferen Oppositionskurs kompensieren.
So liegt nach wie vor — wenn auch undramatischer — das Gewicht der „kommunistischen Frage“ auf dem Weg jedes wirtschaftlichen oder politischen Reformversuchs. Die KPI ist und bleibt die zweitstärkste Partei des Landes, das breiteste Sammelbecken sozialen Protestes, des vielfältigen Überdrusses und utopischer Hoffnungen. Welcher andere Partner oder Rivale könnte einer — ja immer nur relativen — Mehrheit von Christdemokraten zum wirksamen Regieren verhelfen oder sie gar ablösen?
Bettino Craxi heißt jetzt der Mann, der sich beides zutraut. Dieser Parteichef der Sozialisten glaubte schon nach den Wahlen vor vier Jahren mit einem nur zehnprozentigen Stimmenanteil nichts Geringeres als den Sessel des Regierungschefs für sich fordern zu können.
Craxi meint, auch in Italien sei die Chance für eine „große moderne westliche Sozialdemokratie“ entstanden, die — nach französischem Muster — den Machtwechsel vollziehen und beiläufig auch noch die kommunistische Frage lösen könnte.
Ein Übergang in diese Richtung schien sich zu öffnen, als nach dem Sturz der Regierung Forlani 1981 zum ersten Mal ein Nicht- Christdemokrat, der linksliberale Republikaner Spadolini, zum Zuge kam. Aber der Schein trog. Trotz all seiner Klugheit vermochte Spadolini — als Exponent einer winzigen linksliberalen Partei — nicht aus dem Bannkreis seiner christdemokratischen Hauptpartner zu treten. Und eben deshalb haben ihn dann seine sozialistischen Minister Ende 1982 zu Fall gebracht.
Schon damals lag für den Sozialisten Craxi die Versuchung, sein Heil in vorzeitigen Neuwahlen zu suchen, sehr nahe. Aber die Ahnung, daß ihn auch dies seinem Traumziel kaum näher bringen würde, überwog noch. Und zwar so sehr, daß er ganze 150 Tage lang eine Koalition stützte, an deren Spitze wieder ein Christdemokrat trat — sogar einer aus der allerältesten Garde: eben Fanfani.
Aber nach fünf Monaten hatten ihn die Sozialisten zu Fall gebracht, mußte er einem müden und verärgerten Wählervolk die Bilanz dieser vier Jahre — ohne kommunistischen Beistand — unterbreiten.
So sieht sie aus: eine weitgehend unproduktive Staatsverschuldung, die — bei wirtschaftlichem Nullwachstum — 65 Prozent des Bruttosozialproduktes erreicht hat (in der Bundesrepublik
Deutschland — zum Vergleich — 35 Prozent) und 1982 fast doppelt so hoch wie versprochen stieg; eine dadurch angekurbelte Inflation, die 1980 auf 21 Prozent kletterte und gegenwärtig — dank sinkendem ölpreis — „nur“ 16 Prozent, mehr als das Fünffache der bundesdeutschen Quote, beträgt; mindestens 2,2 Millionen statistisch erfaßte Arbeitslose — das sind zwölf Prozent der aktiven Bevölkerung (in der BRD neun Prozent).
All dies vor dem Hintergrund zwiespältiger Entspannungszeichen: Der Terrorismus scheint wenigstens im Polizeigriff zu sein — oder hat er gar resigniert? Und die Skandale machen etwas weniger von sich reden.
Selbst die Gewerkschaften einigten sich im Jänner mit den Industriellen über eine Dämpfung der Arbeitskosten und riskierten dabei fast auseinanderzubrechen — obwohl ihnen Craxi sein gutes
Gewissen anbot Ihm durfte da erst ein Lob aus dem Hause „Fiat“ wie Hohn in den Ohren geklungen haben: „Liebe Freunde, die zweite bürgerliche Partei ist schon geboren: die sozialistische Craxis“, so hatte Umberto Agnelli einer christdemokratischen Versammlung zugerufen.
Eben das aber hat Craxi schließlich zur Flucht aus der Regierung Fanfani getrieben. Seinem ehrgeizigen Plan, sich zum „italienischen Mitterrand“ zu stilisieren, also wie die französischen Sozialisten die Kommunisten zu überholen, fehlt die solide Basis. Denn anders als in Frankreich ist in Italien der politische Standort von „Sozialdemokratie“ schon (recht oder schlecht) doppelt besetzt: nämlich in beiden großen Volksparteien, der kom munistischen und der christdemokratischen, gibt es eine mehr oder weniger sozialdemokratisch gesinnte Mehrheit.
An der Spitze der Democrazia Cristiana wiederum steht seit einem Jahr mit Ciriaco De Mita ein Mann, der vom linken Flügel kommt. Er denkt zwar nicht mehr an irgendein taktisches Paktieren mit den Kommunisten, aber er billigt diesen ganz gelassen zu, daß letztlich nur sie und niemand sonst die demokratische, verfassungsmäßige Alternative bilden könnten — aber natürlich nur, wenn sie die nötige Mehrheit gewännen.
Und eben dies zu erreichen, ist jetzt KP-Chef Berlinguers Programm geworden. Er brauchte dazu freilich die gleichen Partner, die auch De Mita braucht: Craxis Sozialisten. Nur ein paar Prozent mehr für Kommunisten und Sozialisten würden schon zu einer „linken Wende“ genügen, sagte Berlinguer jetzt. Und er hat damit Craxi gezwungen, die Position des lachenden Dritten zu verlassen und schon im Wahlkampf Farbe zu bekennen.
Zwar redet Craxi immer noch von einem angeblich drohenden „Rechtsrutsch“, ja „Rechtsputsch“ in Italien, aber zugleich rettet er sich bereits im Wahlkampf vor der kommunistischen Umarmung in die christdemokratische. Seine Rolle des über der Szene schwebenden, der sich die Möglichkeiten offenhält, um dann die Hauptrolle zu übernehmen, ist ausgespielt, ehe sich der Vorhang hebt.
Das verdrossene Publikum aber fragt sich: Wozu so viel Lärm um nichts? Acht Millionen, 18 Prozent der Wahlberechtigten, könnten — so rechnen Demoskopen — ihre Stimme am 26. Juni überhaupt verweigern. Aber auch die große Mehrheit, die Italiens Demokratie nicht den Rücken kehren wird, ist skeptisch gegenüber den Parteien, die jetzt von rigorosen Rezepten reden. In Wirklichkeit verdankt Italien allemal seine Rettung sehr elastischen Uberlebenskünsten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!