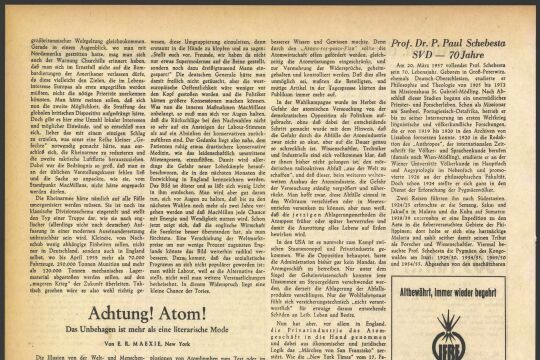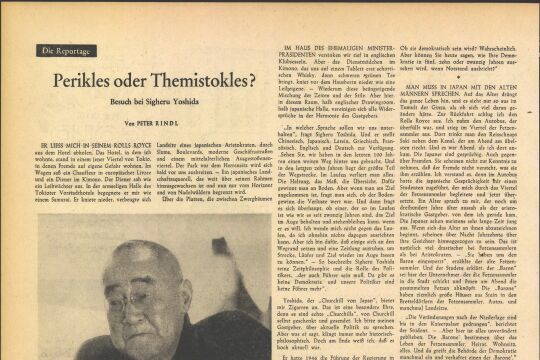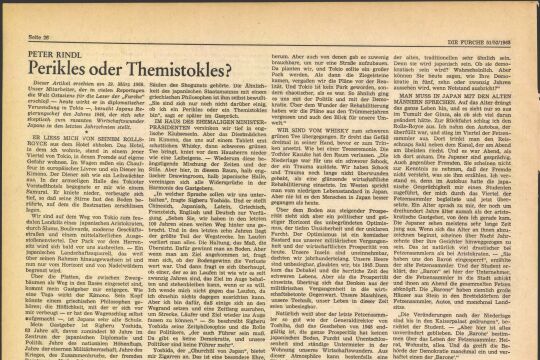Kinder mit Dosimetern, Müllberge und Kopf-hoch-Parolen. Wie Japans Bürger mit der Katastrophe von Fukushima leben.
Die Innen- und die Außensicht Japans passen seit dem März dieses Jahres nicht mehr zusammen.
Im Ausland sind durch die Ereignisse im Atomkraftwerk Fukushima die 25.000 Toten des Tsunamis, die Hunderttausenden obdach- und arbeitslos gewordenen Menschen in Vergessenheit geraten. In Japan dominiert hingegen ihr Schicksal nach wie vor die Berichterstattung. Man muss oft zwischen den Zeilen lesen, um an Informationen über Strahlenbelastung heranzukommen. Wenn beispielsweise die Stadt Kyoto das für ein traditionelles Feuerfest angebotene Kiefernholz aus den zerstörten Wäldern nördlich von Sendai wegen zu hoher Cäsium-Belastung ablehnt, stellt sich die Frage, ob die Lebensmittel aus dieser Gegend wirklich so unbedenklich sind, wie es die Regierung nicht müde wird zu behaupten.
Besorgte Eltern fragen nach
Inwieweit ist den Behörden überhaupt zu trauen, nachdem sie die Gefahren nach dem Reaktorunglück so lange herunterspielten? Vereinzelt stößt man dann doch auf kritische Berichte im Fernsehen und den Printmedien: besorgte Eltern aus der Stadt Fukushima, die Strahlenmessungen selbst organisieren, Experten, die Gefahren und Risiken offen ansprechen. In einem Verzweiflungsakt wird das gesamte Erdreich rund um Schulen und in den öffentlichen Parks der 300.000-Einwohner-Stadt Fukushima, 60 km vom Unglücksreaktor entfernt, ausgetauscht. Die Eltern fragen sich dennoch, wie die Kinder durch die verstrahlten Straßen ihren Weg in die Schule finden sollen.
Also lassen die Behörden Karten mit weniger belasteten Alternativrouten erstellen, präsentieren rote, grüne, gelbe Linien auf dem Stadtplan, den Schulkindern werden Dosimeter um den Hals gehängt. Das ist Japan: keine langen Diskussionen, stattdessen Lösungen austüfteln, Probleme überwinden, Durchhalteparolen wiederholen.
"Gambare Nippon“ - "Kopf hoch, Japan!“ Flucht und Resignation gelten als Verrat an der Gemeinschaft, als unehrenhaft. In Sendai, nur knappe 100 km vom havarierten Reaktor, scheint man sich für Strahlenwerte in der Luft oder im Boden kaum zu interessieren. Die gängigen Antworten auf die Frage nach Strahlenangst lauten: "Wir müssen daran glauben, was uns die Behörden sagen. Und außerdem, wo sollen wir denn hin?“ Die überdachten Einkaufsstraßen quellen vor Passanten über. Vom stärksten Erdbeben seit Menschengedenken sind keine Spuren zu bemerken.
Die vom Tsunami betroffenen Bezirke und der Hafen gleichen einer großen Baustelle. Eine Lehrerin bestätigt, das Wasser im offenen Schwimmbad ihrer Schule sei nach relativ höheren, aber laut Behörden nicht gesundheitsgefährdenden Strahlenwerten, ausgetauscht worden. Doch was bedeutet relativ? Und was ist mit dem Sand auf dem Sportplatz, auf dem die Kinder turnen? Sie wechselt das Thema, schaut weg, lacht verlegen. Selbst unter Ärzten herrscht Verwunderung über meine Skepsis.
Geigerzähler aus der Ukraine
Ein Internist meint, die atomaren Unfälle der Vergangenheit hätten keine signifikanten Einflüsse auf die Gesundheit der Anwohner gehabt und die Strahlenbelastung in der Luft wäre in Japan vor 25 Jahren wegen der weltweiten Atomversuche zigfach höher gewesen als heute. Er bietet mir saftige Pfirsiche aus der Präfektur Fukushima an, die besten und zurzeit billigsten, fügt er lachend hinzu.
In den Zeitungen werden täglich detaillierte Strahlenwerte veröffentlicht. Sendai soll vom atomaren Fallout weitgehend verschont geblieben sein, alle Werte sind unter der Bedenklichkeitsgrenze. Ich bin dennoch frustriert, weil niemand meine Bedenken teilt. Bis ich auf Dr. Tadashi stoße. Er arbeitet in einem Sendaier Krankenhaus und ist Vater von zwei Kindern. Aus Sorge um ihre Gesundheit hat er sich einen Geigerzähler aus der Ukraine importieren lassen. Seitdem düst er auf seinem Motorrad unermüdlich durch die ganze Präfektur und vergleicht seine Messergebnisse mit den offiziellen Zahlen.
Zu meiner Erleichterung versichert er mir, sie würden weitgehend übereinstimmen. Mittlerweile haben die Behörden ein relativ genaues Mapping der Strahlen-Belastung für ganz Japan erstellt. Der Bereich mit bedenklich erhöhten Strahlenwerten erstreckt sich auf die 30 km-Gefahrenzone rund um den havarierten Atommeiler und greift zungenartig, aus dieser heraus, in den Nordwesten, in Richtung der Stadt Fukushima. Außerhalb dieser rot eingefärbten Zone gelten die Hot-Spots, Orte mit einer erhöhten Radioaktivität in sonst relativ strahlenfreien Gegenden, als mehr oder weniger gefährlich.
Entscheidungsfreiheit
Die Behörden zögern dennoch, Empfehlungen zur Evakuierung herauszugeben, sie spielen offenbar auf Zeit, während die Menschen in diesen Orten zunehmend unruhiger werden. Vielerorts heißt es: "Die Entscheidung liegt bei Ihnen, wir geben nur eine Empfehlung aus.“ Vor allem Eltern kleiner Kinder sind durch diese Situation verunsichert, denn eine Entscheidung zur Evakuierung würde weitgehende Konsequenzen haben: Jobverlust, Schulwechsel, Aufgabe der Wohnung, im Stich Lassen der Eltern und Verwandten.
Ich habe die Einladung von Herrn Yamaki zunächst ausgeschlagen. Er ist Reisbauer in einem Dorf im nördlichen Zipfel der Präfektur Fukushima. Ich schämte mich dabei, ihn und seine Nachbarn wie Aussätzige zu behandeln und war um Ausreden bemüht. Er meinte am Telefon, seine Gegend sei sicher, doch allein der Name Fukushima und die Entfernung von nur 50 Kilometern zum Unglücksreaktor machten mir Angst. Erst als ich Dr. Tadashis Karte sah, auf der die Küstengegend tatsächlich kaum strahlenbelastet zu sein schien, entschloss ich mich doch zu einen Besuch. Er hat sich sehr gefreut, mich zu sehen, seine Frau hat Speisen aufgetischt, deren Zutaten aus anderen Teilen Japans stammten.
Zu gut wusste er um meine Bedenken Bescheid. Selbst seine Tochter aus dem Norden Japans hat sich geweigert, die Eltern im Sommer zu besuchen. Herr Yamaki meinte, die Messungen in seinen Feldern hätten 800 Becquerel ergeben, das würde beim geernteten Reis nur 80 Bq/kg, weit unter dem Grenzwert von 500 Bq/kg ergeben. Dennoch hat er Angst vor der neuen Ernte. Selbst wenn die Grenzwerte nicht überschritten werden, wird er für seinen Reis kaum Käufer finden können. Er sagt, am schlimmsten hätte es die Bewohner der wegen radioaktiver Belastung evakuierten Orte weiter im Süden getroffen.
Skepsis und Misstrauen
Sie mussten alle ihre Häuser, ihr Vieh und Felder zurücklassen und werden wohl nie wieder zurückkehren können. Er gibt mir zum Abschied eine Probe mit dem frisch geernteten Reis. Vielleicht könne man diesen von unabhängigen Experten in Österreich testen lassen, sagt er und in seinem Gesicht zeichnen sich Sorgen und Traurigkeit ab. Ich ließ den Reis in Wien auf Radioaktivität untersuchen und konnte ihm eine gute Nachricht überbringen: seine Produkte sind nicht radioaktiv belastet.
Dr. Tadashi hat jedenfalls die Entscheidung, seine Familie aus Sendai in den Süden zu evakuieren, vorerst verschoben. Er bleibt dennoch skeptisch und misstraut weiterhin den Medien. Er passt peinlich darauf auf, was gekauft wird. Nur Gemüse aus dem Süden Japans und Fisch von der Westküste, oder noch besser aus dem Übersee, kommen bei ihm auf den Teller.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!