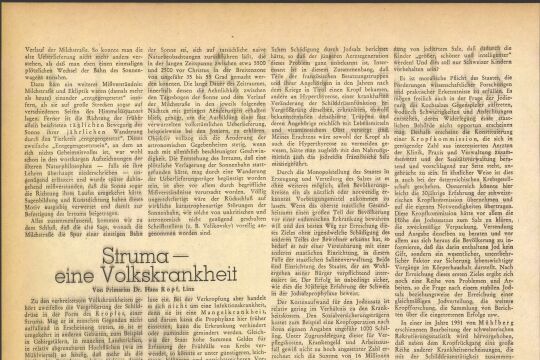Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mehr Strahlensicherheit fürs Eigenheim
Man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Sie haben keinen Ge-.schmack und brennen nicht auf der Haut. Radioaktive Strahlen, vor Tschernobyl längst kein Thema für die Öffentlichkeit, sind seit dem Supergau von 1986 einer der größten Angstfaktoren für die österreichische Revölkerung.
Der Reaktorunfall löste aber auch ein intensives Nachdenken über die zukünftige Absicherung gegen ähnliche Unfälle und ihre Folgen aus. So wurde speziell für den Strahlenschutz ein umfassendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Pünktlich zu Reginn des Jahres 1996 gab das Innenministerium einen „Strahlenschutzratge-ber" heraus. Darin wird ein grundsätzlich neues Konzept des Schutzes vorgestellt. Während das bisherige Schutzkonzept Anfang der sechziger Jahre für das Ziel entwickelt worden war, Schutzräume für die Revölkerung zu errichten, die vor den Folgen kriegerischer Handlungen (Stichwort „Trümmerschutz") bewahren sollten, ortete man nun die realen Gefahren anderswo. „DasEnde des kalten Krieges, die machtpolitischen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa und nicht zuletzt auch der Reitritt zur Europäischen Union haben diese Gefahren in den Hintergrund treten lassen. Auch der Reaktorunfall von Tschernobyl hat entscheidend zu einem Umdenkprozeß beigetragen.", lautet die Begründung des Innenministeriums in seinem Magazin „Öffentliche Sicherheit" vom April 1996.
Auf diesem Hintergrund ist die neue Zivilschutzpolitik abgesiedelt. Als eines der realsten Bedrohungsbilder unserer Tage gilt ein Beaktorun-glück. 87 Kernkraftwerke mit insgesamt 215 Kernreaktoren in Europa geben Anlaß zur Sorge - und zurVorsor-ge. „Sicherheitswohnungen" sollen einen so großen Teil der Bevölkerung wie nur möglich vor den Folgen einer solchen Katastrophe bewahren. „Bei Kernkraftunfällen ist sicherlich kein Schutzraum nötig", meint Helmut Schnitzer, Leiter der Abteilung für Krisen vorsorge und Sicherheitspolitik im Bundeskanzleramt. Schon mit relativ einfachen Mitteln kann jeder Bürger seine private Wohnung zur „Sicherheitswohnung" adaptieren. „Ein allererster Schutz ist", so der Experte, „sich einen gewissen Vorrat an Mineralwasser, Medikamenten und Nahrungsmitteln anzulegen, um im Fall des Falles das Haus oder die Wohnung nicht verlassen zu müssen." Bekanntlich erfolgen 80 Prozent der Strahlenbelastung über die Nahrungsaufnahme.
Durch die zeitgerechte Einnahme von Kaliumjodidtabletten bei einer großräumigen Verstrahlung kann die Aufnahme von radioaktivem Jod in die Schilddrüse verhindert werden und damit ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der Strahlenbelastung erfolgen.
Ein weiterer Schutz gegen das Eindringen radioaktiver Teilchen in das Wohnungsinnere ist das Abdichten der Fenster. Deswegen sollte Klebematerial ebenfalls zu Hause vorrätig sein. Rei modernen, gut dichtenden Fenstern kann damit beispielsweise die radioaktive Dosis bei Durchzug einer radioaktiven Wolke um etwa 80 Prozent reduziert werden.
Eine nahezu hundertprozentige Reinigung der Atemluft bietet schließlich ein Frischluftfilter, den man in die Wohnung einbauen kann. Es handelt sich dabei um ein von „ Voest" -Ingenieuren entwickeltes, von der Tiroler Firma Innova erzeugtes, patentiertes Gerät, welches Außenluft ansaugt, reinigt und in den Wohnbereich bläst. Der dadurch entstehende leichte Überdruck verhindert ein Eindringen verunreinigter Außenluft in den Raum. Die Ausmaße des Filters sind mit 1,20 Meter Länge, einem halben Meter Rreite und 17 cm Tiefe nicht unbedingt gering. Nimmt man das Gerät in Retrieb, so ist mit einer Lautstärke von 56 Dezibel - etwa vergleichbar mit Staubsaugerlärm -zu rechnen. Das sei eben in Kauf zu nehmen, so der Hersteller, Hannes Kögl, dafür habe man gesunde Luft. Der Vorteil einer vollständig adaptierten Sicherheitswohnung ist evident: Bei einem Störfall kann man in der vertrauten Wohnumgebung bleiben und trotzdem geschützt sein.
Die Sicherheitswohnung ist ein spezifisch österreichisches Konzept, das im übrigen Europa keine Entsprechung hat. Wie Johann Wruss, Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Zivilschutzabteilung des Innenministeriums betont, ist sie „besonders günstig für den städtischen Bereich", da hier die Versorgung mit Schutzräumen naturgemäß schlechter ist als auf dem Land.
Die Herstellerfirma setzt auf das Sicherheitsbewußtsein der Österreicher. Pilotprojekte sollen das Konzept bekannt machen. So fährt ein Salzburger Umweltmeßwagen seit einem Jahr mit eingebautem Strahlenfilter herum. Auch ein Tiroler Kindergarten wurde schon zum „Sicherheitskindergarten" adaptiert.
Das jüngste öffentliche Projekt wird in diesen Tagen in Linz durchgeführt. Die Stadt Linz finanzierte die Adaptierung eines Klassenraumes in der Mozartschule zum „Sicherheitsraum". Dabei wurden drei Filter eingebaut. Dies ging Hand in Hand mit der Sanierung des Schule. Laut Auskunft des Magistrates gilt es als „Musterobjekt", dem noch weitere folgen könnten. Dies ist hauptsächlich eine finanzielle Frage: Die Filter kosteten samt Einbau immerhin 150.000 Schil-
Die Frage nach der Finanzierung des Strahlenfilters wird weiterhin ein heikler Punkt bleiben. Der Einbau eines Filters (Kostenpunkt: mindestens 55.000 Schilling) in einen Wohnraum wird bislang nur im Burgenland, in Niederösterreich und in Graz finanziell gefördert. Überhaupt stößt man hierbei auf ganz grundsätzliche Fragen: Denn wer investiert schon gerne in etwas, dessen Verwendung er nicht unbedingt einsieht?
Tatsächlich haben die Österreicher ein recht ambivalentes Verhältnis zur Bedrohung durch radioaktive Strahlen, wie Walter Schwarzl vom Österreichischen Zivilschutzverband weiß. Zum einen begegnet man in Österreich auf Schritt und Tritt der Mentalität, daß man gegen die Folgen eines Reaktorunfalls „eh nichts tun kann". „Ein Drittel der österreichischen Revölkerung hat diese Einstellung", berichtet der Zivilschutzexperte. Ein weiteres Drittel habe das berühmte „schlechte Gewissen", wo zwar immer beteuert werde, daß etwas geschehen müsse, dafür aber weder Zeit noch Geld investiert. „Nur etwa ein Drittel der Bevölkerung ist auf Zivilschutz ansprechbar und daran interessiert", zieht Schwarzl ein eher negatives Re-sume. Das Herankommen an die Bevölkerung stelle die größte Schwierigkeit für die Zivilschutzverbände dar.
Andererseits wird die Gefährdung durch radioaktive Strahlung von den Österreichern sehr wohl wahrgenommen und zählt mittlerweile zu einer ihrer größten Ängste. Die Angst vor einer AKW-Katastrophe kommt gleich nach der Hauptangst der Österreicher, nämlich jener, eine unheilbare Krankheit zu erleiden, an zweiter Stelle. (IM A.S-Umfrage von 1994). Als das Bundeskanzleramt ein Jahr zuvor in einer Studie danach fragte, welches Ereignis Herr und Frau Österreicher ganz persönlich als Katastrophe bezeichnen würden, anworteten 91 Prozent mit „AtomunfaU". Selbst Bedrohungen wie „Krieg in Europa" (88 Prozent), „Weltkrieg" (86 Prozent) oder „Erdbeben" (83 Prozent) wurden als weniger drastisch eingeschätzt.
Dieselbe Studie fragt auch danach, welche Ereignisse zu einer ernsthaften Krise in Österreich führen könnten. 74 Prozent der Bevölkerung antworteten mit „AtomunfaU". Wiederum sind „Weltkrieg" (70 Prozent) und „Krieg in Europa (68 Prozent) erst an zweiter und dritter Stelle bei den Antworten. Und schließlich rangiert, so eine IMAS-Umfrage vom letzten Sommer, das Wort „Kernenergie" ganz unten in der Beliebtheitsskala der Österreicher. Es ist jenes Wort, das den Österreichern nach „Partei", „Ausländer", „Beamtentum" am „unsympathischsten" ist.
Das so propagierte neue Sicherheitskonzept läßt schließlich die Fra ge nach der Rolle der Schutzräume aufkommen. Tatsache ist, daß nur für drei Prozent aller Österreicher funktionstüchtige Schutzräume zur Verfü gung stehen.
Theoretisch gibt es zwar für ein Viertel aller Bürger Schutzraumplätze, allerdings zum Großteil ohne adäquate Einrichtung wie Luftfilter, Türe und so weiter. Österreich liegt mit diesen Zahlen zwar im europäischen Mittelfeld, reicht allerdings längst nicht an die Schweiz heran, welche für 98 Prozent der Bürger Schutzraumplätze zur Verfügung hat.
Von offizieller Seite wird durchaus zugegeben, daß die „Sicherheitswohnung" in technischer Hinsicht kein voller Ersatz für den Schutzraum ist, denn dieser bietet auch Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Die „Sicherheitswohnung" sei nur eine Alternative zur bisherigen Schutzraumpolitik. „Das alte Schutzraumkonzept ist dadurch keineswegs abgelöst, es wird nur erweitert", betont Helmut Schnitzer vom Bundeskanzleramt. In krassem Widerspruch dazu steht jedoch, daß die Schutzraumpflicht mittlerweile in fast allen Bundesländern aus der Bauordnung herausgenommen worden ist.
Sollte das atomstrahlensichere Eigenheim also zum Zivilschutzkonzept der Zukunft avancieren, so wird damit keinem anderen Bedrohungsbild als einem Beaktorunglück Bechnung getragen. Die Einstellung, daß dies die hauptsächliche „reale" Gefahr von heute darstellt, erscheint angesichts des Krieges in unserem Nachbarland antiquiert.
Die Autorin
istfreie Journalistin..
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!