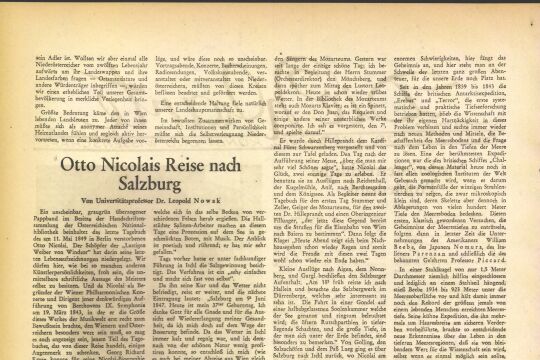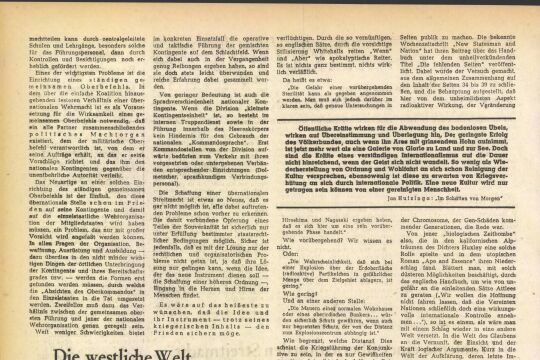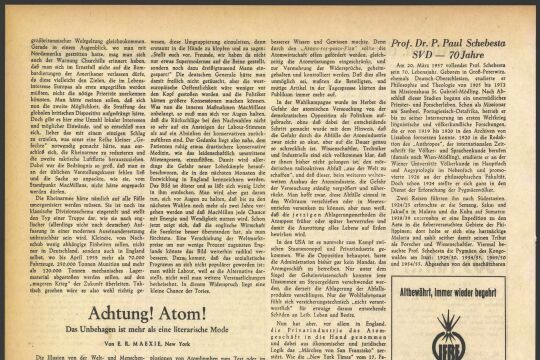Am 1. März 1954 fand im Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean wieder eine Atombombenexplosion statt, wie seit 1946 ähnliche wiederholt durchgeführt worden waren. Bei all diesen Versuchen war es üblich, den Ozean in einem Umkreis von 50 Seemeilen (zirka 93 km) zum Sperrgebiet zu erklären. Alle Fischerboote wurden gewarnt, dieses Sperrgebiet zu befahren. Der Kapitän des japanischen Fischkutters „Fukuryu Maru“ („Glücklicher Drachen“) war besonders vorsichtig und fischte deshalb in einer Entfernung von mehr als 100 Meilen vom Bikini-Atoll.
Bis um 3.40 Uhr am Morgen des 1. März 1954 unterschied sich der „Glückliche Drache“ kaum von den anderen Fischerbooten, die im Pazifischen Ozean ihre Netze auslegen und einholen. Die 25 Mann auf dem kleinen Fischdampfer sahen zur genannten Zeit, wie der dunkle Himmel sich plötzlich erhellte. Sie hatten ähnliche Schauspiele schon mehrmals beobachtet und auch diesmal waren sie nicht beunruhigt, bis — kurze Zeit nach der Explosion — eine graue Asche „wie ein dichtes Schneetreiben“ das Boot umhüllte.
Bald war das ganze kleine Schiff mit einer dichten Schicht dieses Staubes bedeckt.
Obgleich der Kapitän diesen Staub wegkehren und abwaschen ließ, zeigten sich bei der Mannschaft seltsame Krankheitssymptome. Alle Leute fühlten si.h unwohl. Ihre Leiber begannen sich zu röten — auch an jenen Stellen, die der Staub nicht berührt hatte. Der Kapitän befahl, Kurs auf den Heimathafen Jayzu zu nehmen.
Als der „Glückliche Drache“ dort am 14. März itraf, mußte die Besatzung auf Tragbahren vom Boot geschafft werden.
Den Fischern waren in diesen zwei Wochen die Haare ausgefallen, auf ihrer Haut zeigten sich Verbrennungserscheinungen und es bildeten sich Beul' l. Die Mannschaft berichtete, daß „Shinohai“ (Todesasche) vom Himmel gefallen sei, die sie krank gemacht habe.
Die Messungen jr>-'* dem Geigerzähler bestätigten die Ahnung des Kapitäns: das Schiff war in einem ' hen Maß radioaktiv verseucht.
Wenige Tage später sickerte die Schreckensnachricht durch, daß auch die Fische an Bord des „Fukuryu Maru“ radioaktiv seien. Da war es aber vie'fach schon zu spät, sich davor zu schützen.
Die weitere Geschichte der 25 Fischer ist bekannt. Ein Mann, der Schiffsfunker Aikichi Kuboyama, ist bald darauf den Wirkungen der Atomstrahlung erlegen, bei allen übrigen zeigten sich seither mehr oder minder schwere Schädigungen der Leber, der Milz und der Nieren, sowie eine Zersetzung der roten und eine Verminderung der weißen Blutkörperchen. Weitere unheilbare Schädigungen des Organismus werden sich nach Ansicht der Aerzte vielleicht noch später zeigen.
Nach weiteren zwei Wochen — am 27. März — traf in einem anderen japanischen Hafen noch ein Fischerboot ein, dessen Besatzung ebenfalls von radioaktiven Strahlen körperliche Schäden erlitten hatte. Dieses Schiff war am 1. März sogar 12 50 km von Bikini entfernt gewesen.
1250 km — das ist die Entfernung von Wien bis nach Sizilien, nach London, nach Stockholm, nach Charkow, nach Istanbul; das bedeutet also, daß eine einzige derartige Bombe fast ganz Europa verseuchen könnte.
Wie konnte es zur Katastrophe der beiden Fischerboote kommen? Die amerikanischen Atomwissenschafter erklärten verlegen, man habe eine derartig starke Wirkung der Explosion nicht erwartet.
Irren ist gewiß menschlich, selbst wenn die Folgen des Irrtums unmenschlich sind, aber es gab andere Forscher, die an dieser offiziellen Erklärung zweifelten. Man erinnerte sich daran, daß bei einem früheren Versuch mit einer offenbar schwächeren Wasserstoffbombe „eine Insel von 16 bis 19 km Länge und von 8 bis 10 km Breite in wenigen Sekunden buchstäblich weggewischt worden sei“. (Senator Styles Bridges). Die Explosion hatte im Meeresboden einen Krater von 1,6 km Durchmesser und von 55 m Tiefe erzeugt. Diese Millionen Tonnen Gesteins waren in Form von radioaktiver Asche über dem Bikini-Atoll niedergegangen. Diesmal aber hatten sie sich über eine viel, viel größere Fläche ausgebreitet.
War am 1. März 1954 eine neuartige Bombe, etwa eine Superbombe zur Explosion gebracht worden? Die amerikanische Atomenergie-Kommission und der Generalstab gaben auf diese Frage keine Antwort.
Und so begannen mehrere unabhängige Forscher sich mit ihr zu beschäftigen. Die japanischen Wissenschafter kratzten aus den Fugen und Spalten des „Glücklichen Drachen“ Reste der todbringenden Asche zusammen, die sie in ihren Laboratorien untersuchten. Es dauerte viele Wochen, bis es gelang, den radioaktiven Staub bis in die feinsten Bestandteile zu analysieren. Zwei Wissenschafter, der Amerikaner R. E. Lapp und der Engländer J. Rotblat, überprüften jeder für sich, ohne von einander zu wissen, die japanischen Untersuchungsergebnisse. Die Aufgabe, die sie sich vornahmen, war eine wissenschaftliche Detektivarbeit.
Es war die Sensation der Genfer Atomkonferenz im Sommer 1955, daß ein Vergleich der amerikanischen, der britischen und der sowjetischen Berechnungen der Kernspaltungsprozesse aufs Haar identische Resultate ergab. Nein, Haare sind noch viel zu dick, denn die Unterschiede machten nur Millionstelmillimeter aus!
Professor Rotblat und Professor Lapp kamen — wie gesagt, ohne von einander zu wissen — an ihren Schreibtischen ebenfalls zu identischen Ergebnissen.
Aus der Beschreibung des radioaktiven Niederschlags („Fallout“) durch die Atomenergie-Kommission und aus der Angabe, daß die Sprengkraft der Bombe etwa 15 Millionen Tonnen TNT betragen habe, schlössen die beiden Physiker, daß die durch die Explosion erzeugte Radioaktivität 400 Milliarden Curie betragen hatte.
Ein Curie ist die Ausstrahlung eines Gramms Radium. Von der Entdeckung des Radiums bis heute — also in rund 5 8 Jahren — hat man alles in allem nur 1500 Gramm des kostbaren Radiums hervorgebracht. Bei der Explosion am 1. März 1954 waren also radioaktive Stoffe in der Stärke von 40 0.0 0oTonnenRadium erzeugt worden. D*as schien zunächst unvorstellbar. Die japanischen Messungen erwiesen, daß fast die gesamte ungeheure Radioaktivität von Spaltungsprodukten und nicht von Substanzen stammte, die von Neutronen in einer Verschmelzung aktiviert worden wären. Die mächtigste moderne Atombombe konnte aber höchstens 10 Milliarden Curie erzeugen. Wenn man also annahm, daß eine solche Atombombe das Zündmittel für eine Wasserstoffbombenexplosion war, dann mußte diese selbst das Zündmittel für eine weitere, noch ungeheuerlichere Spaltung gewesen sein. Man hätte hierzu fast eine halbe Tonne von dem seltenen Uran 23 5 benötigt — ein Quantum, das mindestens 50 Millionen Dollar kosten mußte — und das zudem weitaus größer als die „kritische Menge“ war. Man hätte also diese Masse U-235 nie in einen Behälter verpacken können. Die viel billigere und allgemein vorkommende Art von Uran (eine halbe Tonne U-238 kostet nur 20.000 Dollar) wird hingegen von den langsamen Neutronen, wie sie in einer Kernspaltung entstehen, nicht gespalten.
Die schnelleren Neutronen mit Energien von mehreren Millionen Elektronvolt, die in einem Kernverschmelzungsprozeß frei werden, sind sehr leicht imstande, U-238 zu spalten.
Rotblat und Lapp kamen also — jeder für sich — zum Schluß, daß die Bikini-Bombe vom 1. März 1954 aus einem Plutonium-Zünder, einer Hülle aus Lithiumdeuterid für die Ver-schmelzungsreaktion und einer Schale aus U-23 8 bestanden haben müsse.
Durch die .Explosion am 1. März 1954 wurde wieder eine ganze Insel zerstäubt und es wurden zugleich alle Trillionen Staubkörnchen mit einer Schicht von radioaktiven LIran-Atomen überzogen, die dann als Todesasche auf den „Glücklichen Drachen“ und — natürlich zerstreut — auf weite Gebiete unseres Erdballs herabfielen.
Die amerikanische Atomenergie-Kommission hat vor kurzem behauptet, daß „alle bisherigen Atombombenversuche jeden einzelnen Menschen keiner größeren Strahlung aussetzten, als er sie bei einer einzigen Bruströntgendurchleuchtung erhalten müßte“.'
Professor Rotblat meint dazu, daß „der größte Teil dieser Strahlung von den wenigen Wasserstoffbomben stammen müsse, die vor einem Jahr erproht wurden. Das bedeutet also, daß ein Jahr Atombombenversuche im gegenwärtigen Maßstab die vorhandene natürliche Strahlungsstärke ungefähr verdoppelt.“ Dabei sind es nicht die Amerikaner allein, auch die Russen und die Briten veranstalten derartige Versuche mit Wasserstoffbomben. Nach dem russischen Wasserstoffbombenversuch im November 1955, der in einer zentralasiatischen Wüste stattfand, konnte man u. a. in Paris — also in mindestens 5000 km Luftlinie Entfernung — eine verstärkte Radioaktivität der Luft feststellen.
Zur unmittelbaren Spreng- und Feuerwirkung der Superbombe kommt die tödliche Radioaktivität, wie sie die japanischen Fischer am eigenen Leib verspürten; Professor Lapp erwähnt noch „eine dritte, bisher nicht völlig erschlossene — die giftige Wirkung des radioaktiven Strontiums. Dieses dem Kalzium verwandte Element, das bei der Kernspaltung entsteht, hat eine Halbwertzeit von 28 Jahren (das bedeutet, daß es erst nach 28 Jahren die Hälfte seiner Radioaktivität verliert!). Strontium zielt seine Wirkung auf die Knochen, d. h. es versteckt sich im Knochengewebe und wirkt dort als ein zerstörendes Gift; eine winzig kleine Prise dieser Substanz, über einen Quadratkilometer verstreut, genügt, um bei Menschen und Tieren, die mit Strontium verseuchte Nahrung zu sich nehmen, Knochentumore hervorzurufen“.
Professor Rotblat meint abschließend, daß die Wasserstoff-Uran-Bombe vom 1. März 1954 „in mehrfacher Hinsicht noch bösartiger als die Kobaltbombe ist“.
'Bei den Luftmanövern der NATO-Luftstreit-kräfte, die im Juli 195 5 über Westeuropa stattfanden, „galt die Annahme, daß Flugzeuge innerhalb von fünf Tagen rund 335 Atombomben auf das europäische Festland abwarfen, die meisten davon auf deutsches Gebiet.“ (Cay Graf Brockdorff, Korrespondent der United Press.) Wenn einmal von diesen 3 35 Atombomben nur 5 als Superbomben über Europa zur Explosion gebracht werden, dann „würden riesige radioaktive Wolken ganze Nationen mit ihrem giftigen Nebel zudecken. Es wäre angesichts dieser Tatsache unverantwortlich, die Menschheit vor den ihr drohenden Gefahren nicht zu warnen, es wäre so, als ließe man einen Blinden ungehindert auf einen Abgrund zuschreiten.“ (Lapp).
Trotz aller Geheimhaltung ist das Geheimnis der Superbombe gelöst worden. Die Katastrophe des „Glücklichen Drachen“ am 1. März 1954 sollte uns die Augen geöffnet haben. Seit jener Zeit liegen mehr als 400.000 Tonnen Todesasche in der Luft. Man darf sie nicht durch weitere Bombenversuche noch mehr verpesten.