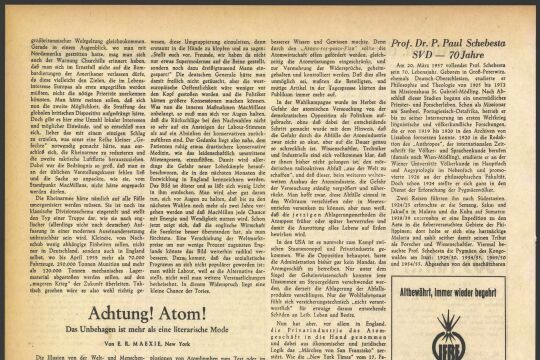"Eine unvorstellbare Hypothek"
Nach dem Supergau von Tschernobyl wurde im grossen Stil verleugnet, vertuscht und hinuntergespielt. Noch heute streitet die UNO mit Umwelt- und Gesundheits-NGOs über die wahren Folgen der Katastrophe.
Nach dem Supergau von Tschernobyl wurde im grossen Stil verleugnet, vertuscht und hinuntergespielt. Noch heute streitet die UNO mit Umwelt- und Gesundheits-NGOs über die wahren Folgen der Katastrophe.
"Wir bemerkten, dass das Gras abnormal dicht und grün war. Die Hühner im Hof legten ungewöhnlich viele und übergroße Eier. Am nächsten Tag lagen alle Küken tot in der Wiese. Wir sahen neugeborene Kätzchen, eines davon mit zwei Köpfen, andere völlig kahl. Wir beobachteten Vögel, die mitten im Flug vom Himmel fielen." Bei diesen Szenen direkt vor ihrem Auge stieg in Natalija Tereshchenko zum ersten Mal Angst auf. Die damals 35-jährige Laborärztin wurde wenige Tage nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl dazu abkommandiert, in der Todeszone ihren Beitrag zu leisten. Sie musste die Liquidatoren untersuchen, die zu Aufräumungsarbeiten in den Reaktor geschickt wurden. 32 Tagen später hatte sich auf ihrer Hand ein Geschwulst gebildet, die Verstrahlung hatte ihr Nervensystem geschädigt, ihr Hals Verbrennungen erlitten. Bis heute muss sie starke Medikamente nehmen.
Im Gegensatz zu den geschätzten 600.000 bis 800.000 Liquidatoren ist Tereshchenko noch "glimpflich davon gekommen". Bis heute wird darüber gestritten, wie viele Menschen in Folge des Supergaus tatsächlich gestorben oder erkrankt sind. Von 62 Toten und 4000 Krebserkrankungen sprechen UNO und Weltgesundheitsorganisation, von hunderttausenden Toten hingegen Gesundheits-und Umwelt-NGOs wie Greenpeace oder Ärzte gegen Atomkrieg.
30 Jahre danach ist man in Tschernobyl noch immer mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass selbst die Enkelkinder von Liquidatoren ein signifikant höheres Krankheitsrisiko tragen, da die verursachten Genschäden vererbt werden. "Tschernobyl-Aids" wird das genannt, 70 Prozent aller Kinder in der Region leiden darunter und können bereits an einem Schnupfen sterben. Die Chemotherapie für ein Kind kostet aber monatlich 1250 Euro - in der Ukraine eine unleistbare Summe. "Bei Leukämie und Schilddrüsenkrebs ist die Krankheit klar auf die Radioaktivität rückführbar, bei allen anderen Krankheiten nicht", weiß Christoph Otto, Leiter des Hilfsprojekts "Tschernobyl-Kinder" von Global 2000. "Man hatte sogar die Chuzpe zu behaupten, die Krankheiten wären psychisch bedingt, weil die Leute Angst vor Radioaktivität haben", greift er sich an den Kopf. Die Weltgesundheitsorganisation mache bei dem Spiel mit, weil sie offiziell alle Krankheitsfaktoren weltweit untersuchen darf - außer die Folgen von Atomkraft.
VERLEUGNUNG ALS STRATEGIE
Verleugnen, verdrängen, herunterspielen - nach der Reaktorexplosion in Fukushima im Jahr 2011 erinnert das Abstreiten jeglichen Zusammenhangs zwischen atomarem Supergau und Todesopfern an den Umgang mit der Katastrophe von Tschernobyl 25 Jahre zuvor. In beiden Fällen steht der schwerste Teil noch bevor: Die Entsorgung und Endlagerung des hochradioaktiven Materials, das eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren aufweist. "Die geschmolzenen Brennelemente sind noch da und niemand weiß, wie man das je wegbekommt", berichtet Reinhard Uhrig, Atomexperte für Global 2000. "Bisher sind sämtliche Aufräumungsversuche gescheitert, weil die hohe Radioaktivität selbst Roboter funktionsunfähig macht", weiß Uhrig. Ein internationales Untersuchungs-Team wurde in Fukushima genauso wie in Tschernobyl nicht zugelassen. Indessen behaupten Befürworter der Atomenergie immer noch, diese wäre beherrschbar. So meint auch Gerald Mackenthun, der 2011 ein Pamphlet gegen die Abschaltung deutscher Kernkraftwerke veröffentlichte, die nukleare Stromerzeugung sei die "sicherste und umweltschonendste, die es gibt" - trotz Tschernobyl und Fukushima?"Atomkraftwerke sparen jedes Jahr soviel CO2 ein, wie der gesamte Verkehrssektor emittiert", argumentiert er. Fakt ist aber, dass heute nur schwer zu berechnen ist, wieviel CO2 ein AKW vom Bau bis hin zum Transport und zur Endlagerung des Atommülls verschlingen wird. Mackenthun holt sogar noch weiter aus: "Fukushima könnte Anlass sein, die Atomkraft zu lieben: Man stelle sich einen Reaktor vor, dann lasse man ein Mega-Erdbeben drüberlaufen, dann noch einen Jahrhundert-Tsunami. Und dennoch ist niemand an der radioaktiven Freisetzung gestorben."
"nicht signifikant mehr tote"
Zynische Worte angesichts der Schicksale der Opfer? Ein UNSCEAR-Bericht aus dem Jahr 2014 kam zu dem überraschenden Ergebnis, der japanische Atomunfall würde nicht zu "signifikant mehr Krebstoten" führen. Wie kann das sein, wo doch wissenschaftlich bewiesen ist, dass jede noch so kleine Dosis von Radioaktivität mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht? Mehrere zehntausend zu erwartenden Krebsfälle in Folge von Fukushima als "nicht signifikant" zu bezeichnen, hält die Ärzteorganisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs) für skandalös: "Die Autoren versuchen auf Basis fragwürdiger Annahmen, selektiver Stichproben und geschönter Strahlendosen die industriegefällige Botschaft zu streuen, dass man in Fukushima noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen sei."
Weltweit 434 Atomreaktoren hängen noch immer am Netz, die ursprünglich auf eine Betriebsdauer von 30 Jahren ausgerichtet waren. 80 Prozent davon sind laut Global 2000 über 20 Jahre alt, 30 Reaktoren gar über 40 Jahre alt. "Selbst nach Abschalten eines Reaktors müssen die Brennelemente noch drei bis vier Jahre gekühlt werden, bis sie in Trockenbehälter verlegt und in Stahlbetonhallen 30 bis 40 Jahre gelagert werden können", weiß Uhrig. Wie eine sichere Endlagerung aussehen soll, wisse derzeit niemand. Es gibt über hundert radioaktive Stoffe - von den meisten wissen wir noch nicht, wie sie wirken. Es ist auch nicht bekannt, wie die Biologie damit umgeht im Laufe der Zeit - manche Tier- und Pflanzenarten rund um Tschernobyl passen sich an, andere mutieren oder sterben.
Das Risiko, dass sich in den kommenden 27 Jahren eine atomare Katastrophe im Ausmaß Tschernobyls - oder sogar schlimmer - ereignet, liegt jedenfalls bei 50 Prozent. Auf diese Zahl kamen Forscher der Technischen Hochschule in Zürich und der Universität Aarhus in Dänemark, die sämtliche AKW-Havarien analysierten, die von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) verschwiegen wurden. "Es werden noch tausende Generationen von Nachkommen unsere Zeit verfluchen, weil wir ihnen diese unvorstellbare Hypothek hinterlassen, sie auf dieses Teufelszeug Acht geben müssen und bestimmte Regionen nicht betreten können", ist sich Uhrig sicher. Dass die Gegend um Tschernobyl in 240.000 Jahren wieder plutoniumfrei sein wird, ist wohl kein Trost.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!