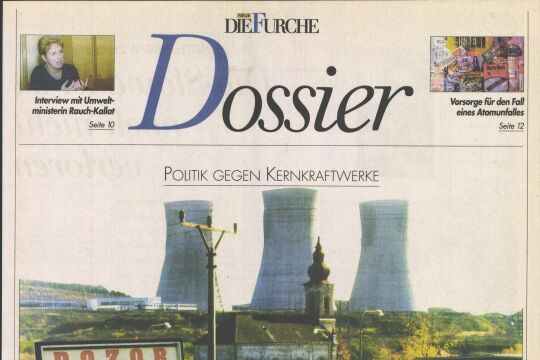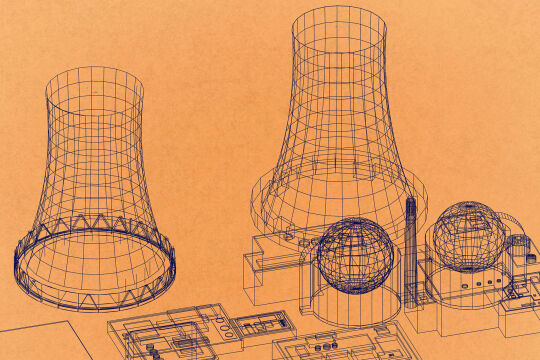Selten ist ein Desaster der Republik so beeindruckend. Zwei kubische Blocks, grauer Beton, verwitternde Fassade. Ein schlanker Schlot, höher als der Turm vom Wiener Rathaus, völlig unvermittelt in der flachen Landschaft. Doppelt eingezäunt mit Stacheldraht. Und zwei Steinwürfe entfernt bringen die Ausflugsschiffe der Donau-Dampfschifffahrt ihre Passagiere in die Wachau. Manche von ihnen recken neugierig die Köpfe nach dem Koloss am Ufer.
Wer vor Österreichs größtem Milliardengrab steht, den überkommen undefinierbare Gefühle. Interessierte, ängstliche, euphorische. Aber immer respekteinflößende. Denn der Koloss am Ufer ist ein Atomkraftwerk. Ein neutraler Blick auf den mächtigen Bau wird deshalb den wenigsten gelingen. Bilder von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl mischen sich in die Gedanken, oder Erinnerungen an verstrahlte Champignons und radioaktive Wildschweine. Vielleicht auch die Frage: Was wäre gewesen wenn? Wenn dieses AKW in Betrieb gegangen wäre, keine 35 Kilometer Luftlinie vom Wiener Stephansplatz entfernt.
Das AKW Zwentendorf ist das einzige Kernkraftwerk der Welt, das vom ersten Reaktor bis zum letzten Kontrollcomputer fertig gestellt wurde, aber nach einer Volksabstimmung nie in Betrieb ging. 14 Milliarden Schilling (rund eine Milliarde Euro) hatte der Bau des Kraftwerks gekostet. Und die Volksabstimmung am 5. November 1978, die war nicht nur eine über den Einstieg Österreichs in die Atomenergie. Sondern letztlich vor allem eine über politische Weltanschauung und soziale Zugehörigkeit. Und über einen amtierenden Bundeskanzler.
Eiskalte Dusche
"Zuerst bauen und dann schauen, ob es in Betrieb geht. Eine recht österreichische Lösung", sagt Stefan Zach, schwarze Funktionsjacke, Schnurren über das AKW aus dem Handgelenk. Neben dem Reaktorgebäude hat er sich ein kleines Büro eingerichtet, davor steht eine lebensgroße Puppe mit Helm und gelbem Schutzanzug. So einen hätte auch der "Einschalter" von Zwentendorf getragen. Im Büro hängen gerahmte Sticker. "Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern", steht auf einem, "Steinzeit? Nein Danke" auf einem anderen. Die Aufkleber, erklärt Zach, haben die bereits angestellten Atomtechniker einst auf Tür und Wand der Betriebsküche geklebt. Über ihren Fortschritt ließen sie in den Siebzigern nichts kommen.
Stefan Zach ist Pressesprecher des niederösterreichischen Energieversorgers EVN, der die Industrieruine vor Jahren gekauft hat. Inzwischen hat man Sonnenkollektoren auf ihr Dach gebaut und vermarktet das verhinderte Atomkraftwerk als "Symbol für eine erneuerbare Energiezukunft". Vor allem deutschen Kerntechnikern diente das Reaktorgebäude über Jahre als Trainingszentrum -in der Bundesrepublik gab es fünf typengleiche AKWs. Zwischendurch vermietet man die Hallen für Firmenfeiern und Seminare, oder überlässt das Gelände der freiwilligen Feuerwehr und Polizeieinheiten für Einsatzübungen. Auch die Kulturbranche hat den seltsamen Ort für sich entdeckt. In den Räumen fanden Lesungen, Filmund Werbeproduktionen statt, die Musikfestivals Nuke, Tomorrow und Shutdown nutzten das weitläufige Kraftwerks-Gelände.
Wenn Stefan Zach durch das verwaiste AKW führt, dann geht es in enge Gänge im typischen blassgelb der 70er-Jahre, mit Neonröhren und Linoleum-Boden. Durch geduckte Maschinenhallen und vorbei am Waschraum mit Geigerzähler. Die Original-Schutzanzüge und Dienstunterwäsche hat man für Besucher über die Waschbecken gehängt. "Nach der Arbeit hätte man mit eiskaltem Wasser duschen müssen", sagt Zach. Denn warmes Wasser öffnet die Poren, so wäre Radioaktivität unter die Haut gelangt. 1050 Räume hat das AKW, aber kein einziges Fenster. Dazwischen schwere Türen aus Beton und Ausblicke in Hallen, so weitläufig wie der Hauptplatz einer mittleren Großstadt. Der Kontrollraum hinter orange gerahmten Glastüren scheint einer Sci-Fi-Serie der 1970er entsprungen. Bunte Knöpfe, dicke Röhrenbildschirme, analoge Regler und Anzeigen. Im Jahr 1978 war das die Zukunft. Irgendwo zwischen Hauptquartier eines James-Bond-Bösewichts und Raumschiff Enterprise.
"Wertvoller" Atomabfall
Im Reaktorraum dagegen, dem Herz jedes Atomkraftwerks, steht eine Plattform. Besteigt man sie, blickt man hinab in des Pudels Kern: Zehn Meter darunter beginnt das Reaktorbecken, nochmal zehn Meter tiefer wären die Brennstäbe in den Reaktor eingesetzt worden. In jenen Ort also, an dem in AKWs die Kernspaltung stattfindet. Und wieder bleibt undefinierbar, was genau man in diesem Moment empfindet. Neugier? Respekt? Angst? "Wenn du ganz allein hier drin bist", sagt Zach, "dann hat das schon so etwas wie Grabesstimmung".
Dass in den gigantischen Hallen des AKW heute gespenstische Stille herrscht statt solider Betriebsamkeit, dafür sorgten Leute wie das Ehepaar Althann. Zwischen dem Atomkraftwerk und ihrem Schloss liegt nicht mehr als ein kleiner Spaziergang. Direkt neben dem Hauptplatz und der kleinen Kirche steht es, Spätbarock, Türmchen an den Seiten, gestrichen in Schönbrunner Gelb, mit grünen Fensterrahmen und Stuck an der Fassade. Und beim Eingang, wo sich Wilder Wein über die Säulen schlängelt, wartet schon die Gräfin und sagt: "Damals hatten wir überall diese Anti-Atomkraft-Pickerln." Dann führt sie hinauf ins Esszimmer, vorbei an barocken Vasen und einem Porträt von Karl dem Sechsten, oben Stilmöbel und Perserteppiche über knarrenden Parkettböden. "Wir wurden ja ausgelacht", sagt Maria Althann, Lodenweste, freundliches Lächeln, gepflegtes Deutsch. "Der Abfall sei bei der Atomkraft das Wertvollste von allem, haben sie uns gesagt."
"Böse, grüne Großgrundbesitzer"
In der Tat war der Wissensstand der Bevölkerung über Atomkraft im Österreich der 1970er äußerst gering, um die ungelösten Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle wussten nicht allzu viele. "Frau Gräfin, Sie sind Opfer kommunistischer Propaganda", habe einer der Verantwortlichen einmal zu ihr gesagt, als sie darauf hinwies, dass ein AKW auch im Normalbetrieb radioaktive Stoffe an die Umwelt abgebe, erzählt Althann. Sie und ihr Mann Alexander, Graf und gelernter Land-und Forstwirt, standen vor der Volksabstimmung auf entgegengesetzter Seite der Atomindustrie. Schon während der Siebziger planten sie, die seit Jahrhunderten im Familienbesitz stehenden Böden auf biologische Landwirtschaft umzustellen. "Wir waren die bösen, grünen Großgrundbesitzer", sagt Althann. Das Ehepaar stand bei seinem Einsatz gegen das AKW allerdings vor einem ganz besonderen Dilemma: Den Grund, auf dem das Kraftwerk errichtet wurde, hatte zuvor ausgerechnet der Vater des Grafen für einen beträchtlichen Geldbetrag an die AKW-Betreiber verkauft. "Er hat sich damals nicht viel mit der Thematik beschäftigt", sagt Alexander Althann.
Über die Frage nach einem österreichischen Einstieg in die Atomkraft ging damals nicht nur ein Riss durch viele Familien, sie spaltete auch große Teile der heimischen Öffentlichkeit. Die SPÖ-Alleinregierung unter Kanzler Bruno Kreisky genoss in ihrem Pro-Atomkraft-Kurs Unterstützung von Gewerkschaft, Industrie und Handelskammer. In der Bevölkerung befürwortete vor allem der Mittelstand das AKW -während sich in sozioökonomisch schwächeren wie auch in akademischen Milieus die Atomkraft-Gegner formierten. Die Abstimmung wurde aber ohnehin zu deutlich mehr als einer Frage über Österreichs Energiezukunft. Denn Kreisky hatte die Volksabstimmung in Erwartung eines positiven Ausgangs angesetzt. Für den Fall eines "Nein" zum AKW kündigte er seinen Rücktritt an. Ein Geschenk für seine politischen Gegner, die ihre Chance witterten: Fortan mobilisierten nicht nur ÖVP und FPÖ gegen das AKW - sondern auch bürgerlich-konservative Atomkraft-Anhänger, die den roten Sonnenkönig stürzen wollten.
Rückenwind für die Au
Am 5. November schließlich sprachen sich 49,63 Prozent für und 50,47 Prozent gegen die Inbetriebnahme des Kraftwerks aus. Nicht einmal 30.000 Stimmen sollten Österreichs Einstieg ins Atomzeitalter beenden, bevor es begonnen hatte. Die historischen Konsequenzen sind bekannt: Kreisky blieb entgegen seiner Ankündigung im Amt, das Parlament beschloss noch im Folgemonat das Atomsperrgesetz, das künftig den Bau von AKWs ohne vorherige Volksabstimmung verhinderte. Und während Kreisky bei der folgenden Nationalratswahl sein bestes Ergebnis erzielte, hatte die sich gerade formierende Grün-Bewegung frühen Rückenwind erhalten -den sie später für die Besetzung der Hainburger Au nützte.
"Wir haben damals gelernt", sagt Graf Althann, "wenn man sich für oder gegen etwas engagiert, kann man das sogar in Österreich durchsetzen." Am Weg hinaus aus dem Schloss führt er noch vorbei an einer historischen Landkarte mit dem Grundbesitz der Familie, gezeichnet im Jahr 1715. All die grünen Gründe, weitergegeben über Generationen, plötzlich bedroht von radioaktiven Emissionen? Von einem Atommeiler praktisch vor der Haustür? Ein Glück, dass die Österreicher im November 1978 entschieden, wie sie eben entschieden.
Die andere Seite der Geschichte von Zwentendorf, die erzählt einer an einem herbstlichen Nachmittag im Arbeiterbezirk Floridsdorf, am Stadtrand von Wien, nahe der Wagramer Straße mit ihren Tschocherln, Pfandleihern und Nagelstudios. Peter Zachoval sitzt im Gasthaus "Schabanack", rustikale Holzstühle, deftiges Essen, Nippes-Elefanten über den Tischen, und sagt: "Naja, irgendwo muss der Strom halt herkommen." Er sei auch heute noch Befürworter der Atomkraft. "Aber eben nach westlichen Standards, nicht nach osteuropäischen wie in Tschernobyl."
Potemkinʼsches Dorf
Zachoval, Schnauzbart, zwei Ohrringe, vor kurzem 70 geworden, arbeitete als junger Mann für das AKW Zwentendorf -so wie insgesamt 200 Angestellte, für die mit dem Volksentscheid des Jahres 1978 eine kleine Welt zusammenbrach. Kerntechniker und Ingenieure waren bereits monatelang im Ausland ausgebildet worden, als sie am Abend des 5. November realisierten, dass es für sie in Zwentendorf keine Zukunft geben würde. Zachoval selbst hatte an der Planung für die Lagerung des Atommülls mitgewirkt. "Es gab die Idee, ein Zwischenlager über Tage in Niederösterreich oder der Steiermark zu bauen", sagt er.
Nach dem Volksentscheid startete in Zwentendorf ein Konservierungsbetrieb -und hielt noch einige Jahre an. Man erhoffte zunächst, das Kraftwerk später doch in Betrieb nehmen zu können. Das AKW wurde zum potemkinʼschen Dorf, die verbliebenen Mitarbeiter führten einen zermürbender Arbeitsalltag in einer Zwischenwelt. Zachoval war zu diesem Zeitpunkt bereits in seinen alten Job in einer Engineering-Firma zurückgekehrt. Ein Teil der einstigen Belegschaft plante danach den Kohle-Gas-Meiler Dürnrohr, der als Ersatz für Zwentendorf gebaut wurde, andere gingen nach Deutschland. Und die Betreibergesellschaft? Während einer der damaligen Geschäftsführer sich fortan erneuerbarer Energie widmete, beging der andere Suizid. Heute liegt der Anteil der Kernkraft-Gegner in Österreich jenseits der 90 Prozent. Auch die unumstrittensten Erzählungen haben mindestens noch eine zweite Seite.