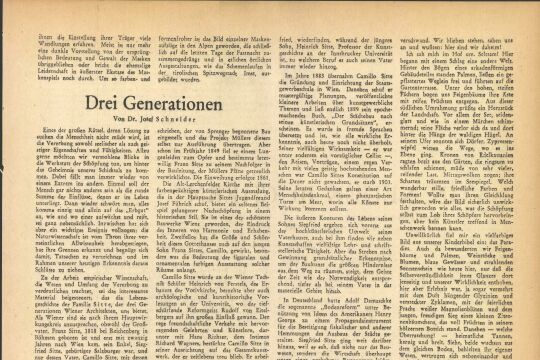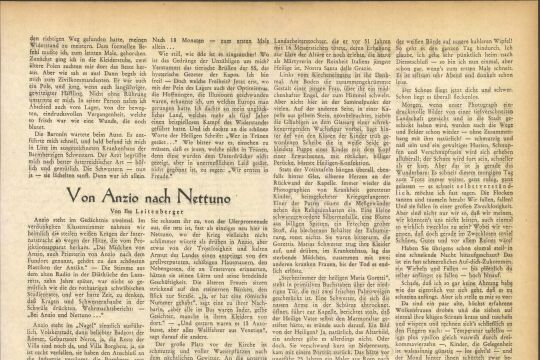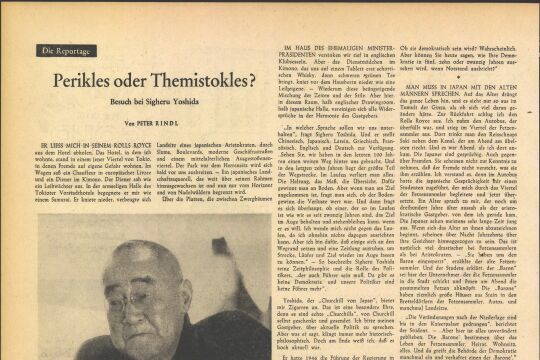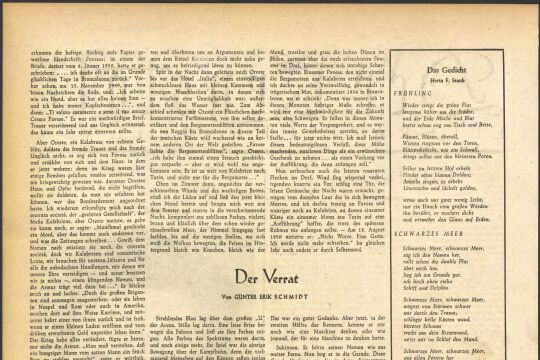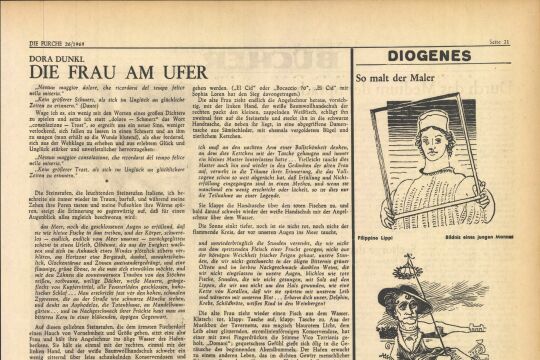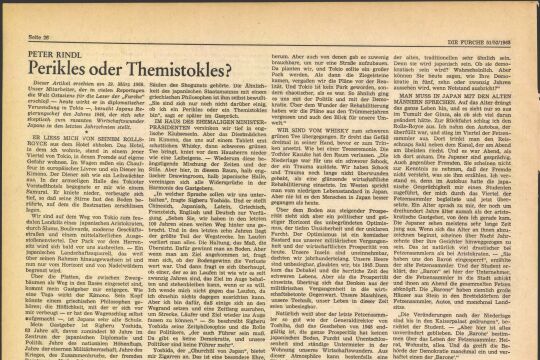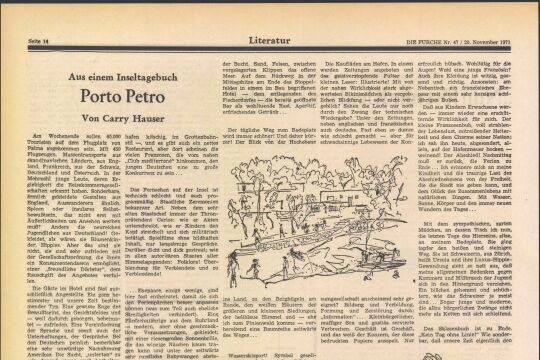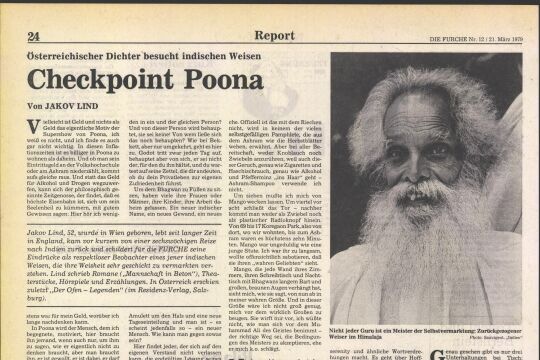Roher Fisch, in Zucker kandiert
Platz sparen ist oberstes Gebot im dicht besiedelten Japan. Ob im Zug, im Hotel oder in privaten Wohnungen: Wer dieses Land besucht, muß lernen sich anzupassen.
Platz sparen ist oberstes Gebot im dicht besiedelten Japan. Ob im Zug, im Hotel oder in privaten Wohnungen: Wer dieses Land besucht, muß lernen sich anzupassen.
Eine Stunde mit dem Schnellzug dauert die Fahrt vom Flughafen Narita bis Tokyo eki, jenem Bahnhof, an dem täglich eine Million Menschen ankommen und abfahren. Die Reise beginnt unspektakulär: niedrige Häuschen wohin das Auge reicht. Keine geschwungenen Dächer, nichts Japanisches.
Oder doch? Winzige Gärten, winzige Bäumchen. Dann werden die Häuser höher, erreichen Wolkenkratzerausmaße. Viele Fronten sind verspiegelt, und was sie spiegeln, sind wieder Häuser. Wer in Tokyo Station aussteigt, braucht erst einmal gute Nerven, findet er sich doch in einem wimmelnden Menschenmeer, wenig Frauen, dafür umso mehr Herren, alle im dunklen Anzug, weißen Hemd und Krawatte, mit Aktenkoffer und, ab Mai, Regenschirm.
Japan hat sieben Monate ein kontinentales Klima, doch gegen Ende Mai schlägt es auf tropisch um. Ehe der Monsun mit sintflutartigen Regenfällen einsetzt, tragen die Frauen alle Kleidungsstück die man nicht waschen kann, in die Putzerei, weil selbst der kleinste Suppenspritzer zum Nährboden von Schimmel wird. Im Nationalmuseum in Tokyo ist ein ganzer Raum jenen Kimonos vorbehalten, die in der Zeit vor der Erfindung der Klima-Anlage Kühlung verschaffen sollten. Sie waren aus einem duftigen Baumwoll-Leinen Gemisch gewebt und sollten auch durch ihre Farben und Muster psychologisch Kühlung verschaffen: ein zartes Blau, Apfelgrün, Zitronengelb, bestickt mit Blüten, Bäumen, Fischen.
Heute gibt es kaum ein städtisches Haus und schon gar kein öffentliches Gebäude ohne Klima-Anlage. Überall zieht und bläst es viel zu kalt, Halsschmerzen sind vorprogrammiert. Die Japaner sind Technik-Begeisterte. Drei von vier besitzen ein Handy. Telefonieren in der Öffentlichkeit scheint eine Lieblingsbeschäftigung. Viele haben einen Schrittzähler in der Tasche. Er gibt an, wie viele Schritte sie jeden Tag tun, rechnet das um in Kilometer und sagt auch gleich, wie viele Kalorien verbraucht wurden.
Japans Züge sind die schnellsten und pünktlichsten der Welt. Es ist ein Vergnügen, im Shinkansen-Superexpreßzug von Tokyo nach Kyoto zu sausen. Da werden über 500 Kilometer in weniger als drei Stunden zurückgelegt, und das Benehmen des Schaffners versetzt den Reisenden in einen Traum, so höflich, sanft und lächelnd wird er um die Fahrkarte gebeten. Wenn auf der Strecke auch Städtenamen ausgerufen werden, Odwara, Mishima, Shizuoka, Nagoya, sieht man nie eine Stadtgrenze. Auf eine Entfernung wie von Innsbruck nach Wien erstreckt sich ein geschlossenes Siedlungsgebiet.
Allein im Großraum Tokyo leben 20 Millionen der 130 Millionen Japaner, im Unterschied zu anderen Ballungszentren der Erde aber ohne jedes Chaos, Organisation ist eine Stärke der Japaner. Warum aber dieser Ballungsraum? Japan ist nicht klein, die Gesamtfläche beträgt 370.000 Kilometer (ein Viertel größer als Italien). Doch 72 Prozent sind gebirgig; poröses Lavagestein erlaubt dort das Bauen nicht. Daher das Gedränge in den wenigen Ebenen, vor allem auf der Hauptinsel Honshu.
Platz sparen ist oberstes Gebot: selbst in guten Mittelklassehotels sind die Naßzellen - als Badezimmer kann man sie nicht bezeichnen - so klein, daß man sich kaum umdrehen kann. Wie halten die Japaner ihr räumliches Beengtsein aus? Zum einen sind sie durch ihre Erziehung auf Rücksichtnahme gedrillt. Niemand redet laut oder schreit. Ansprüche an Lebensqualität, zum Beispiel Naherholungsräume, gibt es nicht. Aber da sind Tausende von Badeorten, wo heiße Quellen zur Entspannung einladen. Und dann gibt es überall das "ryokan", das traditionelle japanische Hotel, in dem ausländische Besucher ohne japanische Begleitung höflich abgewiesen werden, aus Furcht, sie könnten ohne Sprachen- und Sittenkenntnisse die einheimischen Gäste durch zu viele Regelverstöße verschrecken. Im ryokan verläßt der Japaner seine äußerlich so amerikanisch-europäische Welt.
Das beginnt bereits damit, daß in der Eingangshalle der meist ein-, höchstens zweistöckigen Holzhäuser eine Reihe Pantoffeln stehen. Die Höflichkeit gebietet, die Schuhe mit den Spitzen zum Ausgang zu stellen, das bedeutet Bescheidenheit. Frauen im Kimono verbeugen sich tief, führen durch lange stille Gänge.
Eine Stufe führt zu einem Raum, dessen Boden mit Reisstrohmatten ausgelegt ist. In dieses Zimmer geht man nur in Strümpfen oder Socken. Ein großer, niedriger Tisch, etwa 25 Zentimeter hoch, auf dem Boden Polster, an die Rückenlehnen angenäht sind, ein Blumengesteck, an einer Wand ein Rollbild mit schönen Schriftzeichen. Man öffnet die mit Reispapier bespannten Schiebetüren zum Garten, nachdem man einer Dienerin, die auf den Knien verharrt, die gewünschte Zeit zum Abendessen gesagt hat.
Der Blick in den Garten führt in die andere Welt Japans, jene der Stille, der kleinen gewölbten Steinbrücken über Teiche, in denen Zierkarpfen schwimmen, Lotosblüten rosa, weiß und dunkelrot leuchten, Bonsai-Bäumchen von der hohen Gärtnerkunst künden, Glühwürmchen schwirren und der Vollmond den formvollendeten Kegel des Berges Fuji in ein silbernes Licht taucht.
Badefreuden winken. Nach dem Abendessen, das knieend und unter Zuhilfenahme von Dutzenden Schälchen und Tellerchen im Zimmer serviert wird, verläßt der Gast dieses kurz, damit sein Bett auf dem Boden hergerichtet werden kann: Futons, dicke Matratzen, ein Kissen, das mit knisterndem Buchweizen gefüllt ist: eine japanische Nacht beginnt.
Vorurteile und Klischees Es ist schon seltsam, wenn man im schönen Sommerkleid, plötzlich die Schuhe ausziehen muß, um einen mit Tatami-Matten ausgelegten Speiseraum zu betreten, in dem sechs würdige Herren in dunklen Anzügen an einem langen niedrigen Tisch auf Kissen hocken, sich erheben, statt die Hände zu schütteln, ihre Visitenkarten zücken, und dann sieht man ihre Füße, die auch nur in Socken stecken. Ein richtiges japanisches Diner hat einen Zeremonienmeister. Er verbreitet Würde, indem er mit klarer Stimme ankündigt, was zu tun ist. Der Gast macht einfach (als wäre das so einfach!) alles nach. Man erhebe das Glas: "Kampai, kampai!" Prost! Wie sitzt eine Europäerin stundenlang auf den Fersen? Sie plumpst schon mal seitlich auf den Po und versteckt ihre Beine unter dem niedrigen Tisch, zumal, wenn sie sich anstrengen muß, tapfer zu essen, nicht wissend, ob das, was vor ihr steht, süß oder sauer sein wird, ja nicht einmal, ob es heiß oder kalt ist: roher Fisch, in Zucker kandierter Fisch, Fisch auf eisgekühlten Nudeln.
Dann wird vor jedem Gast ein kleiner Keramikuntersatz aufgestellt, in dessen Innern eine Kerze brennt. Auf den Untersatz kommt ein Schälchen mit Wasser. Anmutig kniet sich eine japanische Kimono-Dame neben die unwissende Person aus Europa und zeigt, was zu geschehen hat: Scheiben von rohem Tintenfisch sind mit Stäbchen ins kochende Wasser zu halten, ganz kurz, dann in Täßchen mit Sauce zu tunken ... Die Konsistenz erinnert an Gummi, der Bissen wird immer größer im Mund ... Der Gastgeber bemerkt, daß die Prozedur Mühe macht und lädt für den folgenden Abend zu einem französischen Essen ein.
Da sitzt die Gruppe also wieder, diesmal auf westlichen Stühlen und die Japaner essen mit größter Selbstverständlichkeit, souverän Messer und Gabel gebrauchend, Dinge, die für sie so exotisch sind wie für den Europäer ihre Speisen: Brot, das es auf ihrem Speisezettel nicht gibt (man frühstückt mit Fisch, Reis, Seetangsuppe), Lammkoteletts, Gänseleber. Alles ist ein bißchen japanisiert, jedes Gedeck des edlen Porzellans hat eine andere Farbe. Es ist ein japanisches ästhetisches Prinzip, keine Regelmäßigkeit, keine Gleichförmigkeit aufkommen zu lassen.
Japaner sind zu Recht stolz darauf, keine Vorurteile zu haben. In ihrer langen Geschichte - ihr Kaiserreich besteht seit 2.600 Jahren - haben sie es verstanden, sich immer wieder Anstöße von außen für die Entwicklung ihrer Kultur zu holen. In der Klischeebehauptung, die Japaner eigneten sich gern fremde Ideen an und entwickelten sie lediglich weiter - siehe Kameras, Autos - liegt ein Körnchen Wahrheit und viel Unwahrheit. Denn erstens haben fast alle Völker fremde Kulturen assimiliert und zweitens verstehen die Japaner, aus dem Übernommenen so viel mehr zu machen, daß daraus eine neue Qualität entsteht.
Weltoffenheit und Isolationismus In Japans Geschichte wechseln Perioden extremer Weltoffenheit mit solchen des Isolationismus. Im 6. Jahrhundert n. Chr. erreichen der Buddhismus und die chinesische Kultur das Inselreich. China wird Mode. Man übernimmt Chinas Schrift und stülpt sie der japanischen Sprache über. Poesie und Prosa werden chinesisch verfaßt, jahrhundertelang. Junge Japaner reisen in Chinas Hauptstadt und bringen Ideen für Verwaltung und Politik zurück. In der Mitte des 9. Jahrhunderts bricht in China eine Revolution aus, Japan kann nichts mehr von dort lernen.
Es folgen Jahrhunderte der Abschließung. Bis Portugiesen im 16. Jahrhundert die Inseln entdecken, Handelsbeziehungen knüpfen, Missionare ins Land bringen. Es folgen Spanier, Holländer. Die spanischen Jesuiten gewinnen in der Führungsschicht so viel Einfluß, daß sie dem Shogun, dem obersten Militärmachthaber, gefährlich scheinen. Sie werden vertrieben, und die 600.000 japanischen Christen müssen ihrem Glauben abschwören. Japan verschließt sich wieder, 250 Jahre lang, absolut, wird ein Polizeistaat. 1853 erscheinen die schwarzen Schiffe des Commodore Perry aus Amerika in japanischen Häfen. Er verlangt Handelsbeziehungen, Stützpunkte für Proviant und Kohle und gute Behandlung schiffbrüchiger Amerikaner. Erst erzwingen die Amerikaner günstige Handelsverträge, dann folgen die Russen und andere europäische Mächte. Aber Japan läßt sich nicht zur Kolonie machen.
1867 kommt ein junger Mann auf den Thron, Kaiser Meji. Er zieht aus der alten Kaiserstadt Kyoto nach Edo, das jetzt Tokyo heißt, und stellt sich an die Spitze der Reformfreudigen, die Japan binnen einer Generation vom Mittelalter ins moderne industrielle Zeitalter führen. Innerhalb weniger Jahrzehnte werden 54.000 Grundschulen errichtet, eine beispiellose Bildungsleistung in der Welt. Die begabtesten Schüler werden nach Europa an die Universitäten gesandt, ausländische Berater ins Land geholt. Die zentrale Regierung baut eine Industrie nach westlichem Vorbild auf und ein Verkehrsnetz. Doch demokratische Ideen bleiben dem patriarchalischen Staat fern. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist Japan so stark, daß es einen Krieg gegen China gewinnt, bald darauf wird Rußland im Fernen Osten besiegt, Korea annektiert. Der Mythos von der Unbesiegbarkeit entsteht. Der Nationalismus nimmt in den dreißiger Jahren zu, Japan sieht die Chance, englische, französische und holländische Asienkolonien zu erobern. Doch dann die Katastrophe, die ungeheure Provokation der USA am 7. Dezember 1941: die amerikanische Kriegsflotte in Pearl Harbour wird von den Japanern vernichtet, die Rache der Amerikaner ist furchtbar: Hiroshima, Nagasaki. Japans Antwort ist erstaunlich: die Amerikaner erwarten nach der Besetzung eine Selbstmordwelle ungeheuren Ausmaßes bleibt aus. Japan amerikanisiert sich, aber nur an der Oberfläche.