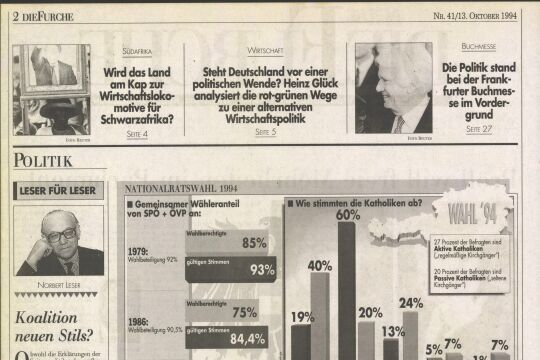Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hohe Latten
Nun will auch die Wiener ÖVP mehr Demokratie wagen: als Auftakt zur Kandidatennominierung für die Nationalratswahl 1975 sollen in einer sogenannten „Vorwahlwoche” Funktionäre, Parteimitglieder und möglicherweise auch die Angehörigen der sagenannten Vorfeldorganisationen (Rentner- und Pensionistenbund, Kameradschaft der Exekutive, Akademikerbund) direkten Einfluß auf die Gestaltung der Kandidatenliste nehmen können. Die Wiener ÖVP — so sieht ein Vorschlag vor — darüberhinaus auch die nahestehenden Organisationen (etwa die Turn- und Sportunion, den Cartell- veiband) an dieser Vorwahl beteiligen.
Anders als beim steirischen Beispiel, sollen Nicht-Parteimitglieder ausgeschlossen bleiben. Die Angst, eine starke, von der SPÖ dominierte Betriebsgruppa könnte etwa geschlossen zur ÖVP-Vorwahl erscheinen, ist — berechtigt oder nicht — offenbar größer als die Lust am totalen Risiko, das freilich auch totale Chancen gerade in der Bundeshauptstadt Wien mit ihren festgefahrenen politischen Fronten und einer kaum glaublichen Lagermentalität bietet. Fraglich ist, ob die Ergebnisse der Vorwahl nur als Empfehlung an den Landesparteivorstand zu behandeln sind. Nicht allein der Begriff „Vorwahl” macht die Zugkraft einer sol chen Aktion aus; dazu gehört auch die teilweise Bindung an die selbstverständlich nicht immer risikofreie Entscheidung der Vorwahlteilnehmer. In dieser Verpflichtung würde die Hoffnung liegen, daß die potentielle Partizipation der Wähler an der Kandidatenauslese endlich einmal die festgefügten politischen Strukturen in Wien auflockern könnte. Diese Hoffnung ist um so größer, als ähnliche Vorwahlaktionen von der Wiener SPÖ — leider! — kaum zu erwarten sind. Hier gilt offenbar der Standpunkt des Wiener Parteiobmanns Otto Probst, daß „es sowieso genug Demokratie in der Wiener SPÖ” gebe — und das ist noch immer Gesetz, dem auch der verbal auf demokratische Veränderungen eingeschworene neue Wiener SP-Vorsitzende und Bürgermeister Gratz verpflichtet ist.
Wie überhaupt Vorwahlen eher eine Angelegenheit der Volkspartei zu sein scheinen. Schon vor sechs Jahren wagte sich der heutige Wirtschaftsbund-Generalsekretär Erhard Busek mit Artikeln in diese gewiß riskante Richtung vor. 1969 erhob das Fessel-Institut, das fast ein Drittel der österreichischen Wähler Vorwahlen für die geeignete Form hält, traditionelle Kandidatennominie- rungs-Riten zu ändern. 1969 versuchte es die Salzburger ÖVP mit dem, was heute das „Wiener Modell” in groben Zügen ausmacht: die Vorfeldorganisationen waren, zur Teilnahme an Vorwahlen eingeladen, Nicht-Parteimitglieder blieben dagegen ausgeschlossen. Das Interesse an diesem Vorwahlmodell konzentrierte sich vor allem auf jene Vorfeldorganisationen, die glauben, in der Partei unter ihrem Wert behandelt zu werden. In Salzburg war es der Pensionisten- und Rentneirbund, der mit einem Drittel der Teilnehmer drei eigene Kandidaten auf die Liste brachte. Spätere Versuche erzielten eine größere Breitenwirkung, wenngleich es der ÖVP nicht gelang, in jene Gruppen vorzudringen, die traditionellerweise der SPÖ zugerechnet werden : vor allem den Arbeitern.
Erst dem oberösterreichischen und zuletzt dem steirischen Modell gelang der Durchbruch. Parteikenner glauben heute, daß der unerwartet hohe Wahlsieg der oberösterreichischen ÖVP im vergangenen Jahr vor allem auch auf die Vorwahlen zurückzuführen ist, weil es damit gelang, breites publizistisches Interesse zu wecken, das schließlich in zahlreichen oberösterreichischen Gemeinden zu Vorwahlbeteiligungen zwischen 80 und 100 Prozent der Parteimitglieder führte. Die steirische ÖVP- Vorwahl motivierte Anfang September 1974 immerhin 60 Prozent der Parteimitglieder, aber auch mehr als
40.0 Nicht-Parteimitglieder zur
Teilnahme. Drei Wochen später glaubte man in der Steiermark-VP, daß das von Generalsekretär Kohlmaier geortete „Zwischentief” der ÖVP letztlich jenseits des Semmerings durch das rege Interesse an den Vorwahlen überwunden wurde.
Das mag deshalb stimmen, weil die steirische ÖVP bindende Erklärungen über die tatsächlichen Listengestaltungsmöglichkeiten der Vorwähler abgegeben hat: das erste Drittel der gekürten Kandidaten muß durch das Parteipräsidium in den Hoffnungsbereich der endgültigen Kandidatenlisten gereiht werden. Die steirische SPÖ legte die Latte dagegen so hoch, daß sie selbst darunter plumpste: nur 12.000 (knapp ein Neuntel) der Parteimitglieder beteiligten sich daran, die Chancen, auf die endgültige Kandidatenlisten Einfluß zu nehmen, war allein dadurch (es hätten sich mindestens 51.500 Parteimitglieder beteiligen müssen) auf den Nullpunkt gesunken.
Die Gründe für den eklatanten Mißerfolg der steirischen SPÖ sollten die Bundesparteileitungen und Landesorganisationen aller Parteien stets berücksichtigen, ehe sie darangehen, Vorwählmodelile aufzustellen und der Öffentlichkeit vorzulegen.
Die Wiener ÖVP hat jedenfalls einen großen Anlauf genommen, und es wird darauf ankommen, daß sie imstande ist, über den eigenen Schatten zu springen. Von der Wiener SPÖ hört man in dieser Richtung überhaupt nichts. ÖVP-Obmann Schleinzer hat versprochen, im kommenden Jahr ein Bundes-Modell vorzulegen, in dem die Gedanken der steirischen öyP berücksichtigt sind. SPÖ-Vorsitzender Kreisky hat sich dazu noch nicht geäußert, sondern seinen Zentralsekretär Marsch vorgeschickt, der ebenfalls versprochen hat, 1975 ein Vorwahlkonzept vorzulegen. Es bleibt abzuwarten, ob daraus tatsächlich mehr als die orthodoxen Minimal-Konzepte werden. Aus höchsten Parteikreisen bei SPÖ und ÖVP verlauten eher Zweifel als Hoffnungen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!