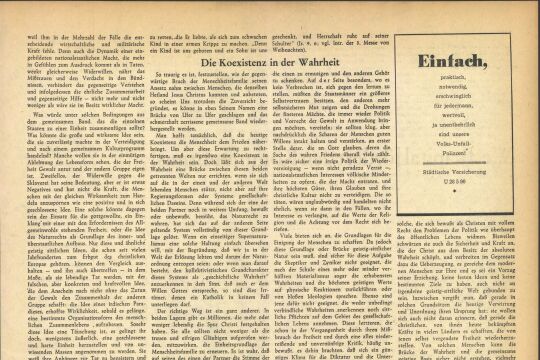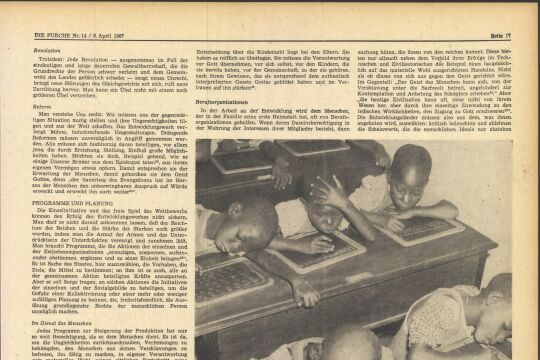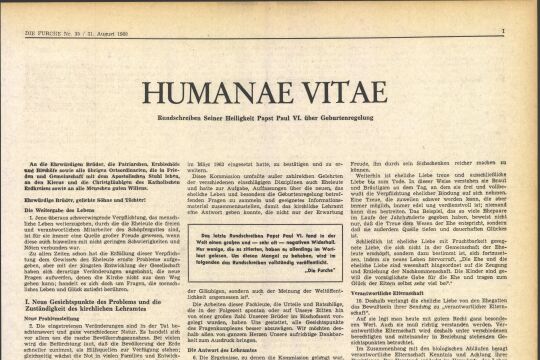Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Willst du den Frieden, verteidige das Leben”
Das christliche Gebot des Friedens findet seine Begründung in einer Gesinnung der Verantwortung. Paul VI. gibt sich keinen Illusionen und Utopien hin, wenn er erklärt: „Auch heute, nach den fürchterlichen Erlebnissen des letzten Krieges, ist es nicht der Friede, sondern der Kampf, der sich durchsetzt. Selbst brutale Gewalt findet wieder Anhänger und Bewunderer… Wir wollen nicht bestreiten, daß Kampf notwendig sein kann, daß ihn die Gerechtigkeit zuweilen als Waffe braucht… Doch wir sind der Auffassung, daß der Kampf nie zum Leitstern werden kann, den die Menschheit braucht. Wir sind der Überzeugung, der Friede hat nichts mit Feigheit, mit Verzagtheit und Schwäche zu tun. Der Friede muß ganz allmählich moralische Stärke an die Stelle brutaler Gewalt setzen. Er muß die verhängnisvolle und allzuoft trügerische Kraft der Waffen und Gewaltmaßnahmen sowie der materiellen und wirtschaftlichen Übermacht durch Vernunft, Gespräch und moralische Größe ersetzen.”
Der Friede ist daher auch mehr als der Nicht-Krieg. Pius XII. und Paul VI. vertreten die schon von Augustinus formulierte Begriffsbestimmung: „Der Friede ist die Ruhe in der Ordnung.” Es wäre aber falsch, anzunehmen, daß damit das Wort einem statischen und nicht dynamischen Friedensbegriff geredet wird. Die Voraussetzung dauerhaften Friedens ist die Entwicklung. Wie Paul VI. schon 1967 in „Populorum progressio” betonte, ist „Entwicklung” nur ein neuer Name für Friede.
Wie „Pacem in Terris” Johannes’ XXIII. hebt auch „Populorum progressio” Pauls VI. vier Ordnungsprinzipien für die Entwicklung der Friedensordnung hervor: sie gründet in der Wahrheit, wird erbaut nach den Richtlinien der Gerechtigkeit, ist von der Liebe zu erfüllen und schließlich in der Freiheit zu verwirklichen.
Die Wahrheit als erste Grundlage des Friedens verlangt die Anerkennung, den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte. Ein durch Gleichgewicht der Schrecken, Psychoterror und Zwang verursachter Zustand der Stille mag zwar von Außenstehenden als Ruhe empfunden werden, kann aber nicht von uns als Friede gewertet werden. Wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, sind alle Friedensappelle unglaubwürdig und fruchtlos, weil sie nicht wahr und gerecht sind.
Die Gerechtigkeit verlangt die Anerkennung der Freiheit und Würde des Menschen, und das nicht bloß formal, etwa in einer generell proklamierten Gleichheitsproklamation, sondern in einer auf den einzelnen bezogenen mitmenschlichen Aktion.
Der wahre Friede liegt nach Pius XII. in einem „Bündnis der Liebe”, er verlangt ein günstiges Klima des Verstehens, einen neuen Geist, für den schon Pius XII. den Sieg über den Haß von Volk zu Volk, den Sieg über das Mißtrauen zwischen rivalisierenden Nationen, den Sieg über den Mythos der Macht und über den Geist kalter Selbstsucht als notwendig erachtete.
Ein dauerhafter Friede ist nicht auf Kosten der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Uberzeugungsfreiheit möglich; er ist nicht Unterwerfung der einen und Herrschen der anderen, er ist auch nicht durch ein Gleichgewicht des Schreckens erreichbar, sondern kann nur in einem Ausgleich der Kräfte und Interessen der Staaten bestehen, in dem auch mehr als bisher auf die Voraussetzung der freien, eigenverantwortlichen Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen Bedacht genommen werden sollte.
Aus diesem Grund ist es begrüßenswert, daß in den Schlußakten der Europäischen Sicherheitskonferenz (KSZE) die Menschenrechte als Prinzip anerkannt wurden, und somit eine Intervention aus humanitären Gründen, die ein Teilnehmerstaat bei einem anderen für angebracht erachtet, nicht mehr von vornherein als Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses Staates angesehen werden kann.
Die Freiheit muß den Frieden nicht bloß einmal erringen, sie muß ständig neu gesichert und bewahrt werden. Sie besteht nicht in der Schrankenlosigkeit des Wollens des einzelnen, sondern schließt die Erkenntnis mit ein, daß die Freiheit des einen dort endet, wo die Freiheit des Nächsten beginnt.
Johannes XXIII. hat in seiner Friedensenzyklika „Pacem in Terris” gezeigt, wie der Friede in einem Ordnungsgefüge zu entwickeln ist, zwischen den einzelnen Menschen, im Staat, zwischen den Völkern und in der Menschheit. Papst Paul VI. betonte am 1. Jänner: „Wir möchten den Frieden nicht darstellen als einen unverrückbaren Felsen in den Wogen des’ sturmbewegten Ozeans der Weltgeschichte, sondern als ein auf ihnen schwimmendes Schiff: dieses braucht, um einen Schiffbruch zu vermeiden, die Führung eines Lotsen und die geschickte und engagierte Arbeit einer Mannschaft.”
Für 1977 wählte Paul VI. das Motto: „Willst du den Frieden, so verteidige das Leben.” Dieses Thema für die Friedensarbeit stellt eine besondere Konfrontation von Humanitätsanliegen und Perfektionsstreben dar. Perfektion scheint das Motto unserer Zeit zu sein. Die Raketen können in der Atmosphäre nicht hoch genug fliegen, die Autos auf den Straßen nicht schnell genug fahren und die Menschen nicht genug erleben. Gleichzeitig aber hat die Vervollkommnung der Technik in einem ungeahnten Maß zur Gefährdung der Umwelt geführt.
Luftverunreinigung, Lärmbekämpfung, Wasserverschmutzung, Abfallprobleme und Bedrohung von Vegetation und Landschaft sind Zeichen dafür.
Das Perfektionsstreben in der- Technik und im sozialen Rechtsstaat war nicht mit ebensolchem Streben nach verbesserter Menschlichkeit verbunden, im Gegenteil, es verkümmert. Anerkennung und Beachtung findet nur das Normierte, auf das der einzelne einen Anspruch hat.
Aller Fortschritt wird aber fragwürdig, wenn er nicht auch begleitet wird von einem ebensolchen Fortschreiten der Menschlichkeit; diese fehlt heute. Die technisierte Wohlstandsgesellschaft ist nicht mehr imstande, die vermehrte Freizeit und Lebenszeit mit entsprechendem Sinn zu erfüllen, sich der Kranken und Verlassenen anzunehmen. Man glaubt, mit dem Steuerzahlen für den Staat genug geleistet und mit dem Versicherungsbetrag sich und den Nächsten geschützt zu haben. Die Einsamen in lauter Welt werden vergessen.
Die Perfektion bleibt eine äußerliche, solange der Staat nur als Mehrzweckapparat und nicht als verantwortliche Gemeinschaft von Mitbürgern, der Mitmensch mehr als Karrierehindernis und weniger als Heilsbedingung des einzelnen angesehen wird. Ein Umdenken zum Menschen ist erforderlich. „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.”
Was heute besonders nottut, ist eine Wandlung zu mehr Menschlichkeit. Das verlangt mehr Zuhören als Reden, mehr Vorleben als Befehlen, mehr Verstehensuchen als Kritisierenwollen und vor allem mehr im vorhinein Helfen als im nachhinein Bestrafen. Das gilt für alles Menschliche, nicht bloß nach der Geburt, sondern schon mit Beginn des Lebens.
Papst Paul VI. bemerkte dazu: „Handelt es sich etwa nicht um echtes und wirkliches menschliches Leben, das im Mutterschoß mit der Empfängnis beginnt? Verdient es nicht jede liebevolle Sorge, eben weil dieses embryonale Leben unschuldig und schutzlos ist und schon im Buch Gottes der Geschicke der Menschheit verzeichnet steht? Wer könnte es für normal halten, daß eine Mutter ihr eigenes Leben tötet oder töten läßt? Welche Droge oder welche gesetzliche Regelung kann je das Gewissen einer Frau beruhigen, die freiwillig und überlegt zur Mörderin ihrer eigenen Leibesfrucht geworden ist? Wenn wir den Frieden schützen wollen, müssen wir das Leben verteidigen.”
Wenn im Hinblick auf die Anerkennung auch des ungeborenen Lebens seine Schutzbedürftigkeit betont wird, dann sei für das ungeborene Leben auch der erforderliche Rechtsschutz verlangt. Er allein genügt aber nicht; was heute auch erforderlich ist, ist mehr Verständnis und Hilfe für Frauen in Bedrängnis und ihre schuldlosen Kinder. Das verlangt neben der wichtigen finanziellen Hilfe das Abbauen von falschen Vorurteilen und Ressentiments gegenüber unehelichen Kindern und deren Müttern.
Die Forderung nach dem Schutz des Lebens schließt in diesem Sinne auch die Forderung nach Beachtung von mehr Menschlichkeit gegenüber kranken Menschen ein. Wir wollten uns ebensoviele Gedanken wie über eine sinnvolle Freizeitgestaltung auch über Hilfen gegen das Alleinsein des alten Menschen machen. Ist es nicht traurig, wie viele Menschen als pflegebedürftig das Spital verlassen müssen und keinen Heimplatz finden?
Erkennen wir diese Anliegen, dann haben wir zwar nicht die Gewißheit, wohl aber eine Chance, daß die derzeit laufende Diskussion um das Recht auf das Leben sich nicht bloß in den Niederungen ideologischer Auseinandersetzungen und parteipolitischen Schlagabtausches verliert, sondern ein Beitrag zur Vermenschlichung in unserer Zeit wird.
(Aus der Festrede zum X. Päpstlichen Weltfriedenstag am 21. März.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!