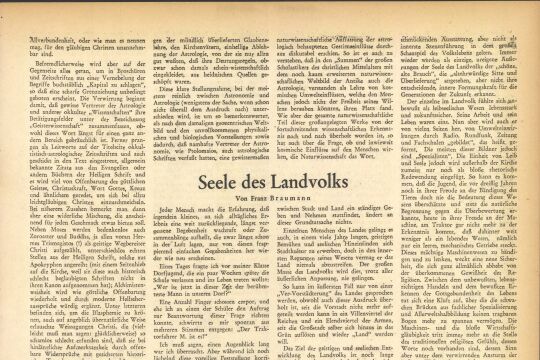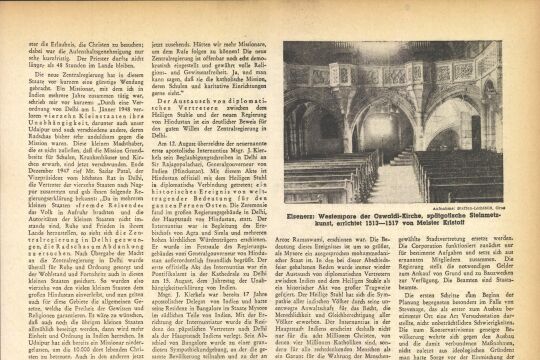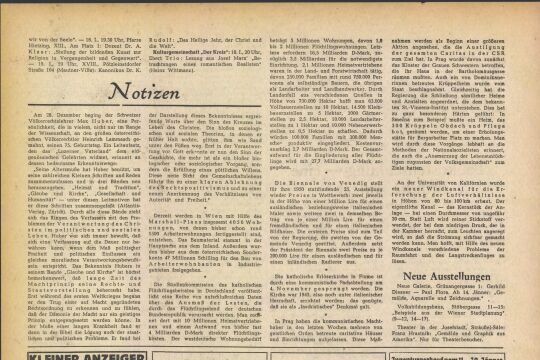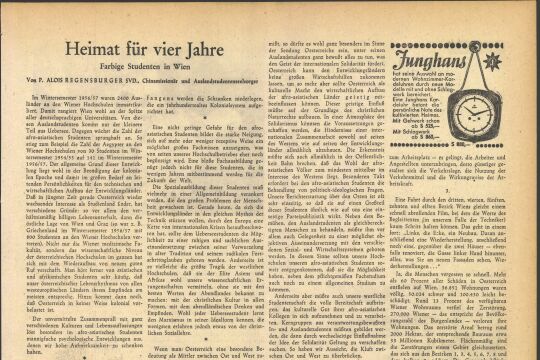Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zuhause mit Lebensqualität
In ein Altersheim geht man. Die alltagssprachliche Wendung ist bemerkenswert, denn sie charakterisiert den für Senioren zugewiesenen Ort von vornherein als einen Lebensraum, in den man nicht übersiedelt Selten entscheidet sich ein Mensch, ein Altersheim von sich aus aufzusuchen, weder als Besucher noch als Bewohner. Es gilt als Ort, der Fremdheit ausstrahlt, an den man sich nie gewöhnt und den man in bezug auf seine Bewohnbarkeit für untauglich hält.
Das Altersheim ist Endstation im sprichwörtlichen Sinne, denn das Wort Station bezeichnet den Teil eines Krankenhauses. Das hat historische Gründe. Ursprünglich kam den Klöstern und Hospitälern die Funktion zu, Menschen in Armut, Krankheit und Alter zu betreuen. Es war diese undifferenzierte Form, nach der Menschen aufgenommen wurden, die das Entstehen eines Bewußtseins für die Notwendigkeit einer besonderen Wohnform für Betagte unterband. Das änderte sich im 20. Jahrhundert unter dem Einfluß eines demographischen Wandels.
Zur Entwicklung der Altersfrage als gesellschaftliches Problem führte aber nicht nur die sinkende Sterblichkeit. Der Begriff Altenhilfe kommt in den zwanziger Jahren auf, einer Zeit großer wirtschaftlicher Not - unter Umständen, die heute relativ unbekannt sind: Damals wohnten nur acht Prozent der Alten in Heimen. Wie eine Studie aus Hannover nachweist, verfügte 1926 lediglich ein Hundert-^ stel der Bevölkerung über Wohnungseigentum (gegenwärtig sind es in der BRD zirka 55 Prozent). Der größte Teil der Alten lebte in Mietwohnungen. Die Existenz der Senioren hing oft davon ab, das Haushaltseinkommen durch Untermieten zu verbessern.
Eine Folge war, daß vor allem junge Familien unter Wohnungsmangel litten. Bis in die Zeit des Nationalsozialismus wurde der Bedarf an Alten-heimen mit den für die Jüngeren benötigten Wohnungen begründet, die von den Alten freigemacht werden sollten. Die soziale Frage des Woh Seniorenheime finden bei älteren Menschen wenig Gefallen. Behaglichkeit statt Krankenhausatmosphäre könnte dem ein Ende setzen. nens im Alter war damit aber nur ungenügend beantwortet. Denn aufgrund der allgemeinen Armut konnten auch die Rosten für das Wohnen im Heim nicht aufgebracht werden und die Kommunen standen sofort vor dem Folgeproblem der steigenden Zuschüsse.
Was das Seniorenheim als Bauaufgabe betrifft, existiert in der Architekturgeschichte das Phänomen, daß die Lösung neuer Bauaufgaben zuerst in einem Heranziehen von Vergleichbarem endet. So erstaunt es nicht, daß Altersheimbauten architektonisch in Anlehnung an Krankenhäuser realisiert wurden. Zwar Heim genannt, entsprachen sie in keiner Weise einem Heim im Sinne von Heimat. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das Heim eine Verwahranstalt mit Insassen. Schlafsäle entlang langer Gänge waren üblich und Sanitärbereiche - wenn überhaupt vorhanden - sehr einfach. Paradoxerweise war aber die Folgegeneration von Altersheimen dem Krankenhaus noch ähnhcher.
Heimbewohner wurden unter dem Diktat scheinbarer Fortschrittlichkeit in den achtziger Jahren zu Patienten, aber baulich hatten ihre Heime meist nur im Hygienebereich wirklich gewonnen. Obwohl nun erstmals mit Gemeinschaftseinrichtungen ausgestattet, lagen den Bauten stereotype Baumorganisationen zugrunde. Sie entstanden aus dem Wunsch, Wirtschaftlichkeit, Pflege und Therapie rationeller zu gestalten. Die Folge war, daß das Altsein auf einen „Zustand mit Funktionsmängeln” reduziert wurde. Das Seniorenheim blieb eine unattraktive Wohnform füröenioren.
Innenhof des „Haus Nofels”
Nach einer Prognose wird der Anteil an über 60jährigen in Österreich von 19,7 Prozent (1996) auf 24,6 Pro-' zent (2015) und weiter auf 33 Prozent (2030) anwachsen. Die Nichterwerbstätigen werden aber mehr als ein wirtschaftlicher und politischer Faktor sein. Ihr Lebensabschnitt hat schon heute eine der Jugend vergleichbare Länge angenommen, mit einer zunehmenden Lebensintensität.
Die aktuelle Debatte heißt daher „Wohnpflege oder Pflegewohnen”, und in ihrem Rahmen nimmt die Stadt Feldkirch wohl österreichweit den ersten Rang ein. 1990 wurde ein Altenpflegekonzept in Auftrag gegeben, dessen Ziel eine Senkung der Pflegekosten war. Ferner trägt die Vorarlberger Kommune noch einem Phänomen Rechnung: Die Möglichkeit, nach der Auflösung ihrer eigenen Wohnung in eine Altenwohnung zu übersiedeln, wurde von den Senioren nicht angenommen. Die letzte kleivig dezentral betreute Wohngemeinschaft wurde mangels Bedarf 1997 aufgelöst!
Heute gilt in Feldkirch der Grundsatz „So viel ambulant wie möglich und so viel stationär wie nötig”, was auch zu einer finanziell ausgeglichenen Situation führte: Die Altenpflege soll sich selbst erhalten. Aus der kommunalen Verwaltung ausgegliederte Vereine, wie Mobiler Haushilfedienst, Essen auf Rädern und Hauskrankenpflege betreuen vier Fünftel der Senioren, die für das Service bezahlen.
95 Prozent aller 70- bis 75jährigen antworten auf die Frage, ob sie in den kommenden Jahren umziehen werden, mit „Nein”. Zumeist scheitert dieser Wunsch eines Seniors aber nur am Mangel von Nahversorgungs-möglichkeiten, ein Problem unter dem übrigens nicht nur die Alten leiden. Man folgte dem Grundsatz „Wer schon umziehen muß, soll in der Nähe bleiben” und realisierte bisher zwei kleine Stadtteil-Seniorenheime in Nofels und Gisingen. Hinter den neuen Altersheimen Feldkirchs verbirgt sich neben einer Modernisierung des Wohn- und Pflegestandards die Idee einer Öffnung. Sie sollen eine ambulante sowie stationäre Grundversorgung für viele Menschen und alle Senioren in einem Gebiet sicherstellen und können auch Mütterberatungsstellen und Büchereien beinhalten. Das Thema der Mischnutzung führt aus einem isolierten Wohnen im Alter heraus. Die neuen Heime in Feldkirch haben auch Funktion eines Treffpunktes für die Bevölkerung.
Eines der beiden Seniorenzentren in Feldkirch, das „Haus Nofels”, stammt vom Tiroler Architekten Rainer Köberl, der hier zukunftsweisende architektonische Lösungen gefunden hat. An den Rand der Streusiedlung Nofels plazierte er einen zweige-schoßigen Vierkanthof, der sich in den Ort gut integriert. Diese Form sorgt auch für den Austausch zwischen Innen und Außen. Sieben Mö-blierungsvarianten wurden in gemeinsamer Arbeit zwischen dem Architekten, der Pflegeleitung und den ersten Bewohnern erarbeitet. Die Einrichtung ist mobil, sodaß zum Beispiel die Schränke entlang der Wand oder als Raumteiler eingesetzt werden können. Gesetzlich geforderte klinische Details, etwa die Signalleuchten, wurden von Köberl in minuziöser Kleinarbeit zu funktionalen sowie ästhetischen Elementen umgearbeitet. Die Architektur und das spezielle Design der Innenausstattungen dient dazu, die Atmosphäre wohnlich zu gestalten.
Ein Besuch im „Haus Nofels” macht nachdenklich, warum so wenige Architekten und ihre Auftraggeber sich die Mühe machen, an das Wohnen im Alter so heranzugehen, daß am Ende eine Wohnatmosphäre entsteht und nicht eine Systembehausung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!