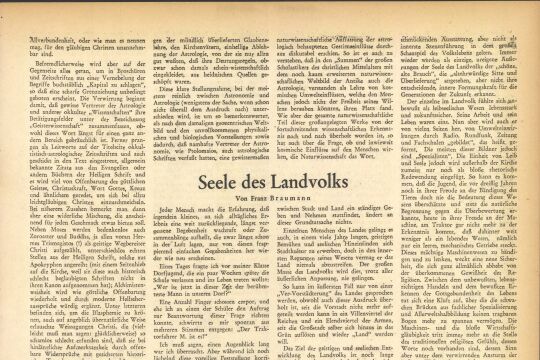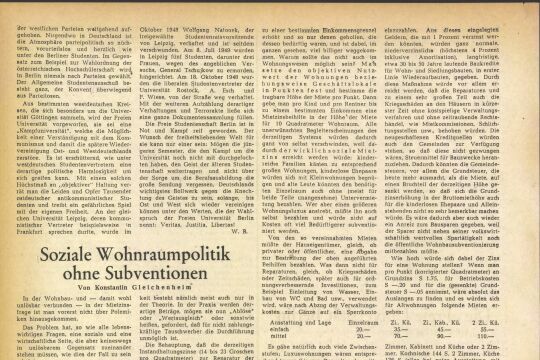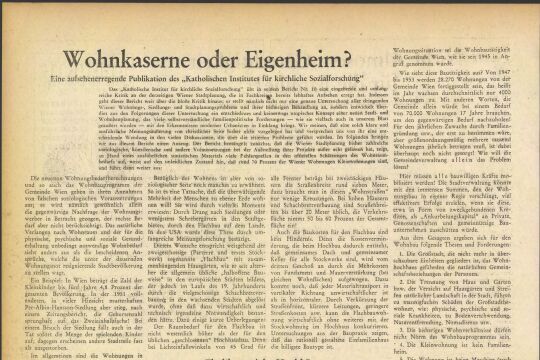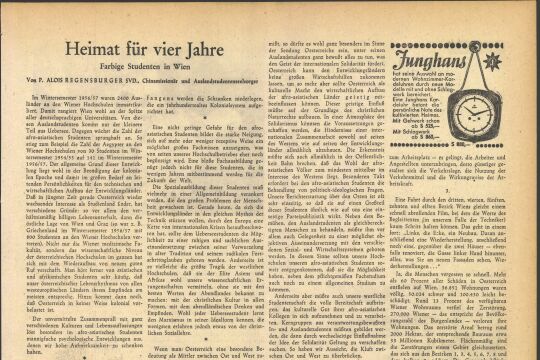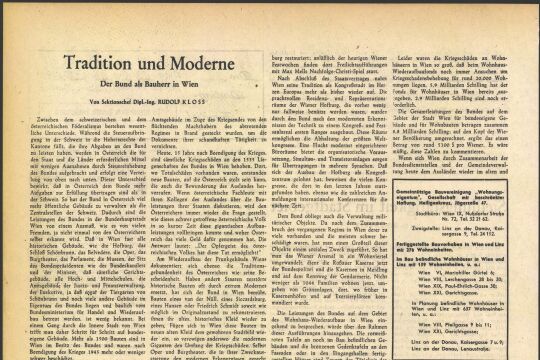Zur Revitalisierung alter Wohnviertel braucht man nicht nur, aber vor allem, Geld
Der Stadtrand, grüne Umgebung, bessere Luft und moderne Wohnungen haben geradezu eine magnetische Anziehung für viele Wohnungssuchende, gleich welchen Alters. Dies führt notgedrungen zu einer fortschreitenden Stadterweiterung. Sie ist zwar offiziell bereits etwas gebremst, doch immer gibt es, bald hier, bald dort, ein Projekt im Grünen. Wird dies weiter so betrieben und werden unsere alten Stadtviertel nicht ernsthaft einer Sanierung unterzogen, dürfte es schon in absehbarer Zeit einen modernen Vorortering um Slums und Geisterstädte geben. Das ist keine leere Drohung, denn der Zug „hinaus“ läuft heute noch immer in ganz ansehnlichem Tempo. Auch wenn von den offiziellen Stellen keine genauen Zahlen zu erhalten sind.
Die Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen hat in ihrer Monographie 25 die Althaussubstanz in allen österreichischen Großstädten unter die Lupe genommen und die Kosten ihrer Sanierung und Erhaltung auf der Preisbasis von 1976 errechnet. Sie kommt auf die fürs erste horrend erscheinende Summe von 85 Milliarden Schilling; das ist etwa ein Drittel des österreichischen Staatsbudgets.
Diese Horrorzahlen brauchen jedoch weder die Stadtplaner noch die betroffenen Bewohner in Verzweiflung stürzen, wenn man bedenkt, daß iich eine Sanierung nicht in ein oder zwei Jahren und überall zugleich durchführen läßt. Wenn allerdings weiterhin nicht mehr Geldmittel als heute zur Verfügung stehen, wird man wohl nahezu ein ganzes Jahrhundert für eine umfassende Stadtsanierung brauchen. Denn es steht außer Zweifel, daß der Sanierungsbedarf ein dynamischer ist, da die Alterung sämtlicher Häuser fortschreitet Wir werden lernen müssen, mit dem Sanierungsproblem als gesellschaftlicher Daueraufgabe zu leben!
Die vorliegende Studie bezieht sich auf Gebäude mit mindestens drei Wohnungen in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg, die vor 1945 erbaut wurden. Das angeführte Zahlenmaterial bedeutet jedoch bloß eine Momentaufnahme.
Den weitaus größten Aufwand erfordert naturgemäß die Sanierung des Althausbestandes in Wien. Uber 40 Prozent der Gesamtkosten entfallen auf die Instandsetzung von Häusern mit mangelhaft ausgestatteten Wohnungen, die kein Bad eingebaut haben, nur über ein Gangklosett und die berüchtigte Bassena zur Wasserentnahme verfügen. Auch in Graz ist die Situation besonders arg. Bei diesen Wohnungen stößt der Umbau auf die größten Schwierigkeiten, sie bedürfen daher der bestmöglichen Förderung in technischer und finanzieller Hinsicht.
Wohl ist es die einfachste Art, solche Häuserviertel und Straßenzüge niederzureißen und moderne Bauten mit größerer Wohnfläche hinzustellen. Die sozialen Probleme in vielerlei Gestalt, wie die Frage, wo die Mieter während der Sanierung untergebracht werden sollen, das Heimatgefühl der dort Wohnenden und die Zugehörigkeit zu ihrem Stadtviertel können und dürfen aber nicht leicht genommen werden! Eine bessere Information der Mieter, unkonventionelle und unbürokratische Planung und rationelle Durchführung könnten nicht nur alle Beteiligten zufriedenstellen, sondern auch die Investitionskosten erheblich senken!
Allerdings läßt der Einfallsreichtum der Architekten und Baufirmen viele und höchst notwendige Wünsche offen. Eine Althaussanierung verlangt wesentlich mehr Phantasie als die vie-
len neuen Einheitsblocks von der Stange. Jede Erneuerung eines alten Hauses muß einzeln für sich durchdacht und geplant werden. Dafür gibt es Ansätze: So hat eine Firma für Sanitäranlagen einen Modulbau konstruiert, der die gesamte Naßanlage in fabriksmäßiger Herstellung in Althäuser installierbar macht, was zu einer beträchtlichen Kostensenkung beiträgt.
Ältere, vor der Gründerzeit erbaute Häuser sind in einem wesentlich geringeren MaßemitBaumängeln behaftet als die zwischen 1880 und 1918 entstanden Zinskasernen. Häuser aus dem Hochbarock und der Biedermeierzeit haben wohl ihre Kochstellen (früher Rauchküchen) in der Dunkelzone, und der schmale Innenhof wird weiter wenig Licht spenden. Ihr Wohnraum ist jedoch großzügiger angelegt als in den Häusern der nachfolgenden Epoche. Meistens sind es denkmalgeschützte Gebäude, der Mehraufwand zur Wahrung des Denkmalschutzes beträgt aber nicht mehr als 0,4 Prozent, wenn nicht größere Umbauten verlangt werden.
Während in Wien der Schwerpunkt bei den Massenmietshäusern der Gründerzeit liegt, bedürfen in Linz vor allem die Wohnhäuser der Zwischenkriegszeit einer Sanierung. In Innsbruck ist es weniger die Ausstattung der Wohnungen als der allgemein schlechte Zustand der Häuser. Die maßgeblichen Politiker und Stadtplaner bekennen sich heute wohl zum Altstadterhaltungs- und Stadtsanierungsprogramm, wenn nicht da und dort höhere Interessen doch wieder ein Stück Stadterweiterung ins Spiel bringen.
Die starke Bautätigkeit auf Wiener Boden zwischen 1870 und 1900 wie die rapide Stadterweiterung zu dieser Zeit haben ganz neue Bautypen, die Massenmietshäuser, hervorgebracht. Wohl gibt es aus dieser Zeit noch das Nobelmietshaus der Ringstraßenzone und das bürgerliche Mietshaus mit mittleren und Groß-Wohnungen in den Vorstädten, doch sind diese auch heute zumeist in gutem Zustand und kaum sanierungsbedürftig. Durch die rasch gewachsenen Arbeiterviertel in Wien ist dort der Althausbestand am stärksten sanierungsbedürftig. Es sind die „Bassenahäuser“, die meist nur aus Kleinstwohnungen mit Zimmer und Küche, eventuell noch Kabinett, mit WC und Wasserentnahme auf dem Gang, heute oft menschenunwürdige Behausungen bieten. Ihre vielfach reichgegliederte, mit verschiedenen Stilelementen versehenen Fassaden lassen oft den schlechten Zustand der
dahinterliegenden Wohnungen nicht erahnen.
Bevor die Behörden darangehen, ein Häuserensemble, einen Straßenzug oder ein Viertel als sanierungs- und unterstützungsbedürftig anzuerkennen, müssen die Bewohner erst selbst zeigen, daß sie daran Interesse haben, daß ihre Umgebung wieder instandgesetzt wird. Erst müssen sie beginnen, ihre eigene Wohnung zu verbessern. Im Rathaus verweist man mit Genugtuung auf das Wohnungsverbesserungs-gesetz. Heuer sind allerdings bereits im ersten Jahresdrittel die Kredite für individuelle Verbesserungen ausgeschöpft. Der Antragsteller muß, wie Stadtrat Rudolf Wurzer zugibt, auf bessere Budgetzeiten, die seiner Meinung nach nicht so fern liegen, warten ...
In den „Bassenahäusern“ aber nützt in den weitaus überwiegenden Fällen eine individuelle Wohnungsverbesserung gar nichts. Sie kann wohl in manchen Fällen mit einer Etagensanierung beginnen. Meistens müssen dort Wohnungen zusammengelegt werden. In diesen alten Zinskasernen sind jedoch meist größere Reparaturen notwendig: Alte Dippelbäume müssen ausgewechselt werden, Dach- und Fensterstöcke wiederhergestellt, Senkrechtsanitärschächte eingebaut, sowie neue Steigstränge für Strom und Gas eingeführt, in der Spindel der Stiege oder an der Hoffassade ein Lift eingebaut werden; einzelne Trakte müssen abgerissen und neu gebaut werden, um ein menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen.
Diese Arbeiten verlangen aber, daß mindestens ein Teü der Mieter ausgesiedelt wird. Zwar wird immer wieder betont, daß die Sanierung eines Hauses keinen Kündigungsgrund darstellt. Da aber bei einer Aussiedlung, auch auf Zeit, eine „gleichwertige“ Wohnung zur Verfügung gestellt werden muß, sind diese Ersatzwohnungen dann ebenfalls feucht, dunkel, sanierungsbedürftig. Bei einer Rückkehr in die renovierte, neue Wohnung muß der alte Mieter aber eine erheblich höhere Miete bezahlen. Wie weit er dazu imstande ist und wieviel die Gemeinde zu den Baukosten zuschießt, das ist die eigentliche Frage, die das gesamte Unternehmen einer • Althaussanierung überschattet, ihre Durchführung möglich oder unmöglich macht. Denn
wenn die Baukosten für sanierte Appartements nur für dicke Brieftaschen erschwinglich sind, ist den ursprünglichen Bewohnern keinesfalls mit der Instandsetzung geholfen.
Zur Stadtsanierung gehört auch der einst stark propagierte Dachbodenausbau. Von über 3000 Interessenten haben schließlich nur 80 ein Gesuch eingereicht, wovon von den Behören bis jetzt erst drei bewilligt wurden. Auch die Bewilligung für einen Dachgarten dauert länger, als eine Grundumwidmung für einen Neubau.
Und doch will die Gemeinde Wien ein Beispiel setzen, die Ulrichsbergsanierung im siebenten Bezirk. Hier soll kein Nobelghetto wie am benachbarten Spittelberg entstehen, wo die Sanierungskosten pro Quadratmeter auf 15.000 Schilling anstiegen. Stadtrat Hubert Pfoch will beträchtliche Mittel aus dem Altstadterhaltungsfonds flüssig machen, sodaß der künftige Mieter für eine Zwei-Zimmerwohnung nicht mehr als 2200 Schilling Miete aufzubringen hätte. Auch auf die Stadterneuerung in Ottakring verweist Stadtrat Rudolf Wurzer mit Stolz. In Wien ist man gezwungen, nur sehr klein-räumig und unendlich langsam zu sanieren, weil an allen Ecken und Enden das Geld fehlt.
Sicher könnten noch viel mehr Instandsetzungen sanierungs bedürftiger Häuser über den Paragraph 7 durchgeführt werden. Aber solche
Gebäude sind für Grundstücksmakler, die lieber mit einem Abbruch spekulieren, kein Geschäft. Außerdem müßten - so wie jeder regelmäßig sein Auto zum Service gibt - auch Gebäude in regelmäßigen Zeitabständen überholt werden. Es könnte dann schon im voraus bestimmt werden, welche Reparaturkosten notwendig wären, damit die Althaussubstanz in optimalem Zustand bleibt, betont Architekt Christoph Riccabona.
Baufällige Häuser werden an kinderreiche Familien und Gastarbeiter vermietet, die sich keine besseren Wohnungen leisten können. So entstehen Slums. In Österreich hat der Slumbil-dungsprozeß bereits begonnen, stellt Architekt Riccabona fest.
Um dem entgegenzuwirken, muß die Stadterneuerung vor der Stadterweiterung rangieren. Die vorliegende Studie fordert, daß Steuer-, Wohnbau-, Beschäftigungs- und Forschungspolitik besser zusammenwirken, um die Schaffung neuen Wohnraums in alte Wohngebiete, wo die Infrastruktur noch funktioniert, zu verlagern. Die Mittel für die Verbesserung müßten gezielter und zügiger eingesetzt werden.
Vielleicht gäbe es noch einen Weg. Ein Beispiel kommt aus der schwerverschuldeten Stadt New York, aus einem Negerslum: die Fulton Street und ihre Umgebung. Ein paar weiße Frauen haben hier die Inititative ergriffen. Da ging es nicht mehr allein um Renovierung von Wohnblocks und Anlegen von Kinderspielplätzen. Die Schwarzen, die mißtrauisch beiseite standen, konnten schließlich motiviert werden, mitzutun. In der Freizeit wurde gemeinsam an kleinen Grünflächen gewerkt und selbst Hand angelegt. Die Banken und Industrien gaben nicht nur Geld, auch Arbeitsplätze konnten geschaffen werden. Einer zog den anderen mit, und allmählich wuchs mit der gemeinsamen Aufgabe auch eine Gemeinschaft, die ihren Stadtteil prägt.
Vielleicht wäre das auch für Österreich, vor allem für Wien ein Weg, eine Chance und ein Beweis, daß nicht nur Geld allein ein Stadtviertel vitalisieren kann.