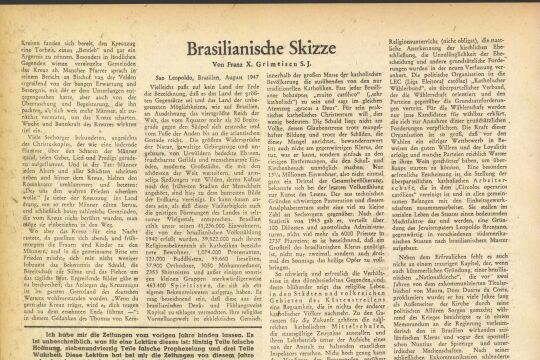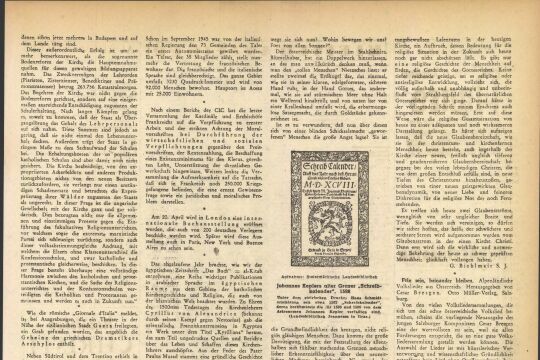Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Idee der Universität
Forschung ist lobenswert, hat Sinn und Ziel, kann mit Zuversicht betrieben werden - das sagt kein heutiger „Macher“, sondern ist die Uridee europäischer Wissenschaft.
Forschung ist lobenswert, hat Sinn und Ziel, kann mit Zuversicht betrieben werden - das sagt kein heutiger „Macher“, sondern ist die Uridee europäischer Wissenschaft.
Jeden Tag gehen die meisten Basler Universitätsangehörigen an lateinischen Worten vorbei, die sie am Haupteingang des Kollegiengebäudes begrüßen: „Morta-lis homo ex dono Dei per assidu-um Studium adipisci valet scienti-ae margaritam quae eum ad mun-di arcana cognoscenda dilucide introducit et in infimo loco natos evehit in sublimes“.
Dies ist eine verkürzte Fassung der Präambel der Stiftungsbulle des Papstes Pius II. vom 12. November 1459. Der Stifter stellt vor seine Universität das große Ziel, als „Gabe Gottes durch beharrliches Studium die Perle der Wissenschaft zu erlangen. Sie weist den Weg zu gutem und glücklichem Leben ... Sie macht den Erfahrenen Gott ähnlich und führt ihn zum klaren Erkennen der Weltgeheimnisse hin ... Sie hebt die in Niedrigkeit Geborenen zu den Erhabensten hinauf.“
Diese Worte sind keine Neuschöpfung des frommen Humanisten Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II.), obwohl sie in der Basler Bulle besonders schön zum Ausdruck gelangen. Zu manchen Wendungen finden sich Parallelen, etwa in den Stiftungsurkunden der Schwesteruniversitäten wie Prag, Köln, Greifswald. Es wird also in der Bulle der wesentliche Konsensus der klassischen abendländischen Universität wiedergegeben.
Haben diese unverkennbar mittelalterlichen Worte heute noch etwas Wesentliches zu sagen? Unvermittelt sind die Stiftungssätze nicht übertragbar. Doch sprechen sie mich in einigen wesentlichen Einsichten über die Abgründe der Zeit höchst aktuell an.
Die Präambel der Basler Stiftungsurkunde beeindruckt in ihrem zuversichtlichen Lob des wissenschaftlichen Erkennens. Sie setzt voraus: Der Mensch ist ein erkennendes Wesen, er darf, er soll, er muß forschen. Das ist seine Not und sein Privileg. Seine Not: Wir können in der Welt überhaupt nicht bestehen, wenn wir uns nicht um deren Erkenntnis bemühen. Doch dies ist zugleich unser Privileg: Forschend und erkennend ragen wir über andere Geschöpfe hinaus.
Das Lob der Forschung ist uns heute nicht mehr selbstverständlich. Vor allem in der jüngeren
Generation mehren sich die Anklagen: Diese Wissenschaft, die sich in ihrem Aufschwung im Weltmaßstab zum großen Teil auch machtpolitischen und militärischen Interessen verdankt und verschreibt, und die uns auch im Alltag in wachsenden Umweltschäden gefährdet, sie ist eine potentiell und aktuell zerstörerische Macht.
Pauschalem Mißtrauen ist geduldig und beharrlich entgegenzusteuern. Doch die Gründe des Mißtrauens dürfen nicht vom Tische gewischt werden. Sie müssen bedacht und kritisch aufgenommen werden. Nicht alles, was erforschbar ist, ist fraglos zu erforschen.
Die Stiftungsbulle der Basler Universität stellt und beantwortet auch die Frage nach dem Ziel und Sinn der Wissenschaft: „quae bene beateque vivendi viam pre-bet“ (sie weist den Weg zu gutem und glücklichem Leben). Menschliche Wissenschaft ist keine mit anderen wesentlichen Lebensbereichen unverbundene Größe. Sie dient dem Leben, und nicht nur das: dem guten und glücklichen Leben.
Jahrhundertelang wurde die wissenschaftliche Forschung als ein Unternehmen .Jenseits von Gut und Böse“ verstanden. Dies hatte zum Teil verständliche Gründe, etwa als Abwehr gegen moralisierende oder gar ideologische Bevormundung wissenschaftlicher Arbeit. Demgegenüber wurde vertreten: Saubere Methodik ist die einzige Ethik der Wissenschaftler.
Heute wächst der Konsensus, daß der Wissenschaftler nicht nur der technischen Frage nach dem Können, sondern auch der ethischen (und politischen) nach dem Dürfen verpflichtet ist. Die Perle der Wissenschaft erstrahlt in ihrem ursprünglichen Glanz nur in Ausrichtung auf „gutes und glückliches Leben“, also als menschenfreundliche Forschung.
Es gibt in unserer Präambel noch einen anderen Hinweis in dieser Richtung. Es ist das Zeichen und Ziel anzustrebender Wissenschaft, daß sie „die in tiefster Niedrigkeit Geborenen zu den Höchsten hinaufhebt“. Spitzenforschung ist in jeder Zeit primär die Sache der intellektuellen Elite, aber sie braucht deswegen keineswegs eine elitäre Angelegenheit zu bleiben, als Interessenverbund der Profitierenden und Privilegierten. Daß diese Versuchung besteht, ist kaum zu leugnen. Doch vor ihr zu kapitulieren, wäre ein Verrat am Geiste der abendländischen Wissenschaft, wie sie unserer Präambel vorschwebt.
Eine menschenfreundliche Forschung ist der Gemeinschaft verpflichtet, und das heißt: besonders den in der jeweiligen Situation Benachteiligten. Am Ende des 20. Jahrhunderts darf diese Ausrichtung nicht schon an den Grenzen einer Stadt und auch nicht eines Landes haltmachen, sondern soll die Interessen der Unterprivilegierten im globalen Rahmen mitberücksichtigen, auf die „populorum progressio“ (um das Wort eines der Nachfolger Pius II. aus! unserer Zeit aufzunehmen), die Entwicklung der Völker, hin.
Die Sätze der Basler Stiftungsurkunde werden geprägt durch einen durchgehenden Unterton der Zuversicht und Hoffnung. Der Stifter ist vom guten Sinn seiner Stiftung, der Universität, zutiefst überzeugt. Er sieht sie im umfassenden Sinnhorizont, und der läßt ihn nicht zweifeln: Der menschliche Drang nach Erkenntnis greift nicht in die Leere; beharrliches Studium gelangt zum Ziel; der Weg zum guten und glücklichen Leben ist offen: auch die in tiefster Niedrigkeit Geborenen können Höheres erreichen.
Für die Benachteiligten
Solche hoffnungsvollen Töne sind uns aus der Geschichte der neuzeitlichen Wissenschaft nur zu gut bekannt. Ihre Epoche von der Renaissance über Humanismus und Aufklärung bis ins 19. Jahrhundert ist doch durch einen geradezu ungebrochenen Fortschrittsglauben und Optimismus gekennzeichnet. Die Sonne des Menschengeschlechtes gehe auf, wir seien unwiderstehlich auf dem Weg zum Guten und zum Glück, unsere Wissenschaft habe Schlüssel von Himmel und Erde.
Die Präambel ist kein Dokument einer schwärmerischen und undifferenzierten, sondern einer nüchternen und differenzierten Zuversicht. Das erste und bestimmende Prädikat, mit welchem vom Menschen im Text gesprochen wird, ist „mortalis“, der Sterbliche. Dem sterblichen Menschen gilt die Verheißung. Es ist nicht alles umsonst „in diesem hinfälligen Leben“ (in hac labili vita). Die Präambel sieht es in einen tragenden, umfassenden Sinnhorizont eingebettet. Der • tragende Grund dieses Horizontes ist Gott.
Der Hinweis auf Gott im Zusammenhang mit der Idee der Universität hilft uns, die vermessenen Verabsolutierungen und Ansprüche der „big brothers“ in Wissenschaft (und Politik) zu entmythologisieren, die menschliche Bedingung zu respektieren, und vor allem: die unaufgebbare Verantwortung des persönlichen und sozialen Gewissens der Wissenschaftler einzuschärfen.
Vielleicht kann diese theologische Perspektive auch in unserem wissenschaftlichen Alltag sinnvoll aufleuchten. Jede Wissenschaft kennt nicht nur Stunden der Erfolge, sondern auch des Scheiterns; jedes Forschungsinstitut nicht nur den Freudeaufschrei „Heureka!“, sondern auch Seufzer der Niedergeschlagenheit und Skepsis: Wozu das alles?
Die Erinnerung an Gott entkrampft und ermutigt. Entkrampft: Wir sind nicht die allmächtigen Macher, die Herren über Leben und Tod. Die Aufgabe der Wissenschaft ist unseren Händen und Köpfen anvertraut, sie liegt aber nicht ausschließlich in' unseren Händen. Wir nehmen unsere Forschung ernst, aber nicht todernst. Wir brauchen nicht Atlanten zu spielen, die das Lebens- und Todesgeschick der Menschheit auf eigenen Schultern tragen müssen. Das entkrampft.
Doch dies ermutigt zugleich: Wir sind, ex dono Dei, auf keinem endgültig verlorenen Posten mehr, kein ewiger Sisyphos. Unser Werk, unsere Wissenschaft, unser Leben stehen unter der bleibenden „Dennoch-Verhei-ßung“. Es ist nicht sinnlos, als Menschen und Forscher unsere kleineren und größeren Steine an unseren Fakultäten und in unseren Instituten einige Schritte in menschenfreundlicher Forschung bergauf zu tragen.
Ist dies alles nicht zu idealistisch? Ist eine so konzipierte Idee der Universität nicht nur wegen der historischen Distanz des Ansatzes, sondern vor allem wegen ihres Gehalts zu „erhaben“, um wahr zu sein?
Sintflut ohne Noah?
In seiner Rede zum 500. Jahrestag der Universität Basel stellte Karl Jaspers sich diese Frage und skizzierte ein realistisches Bild heutiger Verhältnisse: „Die Wissenschaften sind zerfallen in Bereiche, die voneinander kaum Kenntnis nehmen. Die Universität ist ein Aggregat von Fachschulen spezialistischer Ausbildungen. Sie ist ein Warenhaus, in dem jeweils die für bestimmte Zwecke begehrten Kenntnisse zu erhalten sind. Hinter der organisatorischen Ordnung versteckt sich die Anarchie des Geistes. Die Glaubensgrundlagen sind verschwunden oder werden nicht eingestanden.“
Gerade angesichts der Orwell-schen Tendenzen in einer Zeit der bedrohlichen Entwicklungen auf äußere und innere Selbstzerstörung der Menschheit hin - Jaspers spricht von einer möglichen „Sintflut ohne den überlebenden Noah“ - ist der in der Idee der Universität angelegte kommunikative Wille zur menschenfreundlichen Wissenschaft und Wahrheit das Eine, was uns not tut.
Der Autor ist Professor für Systematische Theologie an der Universität Basel. Aus einem Vortrag im Sommer 1985 bei einem Symposium der Katholischen Hochschulgemeinde Graz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!