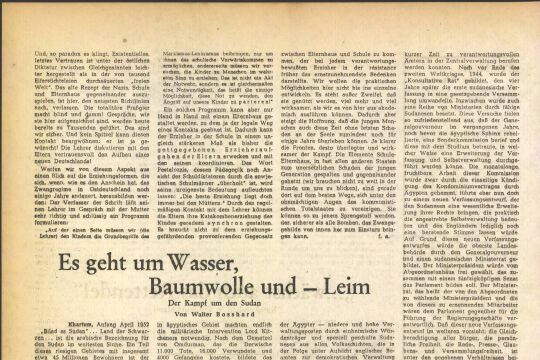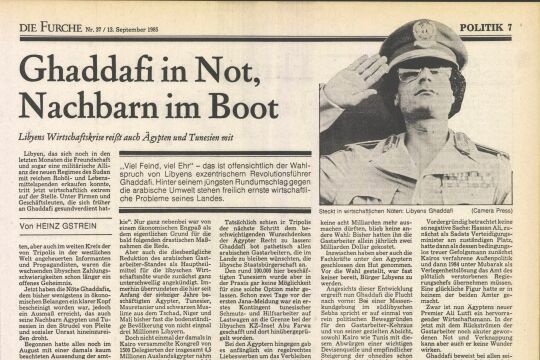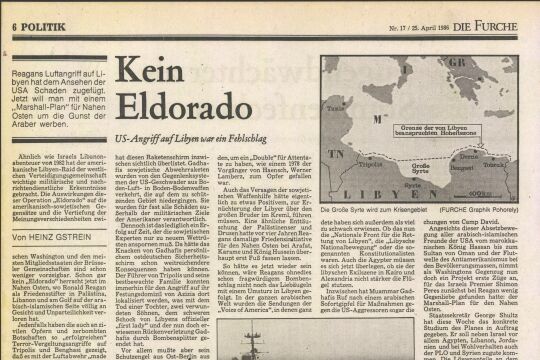Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kein Glück
In Tschad, dem selten in den Schilagzeilen der Weltpresse auftauchenden afrikanischen Wüsten- und Nomadenland zwischen Libyen, Sudan, Niger und den zentralafrikanischen Kleinstaaten, war man peinlich berührt, als der auf dem Rück-flug von der panislamischen Gipfelkonferenz in Labore befindliche libysche Militärdiktator Gaddafi nach einer Zwischenlandung in Uganda auch der früher Fort Lamy genannten Hauptstadt Ndjemena einen un-angekündigten Staatsbesuch abstattete. Der Fusionsplan für Libyen und Tschad, den el-Gaddafl nach der Landung entwickelte, stieß auf offenes Mißtrauen.
Das Scheitern seiner Unionspläne, zunächst mit Ägypten und dann mit Tunesien, seheint den Tripolitaner Diktator keineswegs davon abzuhalten, weiter auf die territoriale Ausdehnung seiner Macht auszugehen. Der triumphale Empfang, den ihm sein Geistes- und Gesdnniungsforuder Idi Amin, Exboxer und von eigenen Gnaden vom Feldwebel zum General beförderter Selbstherrscher des schwaraafrikanischen Kleinstaates Uganda, in dessen Hauptstadt Kam-palia bereitete, scheint ihn in dem Glauben bestärkt zu haben, daß er nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in Afrika eine historische und religiöse Mission zu erfüllen habe. In Kampala trägt jetzt sogar ein öffentlicher Platz den Namen des exzentrischen Libyers.
Tschadische Diplomaten schwören Stein und Bein, ihre Regierung sei von der Ankunft des ungebetenen Gastes völlig überrascht worden und es gebe keinerlei Informationen über einen auch nur lockeren staatlichen Zusammenschluß zwischen den beiden Nachbarländern. Im Tschad erinnert man eich nur noch allzu gut an die Sklaven jäger, die im vorigen Jahrhundert ins eigene Territorium einfielen und mit riesigen Karawanen „schwarzen Goldes“ wieder abzogen. Diese Menschenjagden trugen wesentlich bei zur bevölkerungspolitischen Ausblutung der früheren französischen Kolonie. In diesem JahTbundert müssen die Tschadis erleben, wie ihr Tschadsee unter dem ehrgeizigen Hochstaudammprojekt der Ägypter bei Assuan leidet. Seit der „Nasser-See“ als größtes Energiereservoir des Niltales dient, sinkt der Wasserspiegel des Tschadsees. Man nimmt an, daß die Ägypter, freilich unwillentlidh, durch ihre Was-sertiefibohrungen zur Erschließung neuer landwirtschaftlicher Anbaugebiete unterirdische Abflüsse des Tschadsees angebohrt haben. Für die Tschadis kam aus dem Norden noch nie Gutes. Zwar bekehrten sich viele von ihnen zum Islam, als im Gefolge der Sklavenhändler muselmanische Missionare in ihre Zelte und Hütten kamen. Von den etwa dreieinhalb Millionen Einwohnern sind heute wenig mehr als die Hälfte Mostems. Das arme Land, das schwer unter der Hungersnot der ganzen Sahel-Zone zu leiden hat, würde zudem sicher nicht ungern an libyscher „Entwicklungshilfe“ partizipieren. Doch die Regierung in Ndjemena erinnert sich noch allzugut an die Bluttaten islamischer Aufständischer, die nur mit französischer militärischer Hilfe unterdrückt werden konnten, und die durch eine engere Zusammenarbeit mit Libyen vielleicht wieder aufgeweckt werden könnten.
In Tschad sind außerdem nicht nur islamische, sondern auch europäische religiöse und vor allem kulturelle Einflüsse wirksam. Etwa ein Viertel der Bevölkerung, gleichzusetzen etwa mit der politischen und wirtschaftlichen Führungsschicht, sind Christen. Frankreich ist hier noch immer das alles andere überstrahlende Vorbild. Die etwas mehr als neunzigtausend Einwohner zählende Hauptstadt ist ein afrikanischer Abklatsch einer französischen Provinzstadt. Der Eiferer el-Gaddafl konnte hier kaum auf Beifall hoffen, als er gegen die Gleichberechtigung der Frau und die (dort recht harmlosen und betulichen) Nachtklubs wetterte. Präsident und Regierung enthalten sich denn auch jeglichen Kommentars zu dem Fusionsangebot el-Gad-dafis. Für diesen gibt es, wie er in Ndjemena. verkündete, künftig keine Grenze mehr zwischen seinem Land und dem Tschad. Sein Gastgeber, ein sehr machtbewußter Mann, amtiert jedoch ungerührt weiter, und sein Grenzschutzkorps tut weiter seine Pflicht.
„Es gibt keine Fusion zwischen unseren beiden Ländern“, erklären tschadische Diplomaten in arabischen Hauptstädten glaubhaft. „Nach den Erfahrungen, die Ägypten und Tunesien mit Oberst el-Gaddafi machten, werden wir uns doch nicht mit diesem merkwürdigen Mann einlassen.“ Wie merkwürdig dieser Mann ist, zeigte erst jetzt wieder der greise tunesische Staatschef Habib Bourgiba. Er ritt die bislang bissigste Attacke gegen seinen Nachbarn im Osten. Wer künftig behauptet, el-Gaddafl sei nicht ganz zurechnungsfähig, wird sich auf Bourgiba berufen können. Was aber nicht erklärt, warum auch der zurückhaltende alte Tunesier sich erst einmal von dem Heißsporn aus Tripolis umarmen ließ.dies voraus, daß zwischen der Minderheit und dem Muttervolk oder dem Staat des Muttervolkes ein klares Verhältnis besteht. Die Mitglieder der Minderheit sind (oder sollten sein) gleichberechtigte Bürger des Staates und sollen (oder sollten) sich im Rahmen der geltenden Ver-fassungsbestimmiungen politisch oder wirtschaftlich frei betätigen. Die
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!