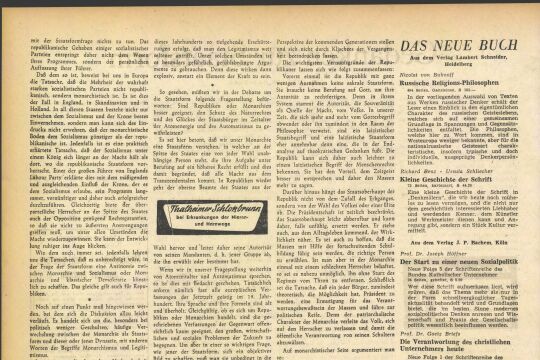Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Warum Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand?
Politische Parteien, Gewerkschaften und Interessensvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben ihre - teilweise unterschiedlichen - Ansichten zur „Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand” vor der Öffentlichkeit dargestellt, indem sie Pläne erarbeitet haben, deren Für und Wider bei der Katholisch-Sozialen-Ta-
gung 1977 des Institutes für Sozialpolitik und Sozialreform (Dr.-Karl- Kummer-Institut) diskutiert werden soll.
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand sieht als Ziel nicht die Förderung allgemeiner Sparformen, also Geldvermögensbildung, oder einige Formen des Wertpapiersparens an, sondern will eine Beteiligung der Arbeitnehmer an den Produktionsmitteln, also an betrieblichem Vermögen erreichen. Die Gründe, die zu einer breiten Diskussion der Frage geführt haben, Hegen einerseits in der behaupteten Konzentration des betrieblichen Vermögens. In Österreich existiert keine Statistik über Vermögensverteilung. Es liegen-lediglich Schätzungen vor, doch können deutsche Untersuchungen, die feststellen, daß lediglich
1,7 Prozent der Haushalte 70 Prozent des Eigentums an Gewerbebetrieben besitzen, für Österreich durchaus als Richtzahl übernommen werden. Gerade diese Vermögensmasse weist ein besonders starkes Wachstum im Vergleich zu anderen Vermögen auf. Das Eigentum des Staates an betrieblichem Vermögen wird auch in unserer Wirtschaft mit ihrem hohen Verstaatlichungsgrad überschätzt: Lediglich 32 Prozent des gewerblichen Vermögens im Bereich der Industrie und des Baugewerbes können als realistischer Staatsanteil angesehen werden. Daß die Konzentration der Vermögen in Österreich niedriger ist als in der Bundesrepublik Deutschland, kann von vornherein nicht angenommen werden. In Österreich existieren viele Familienbetriebe, die steigenden Einkommen der Angestelltenhaushalte wurden wesentlich mehr im Geldvermögensbereich angelegt. Jedenfalls kann angenommen werden, daß ein beachtlicher Anteil am österreichischen gewerblichen Vermögen sich in den Händen weniger Privater (und des Staates) befindet.
Die Vermögenskonzentration steht nun in einem paradoxen Verhältnis zur Tatsache, daß das Eigentum zunehmend an Einfluß und daher an Attraktivität verloren hat, es zur „Legitimationskrise”. des Eigentums gekommen ist, die darin besteht, daß die effektive Verfügungsmacht über das Eigentum bei einem Manager liegt, der Eigentümer hingegen immer weniger Einfluß auf die Unternehmenspolitik selbst in marktwirtschaftlichen Systemen hat. Weltweit nimmt die Eigentümerkette zu; zwischen Eigentümer und Manager sind zahlreiche „Intermediäre” zwischengeschaltet. Jede Verlängerung der Eigentümerkette bringt eine größere Autonomie des letzten Entscheidenden (Managers) vom ersten Eigentümer. Beide Phänomene, das Auftreten von Managern und die Eigentümerketten haben aber nicht zu einer Ineffizienz der Wirtschaft geführt. Damit aber ist die These, daß der Eigentümer optimal für den Einsatz wirtschaftlicher Kräfte sorgt, nicht mehr aufrechtzuhalten.
Welche Einstellung hat nun die Gesellschaft zur Frage der Vermögensbildung? Der „überflüssige” Eigentümer wird in seinem Machtanspruch zunehmend eingeschränkt. Der Machtanspruch des Eigentümers begründet sich auch in der Rechtsordnung, die der Idee des absoluten Eigentums verpflichtet ist. Diese entspricht aber keiner vermögenspolitischen Zielvorstellung, die etwa aus der Katholischen Soziallehre oder sogar aus der sozialen Marktwirtschaft abgeleitet werden kann. Die beobachtbaren Tendenzen der Vermögenskonzentration und die Legitimationskrise stellen ledigiglich reale Phänomene dar, die bei der Verwirklichung von Vermögensbildungsplänen beachtet werden müssen.
Die Konzentrationstendenzen selbst lassen sich durch eine Streuung der Fähigkeiten nicht mehr erklären. Die Bildung und Ausbildung ist in Österreich wesentlich breiter gestreut als die Vermögen. Es könnte nun die Frage gestellt werden, warum diese „Fähigen” vom Vermögen weitgehend ausgeschlossen bleiben. Nicht zuletzt deswegen kann die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand das große politische Thema der kommenden Jahre werden.
Vor allem werden in den Modellen zur Vermögensbildung betriebliche und überbetriebliche Ansätze zu unterscheiden sein. Das Argument der betrieblichen Vermögensbüdung war naturrechtlicher Art, daß der Arbeitnehmer berechtigt sein soll, an seinem Produkt, das in seinem Unternehmen entsteht und das er mitgeschaffen hat, zu partizipieren. In Deutschland ist aber selbst die CDU von einer starken Fixierung auf die betriebliche Vermögensbildung abgegangen und lehnt nicht jede Form der überbetrieblichen Vermögensbüdung von vornherein ab. Die betriebliche Vermögensbüdung bringt in einer Art Konkurrenz zwischen Arbeitnehmer und Eigentümer weitere Probleme durch das Auftreten eines „Eigentümerinteresses” des Arbeitnehmers mit sich. Die betriebliche Vermögensbüdung hat auch den Nachteil, daß die relevante Vermögensmasse gering ist. Die Vermögenspolitik zeigt, daß die großen Vermögen im Bereich der Industrie entstehen, wo der Staatsanteü - ebenso wie das Auslandskapital, welches die Gefahr der Abwanderung in sięh birgt - dominiert.
In Österreich haben wir relativ wenig Arbeitnehmer im Industriebereich, der Dienstleistungssektor ist stärker ausgeprägt (Banken, Versicherungen, Verkehr). Der vermögenspolitische Spielraum ist bei der überbetrieblichen Vermögensbüdung relativ größer, der Risikoausgleich für den einzelnen Arbeitnehmer verhindert, daß das Vermögensrisiko und das Arbeitsplatzrisiko in einem Betrieb zusammenfallen und die Regelung der Abschichtungsprobleme bei Ausscheiden des Arbeitnehmers erscheinen leicht lösbar. Die angeschnittenen Probleme der Vermögensbildung sollen nicht die „einfache Lösung” der Bildung eines zentralen Fonds befürworten. Hiebei wird, entgegen den Implikationen der Eigentumsstreuung, Machtanhäufung eines Apparates betrieben, dessen zwangsläufig bürokratisch-schwerfällige Handhabung eine Transparenz der Entscheidungsprozesse im Fonds und die Möglichkeiten der Einflußnahme der einzelnen Eigentümer der Anteile auf die Politik des Fonds illusorisch erscheinen lassen.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Ziele einer Vermögensstreuung politisch wirksam werden können. Die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft stehen im Grunde einer Konzentration der Vermögen ebenfalls negativ gegenüber, deswegen, weü Machtanhäufung oft zu Machtmißbrauch führt; ein Argument, das sich selbstverständlich auch gegen den Staat richtet. Die Wettbewerbsgesetze, die Einschränkung der Monopole und Kartelle liegen einem marktwirt- schaftliehen Konzept ebenso wie den Anliegen der Katholischen Soziallehre nahe.
Bei der überbetrieblichen - und differenzierten - Form der Vermögenspolitik ist auch infolge der größeren Vermögensmasse, die zur Verwirklichung von Vermögensplänen zur Verfügung steht, die Legitimationskrise der Institution des Eigentums weitgehend zu vermeiden. Es muß lediglich gewährleistet werden, daß durch die reale Verfügungsmacht der Manager die Wirtschaft weiterhin effizient organisiert wird. Die direkte Beteiligung kann durch die Weckung eines Eigentumsinteresses zu einer gewissen Frustration des Arbeitnehmers führen, wenn dieser erkennen muß, daß sein Einfluß auf die Betriebsgestaltung trotz Beteiligung gering ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!