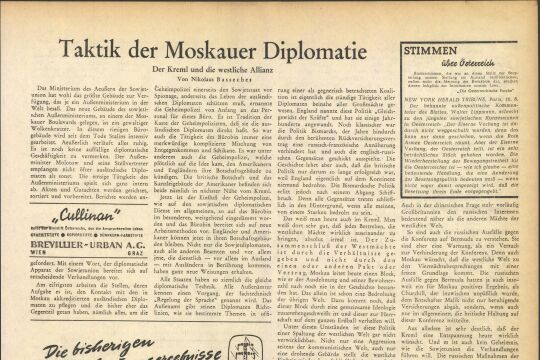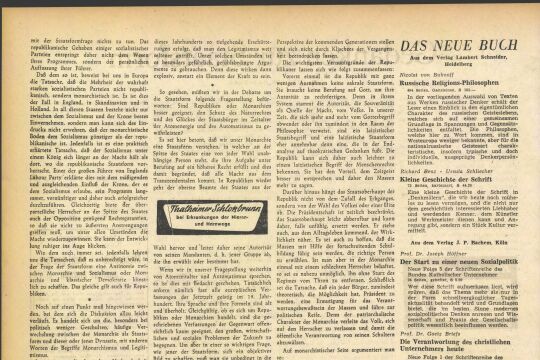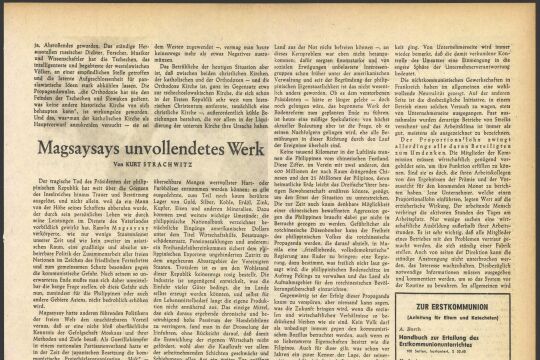Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Marx auf den Kopf stellen
Ein Dauerbrenner in der wirtschaftspolitischen Diskussion ist seit dem Sommer die Forderung der Volkspartei nach Privatisierung. Wodurch ist sie gerechtfertigt?
Ein Dauerbrenner in der wirtschaftspolitischen Diskussion ist seit dem Sommer die Forderung der Volkspartei nach Privatisierung. Wodurch ist sie gerechtfertigt?
Mir persönlich ist egal, ob der Staat (hier der Bund) 11,9 Prozent der Anteile an der Porzellanmanufaktur Augarten AG in Wien hält, oder 3,6 Prozent der Zillerta-ler Verkehrsbetriebe AG, oder 52 Prozent der Austria Wochenschau GmbH. Wenn sich angemessene private Bieter finden — warum, in der Tat, sollen derartige Beteiligungen nicht über die
Börse oder allenfalls direkt an Private verkauft werden? - Es ist ja nicht so, daß der Bund in den letzten 15 Jahren krankhafte Berührungsängste hinsichtlich des Privatkapitals entwickelt hätte. Ganz im Gegenteil. Die VOEST hat private Industriefirmen gekauft, die Gesellschaft für industrielle Bundesbeteiligungen hat marode Industriebetriebe aufgefangen, die Creditanstalt hat einige ihrer Beteiligungen an Privatfirmen verkauft. Wenn man unbedingt will, kann man diese Aktionen Verstaatlichungen und Privatisierungen nennen. Für ihr Verständnis wäre damit gar nichts gewonnen. Sie beruhen auf konzern- und industriepolitischen Motiven, nicht auf ideologischen.
Privateigentümer, so hören wir, seien stärker am langfristigen Wohl ihres Unternehmens interessiert als staatlich bestellte Manager. Dieses Privatinteresse konnte nicht verhindern, daß Fir-. men wie Eumig, Funder, Wienerwald oder AEG ins Schleudern gekommen sind. Privatunternehmer trügen in vollem Ausmaß die Risken ihrer Entscheidungen. Dieses Argument ist insofern falsch, als die Kosten eines Konkurses teilweise nicht den Unternehmer, sondern seine Kreditgeber - Lieferanten und Banken -treffen, von den Verlusten für die betroffenen Arbeitnehmer zu schweigen (Arbeitsplatzsuche, Wohnungswechsel, Verluste an firmenspezifischem Humankapital).
Davon abgesehen kennzeichnet das Bild des vollhaftenden Eigentümer-Unternehmers den Primitivkapitalismus des 19. Jahrhunderts, heute allenfalls das Gewerbe und industrielle Kleinbetriebe. Der Kapitalbedarf eines Industrieunternehmens übersteigt die Möglichkeiten eines Einzelunternehmers in der Regel bei weitem. Daher ist der entwickelte Kapitalismus des 20. Jahrhunderts geprägt durch die anonyme Kapitalgesellschaft, die von einem angestellten Management geführt wird.
Die Bestellung zum Manager eines öffentlichen Unternehmens sei mitunter mehr von politischen Verbindungen als fachlicher Qualifikation abhängig, sagt man. Das ist wohl unbestreitbar. Auch die ÖVP hat den einen oder anderen ihrer Landespolitiker zum Manager eines Unternehmens der E-Wirtschaft gemacht; Privateigentümer setzten mitunter übertriebene Hoffnungen auf den (Schwieger-)Sohn. Wesentlicher ist die Behauptung, glücklose Manager öffentlicher Unternehmen hätten zuwenig mit Sanktionen zu rechnen. Auch dafür lassen sich Belege finden: ÖVP wie SPÖ tendieren dazu, Manager ihrer Couleur auch bei Erfolgslosigkeit zu stützen.
Nur: wird die (weitere) Privatisierung von Unternehmensanteilen daran so viel ändern? Die Sanktionen gegenüber einem glücklosen Management waren bei der Elin, zu 100 Prozent verstaatlicht, stärker als bei manchen Unternehmen des CA-Kon-zerns, an denen privates Kapital beteiligt ist. Das Problem der Kontrolle des Managements ist komplex, durch eine bloße Uber-tragung von Eigentumstiteln wird es nicht gelöst werden.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, dem Beginn des Siegeszugs der Publikumsgesellschaft — der Kapitalgesellschaft mit vielen privaten Anteilseignern —, gibt es eine ständig und immer noch wachsende Literatur darüber, daß das Verhältnis zwischen Managern und Eigentümern Mängel aufweist, daß Anreize und Sanktionen für das Managerverhalten zum Teil in die falsche Richtung gehen, daß die Aufsichtsräte versagen. Wohlgemerkt, alles Diagnosen für private Unternehmen.
Ein großer Teil der Probleme läßt sich darauf zurückführen, daß der private Kapitalanleger Informationsdefizite hat und kaum einen Anreiz, diese zu beseitigen. Denn, um sein Risiko zu begrenzen, tut der private Anleger gut daran, kleine Anteile an mehreren Firmen zu halten. Er müßte Zeit und anderen Aufwand auf sich nehmen, um sich umfassend zu informieren. Meldet er sich dann in der Hauptversammlung zu Wort, so profitieren alle anderen Anteilseigner von seiner In-formation, ohne zu deren Kosten beizutragen. So werden sie zu „Schwarzfahrern“ seiner Informationsbereitstellung; sein Stimmrecht ist aber verschwindend klein. Da sich alle ökonomisch gebildeten Aktionäre dieser Situation bewußt sind, ist der Spielraum des Managements in dieser Hinsicht groß.
Wir brauchen mehr Unternehmer, sagt man. Schön. Unternehmerische Initiative soll ermuntert und gefördert werden. Einverstanden. Auf welche Weise die Privatisierung von Minderheitsbeteiligungen an staatlichen Banken oder Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft - ganz wül auch die ÖVP das Heft nicht aus der Hand geben - einen einzigen zusätzlichen Unternehmer gebären soll, ist unerfindlich.
Die Marktzutrittsbarrieren zu senken für Leute, die sich selbständig machen wollen, halte ich für eine aufregende und lohnende politische Aufgabe. Hat die ÖVP energisch Stellung bezogen in der Frage, ob Rechtsanwälte zur Eröffnung einer Kanzlei das Doktorat brauchen? Ist es günstig, daß Apotheken zu Pfründen werden, weil Neuzulassungen schwierig zu erreichen sind? Würde nicht eine weitere Liberalisierung der Gewerbeordnung manchem jungen Unternehmer den ersten Schritt erleichtern?
Alle scheinen sich einig zu sein, daß der Markt für Risikokapital in Österreich unzureichend funktioniert. Die einfachste Risikokapitalförderung ist die steuerliche Erfassung der Erträge aus Nichtrisikokapital. Nach den Qualen mit der Zinsertragsteuer kann man verstehen, daß Politiker dieses Thema wie den Leibhaftigen meiden.
Privatisierung kann sinnvoll sein, wenn sie mit Übernahme unternehmerischer Aktivität oder
Übernahme von Risken, die bisher vom Staat getragen wurden, durch Private verbunden ist. Den Verkauf von Minderheitsbeteiligungen an staatlichen Monopolunternehmen halte ich für eine drittrangige Frage, die von wichtigeren wirtschaftspolitischen Themen lediglich ablenkt.
Karl Marx lebt. Aber nicht in den Köpfen der Sozialisten, sondern in den Köpfen der sogenannten Bürgerlichen. Diesen Eindruck erhält man bei so manchen begeisterten Plädoyers zugunsten des Verkaufs von Anteilen an staatlichen Unternehmen an Private.
Vor bald 140 Jahren ortete das Kommunistische Manifest die Ursache (fast) allen Unheils dieser Welt im privaten Eigentum an Produktionsmitteln. Diese Diagnose war damals bestenfalls eine allzu grobe Vereinfachung, schlimmstenfalls war sie einfach falsch. Im Werbefeldzug für Privatisierung wird Marx auf den Kopf gestellt. Die Diagnose wird dadurch nicht wesentlich besser. Wie sagte Marx im XVIII. Bru-maire? Geschichte wiederholt sich; aber was beim ersten Mal eine Tragödie war, wird beim zweiten Mal zur Farce.
Der Autor ist Professor am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!