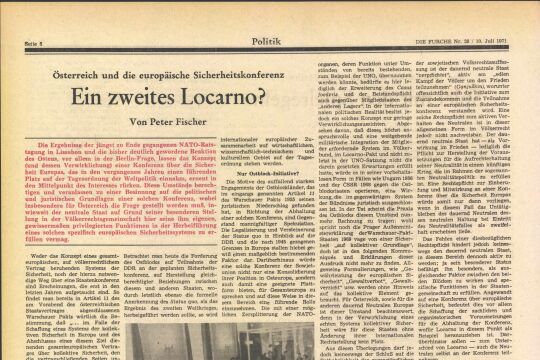Das Geburtstagsständchen zu den 60-Jahr-Feiern der NATO, vorgetragen von zwei Experten für Sicherheitspolitik, ist mehr in Moll und weniger in Dur geraten. Sehr viele Fragen sind für die beiden zum Jubiläum ungeklärt. Und mit der EU wächst der NATO ein sicherheitspolitisch ehrgeiziger junger Bruder heran.
Die NATO feiert ihren 60. Geburtstag - und was ändert sich dadurch? In Abwandlung des Liedes eines österreichischen Komponisten und Sängers stellt sich die Frage: Fängt für die NATO mit 60 das Leben tatsächlich erst richtig an oder ist vielmehr nicht eher schon Schluss? Denn seit zwei Jahrzehnten ist eine Debatte über Sinn und Nutzen der Allianz im Gang. Ausgelöst durch immer neue Konstellationen in den internationalen Beziehungen und den sich verändernden sicherheitspolitischen Herausforderungen. In der Phase der Ost-West-Konfrontation war es ein Leichtes, die Existenz der NATO zu erklären. Mit dem Wegfall dieses Gegeneinanders und der sich seit dem Ende der 1990er entwickelnden Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) der EU ist Erklärungsbedarf bezüglich der 26 (demnächst 28) Staaten umfassenden NATO entstanden.
Amerikanische Interessen berücksichtigen
Sich bei der NATO nur auf die Einsätze in Afghanistan und am Balkan zu konzentrieren, greift zu kurz. Die Problemlage ist vielschichtiger. Entscheidend dafür ist das Verhältnis zwischen der EU und der NATO. Bereits kurz nachdem Ende 1998 absehbar geworden war, dass die Mitgliedstaaten der EU einen eigenen - jedoch nicht von der NATO losgelösten - sicherheits- und verteidigungspolitischen Weg einschlagen werden, verdeutlichte Washington die aus der amerikanischen Interessenlage heraus zu beachtenden Prinzipien:
* Erstens sollten europäische Entscheidungen nicht losgelöst vom größeren NATO-Entscheidungsrahmen sein.
* Zweitens sei eine Duplizierung von Planungs- und Kommandostrukturen zu vermeiden.
* Und drittens sollten NATO-Mitglieder, die nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, durch die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht diskriminiert werden. In den Folgejahren kam es diesbezüglich immer wieder zu politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und den EU-Mitgliedstaaten. Gleichwohl haben die Europäer die Entwicklung ihrer ESVP kontinuierlich vorangebracht.
Im Zusammenhang mit der Aufnahme osteuropäischer Staaten in die NATO und anschließend in die EU kam es in diesem Jahrzehnt zu einer weiteren Bestimmungsdebatte hinsichtlich der sicherheits- und verteidigungspolitischen Rollenverteilung. Die neuen Mitglieder ordneten Sicherheit im klassischen engeren Sinne eindeutig der NATO und der Partnerschaft mit den USA zu. Doch wie sich im Zuge der Finanzkrise einerseits und angesichts der außenpolitischen Interessenverlagerung Washingtons weg von Europa andererseits zeigt, kommt der EU als einer in verschiedenen Politikbereichen Sicherheit bietenden Gemeinschaft wachsende Aufmerksamkeit zu.
Die Beziehungen zwischen der EU und der NATO, die nach dem Wortlaut der Europäischen Sicherheitsstrategie von 2003 eine strategische Partnerschaft darstellen sollten, werden durch das im Jahr 2003 verabschiedete "Berlin Plus"-Abkommen geregelt. Dieses Abkommen schafft die Basis für ein militärisches Handeln der EU im Falle eines Nicht-Eingreifens der NATO und den Rückgriff der EU auf - ihr fehlende - NATO-Mittel und -Instrumente.
Lange Zeit wurde der Abschluss dieses Abkommens durch die Türkei blockiert, erst die Einräumung des EU-Beitrittskandidatenstatus für die Türkei machte den Weg für den Abschluss frei. Derzeit wird die Operation EUFOR Althea in Bosnien-Herzegowina auf der Grundlage von "Berlin Plus" durchgeführt.
Die NATO selbst befindet sich in einem strategischen Dilemma. Ihr strategisches Konzept, das beim "NATO-50er" 1999 in Washington verabschiedet wurde, ist völlig überholt, weshalb beim Jubiläumsgipfel in Straßburg/Kehl ein Mandat für die Ausarbeitung eines neuen strategischen Konzepts verabschiedet werden muss.
Bündnisfall von USA dankend abgelehnt
Noch immer hochgehalten wird der Mythos des Bündnisfalles bzw. der militärischen Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages. Er wurde zum ersten Mal nach den Anschlägen des 11. September 2001 ausgerufen, von den USA aber dankend abgelehnt. Aber selbst im Bündnisfall bleibt die Art des Beistandes eine souveräne Entscheidung jedes einzelnen NATO-Staates.
In der aktuellen Debatte zur Zukunft der NATO kommt Frankreich eine besondere Bedeutung zu. Nach 43 Jahren wird Frankreich, nachdem es 1966 unter Charles de Gaulle aus den integrierten Kommandostrukturen ausgetreten war, auch militärisch wieder voll an der NATO teilnehmen. Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy will damit nicht nur eine neue Ära der französischen NATO-Politik beginnen, sondern auch eine grundsätzlich neue europäische NATO-Politik. Diese zielt darauf ab, die europäischen Verteidigungsstrukturen stark und eigenständig zu machen - ohne in Verdacht zu geraten, dies auf Kosten der NATO anzustreben. Die Re-Integration Frankreichs besitzt somit mehr als nur Symbolkraft. Es geht vielmehr darum, die NATO als Zwischenschritt bis zur Erreichung einer funktionsfähigen ESVP zu nützen.
Schwächen im zivilen Krisenmanagement
Die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Bestehens der NATO und ihre strategische Justierung mögen vielleicht kurzfristig den Anschein erwecken, dass eine neue Etappe transatlantischer Sicherheitspartnerschaft beginnt. Doch wenn die Kerzen auf der Geburtstagstorte ausgeblasen sind, dann wird neuerlich ersichtlich sein, dass vom einstigen Ruhm und Glanz wenig übrig ist. Dies liegt nicht daran, dass die EU bereits in der Lage wäre, selbst die Aufgaben der NATO zu übernehmen. Im Gegenteil: Die EU muss aufgrund ihrer noch entwicklungsbedürftigen ESVP auf die NATO als, Werkzeugkasten' zurückgreifen. Frankreichs Zwischenschritt-Logik einer europäischen Nutzung der NATO hat ihre volle Berechtigung.
Das existenzielle Problem der NATO ergibt sich aus der wenig Überzeugungskraft widerspiegelnden Unterstützung durch ihre Mitgliedstaaten auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Erfahrungen im Umgang mit Krisen und Konflikten des 21. Jahrhunderts lehren, dass ein umfassendes zivilmilitärisches Spektrum an Handlungsinstrumenten notwendig ist. Auch wenn nun der Anschein erweckt wird, die NATO würde diesem Anspruch gerecht, so zeigen die Realität und die Diskussionen um eine Umkehr von "Berlin Plus" jedoch die Schwäche der NATO im zivilen Bereich des Krisenmanagements.
Europa und Nordamerika kommen nicht umhin, ihre sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperation klar zu bestimmen und hierfür einen geeigneten institutionellen und operativen Rahmen zu definieren. Die Welt am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts unterscheidet sich fundamental von der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges. Die Zeit nach dem NATO-Gipfeltreffen wird zum Lackmustest dafür, ob die Allianz sich in dieser neuen Zeit behaupten kann.
* F. Algieri ist Forschungsdirektor und A. Kammel ist Generalsekretär am Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!