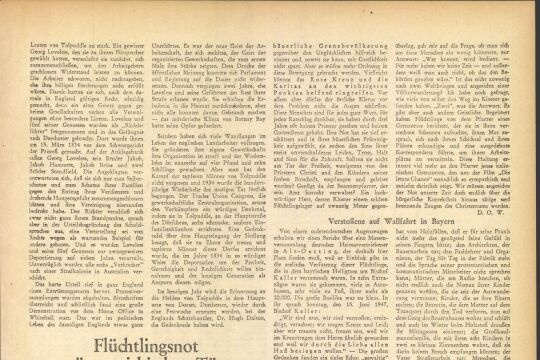40 Jahre dauert das Martyrium des Volkes der Rohingya schon. Zusammengepfercht in einem Lager im Süden Bangladeschs sind sie den Verfolgungen von Polizei und Kriminellen ausgesetzt.
Auf den Hügeln von Kutu Palong, im Süden Bangladeschs, ist die Armut mit Händen zu greifen: Ausgemergelte Frauen sitzen vor brüchigen Holzhütten, die mit dünnen Ästen zusammengezimmert sind. Kinder spielen mit verrissenen Plastiktüten. Und ein Geruch von Müll und Dreck wabert durch die schwül-heiße Luft.
28.000 Menschen campieren hier an diesem unwirtlichen Ort. Es sind Flüchtlinge der Rohingya, einer muslimischen Minderheit in Südasien. Die Polizei in Bangladesch reagiert mit brutaler Härte auf sie. "Die Repressionen begannen vor einem Jahr“, erinnert sich Mustafa Attu. Damals kam er nach Kutu Palong. Mit über 20.000 Leidgenossen muss er seither sich im Camp durchschlagen. Die Nahrung ist knapp, die Behausung eng. Fast zehn Flüchtlingen werden in eine Hütte gepfercht. Die Bewohner schlafen auf dem Boden, Fenster gibt es keine. Jeden Tag patrouillieren die Ordnungshüter der Stadt, um zu kontrollieren - und zu schikanieren. "Die Polizei ist ständig hinter uns her, sie will uns verhaften“, klagt Attu. "Ich fühle mich verfolgt. Eigentlich kam ich hier her, um Zuflucht zu finden.“
Das UN-Flüchtlingskommissariat, das in dem Lager präsent ist, soll den Menschen Schutz gewähren. Die Blauhelme helfen, wo sie können. Doch auch unter der Ägide der Vereinten Nationen sind die Menschen in dem Auffanglager vor gewalttätigen Übergriffen nicht sicher. Die Flüchtlinge berichten von Raubüberfällen und Vergewaltigungen. Immer wieder dringen Kriminelle in das Camp, marodieren und plündern das wenige Hab und Gut, das den Menschen noch geblieben ist. Es ist ein Leben in ständiger Angst. In ihrer Verzweiflung wagen viele Rohingyas die Flucht über den Golf von Bengalen nach Bangladesch. Auf einfachen Floßbooten segeln sie über die raue See, in der Hoffnung, an Land zu kommen. Ein gefährliches Unterfangen, das für einige tödlich endet. Stürme und Strömungen sind eine dauerhafte Gefahr. Und selbst wenn das rettende Ufer naht, werden die Gestrandeten von der Küstenwache bisweilen aufs offene Meer zurückgetrieben. Der Landeskoordinator von "Ärzte ohne Grenzen“ in Thailand, Richard Veerman, bestätigt die prekäre Lage: "Ihr körperlicher Zustand bei der Ankunft spricht Bände über das, was sie auf dem Meer durchgemacht haben. Wir müssen die Leute gegen Austrocknung schützen, sie haben Blutergüsse und Hautkrankheiten.“
Jahrzehnte auf der Flucht
Die Odyssee der Rohingyas hat eine lange Geschichte. Seit den 1970er-Jahren sind sie auf der Flucht. Dort, wo ihre Heimat liegt, in Arakan im Nordwesten Birmas, werden sie systematisch verfolgt. Der Grund: Sie sind muslimischen Glaubens. Und die buddhistische Junta in Birma unterdrückt die religiöse Minderheit mit brutaler Härte. Rohingyas dürfen nicht heiraten, nicht reisen und kein Eigentum erwerben. Wer dagegen verstößt, wird von der "Sittenpolizei“ verhaftet und in Internierungslager verschleppt. Folter und Zwangsarbeit sind an der Tagesordnung. Aus Furcht vor weiteren Repressalien sind seit Anfang der 1990er-Jahre über eine Million Menschen auf der Flucht. In Malaysia, Saudi-Arabien oder eben Bangladesch suchen die Heimatlosen ein neues Zuhause.
Die Vereinten Nationen bezeichnen die Rohingyas als eine der am "schlimmsten verfolgten Ethnien der Welt“. Dennoch scheint ihr Leid die Welt kaum zu berühren. Globale Aufmerksamkeit lenken andere Konflikte auf sich, wie etwa Darfur oder Haiti. Dabei täte eine konzertierte Hilfsaktion der internationalen Staatengemeinschaft in Bangladesch dringend not.
Indes weigern sich die Behörden vor Ort beharrlich, neue Flüchtlinge zu aufzunehmen. "Sie müssen zurück“, poltert der Bezirksvorsteher von Dacca. Gewiss, eine harsche Forderung. Doch hinter der rigiden "push-back-policy“ stehen demografische Zwänge: Bangladesch hat mit einer rasant ansteigenden Bevölkerungsentwicklung zu kämpfen. Jedes Jahr wächst die Bevölkerung um weitere drei Millionen Einwohner. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln stellt schon jetzt ein Drahtseilakt dar: Landwirtschaftliche Nutzflächen sind begrenzt, immer wieder werden die Bauern von Dürren und Überflutungen heimgesucht - so wie beim Monsun "Nargis“ oder den verheerenden Wirbelstürmen im Jahr 2009. All das macht es umso schwerer, die 400.000 illegalen Einwohner zu integrieren.
Doch bei allem Verständnis für unvorhersehbare Ereignisse reißt die Kritik internationaler Menschenrechtsorganisationen nicht ab. Sie geißeln Kutu Palong als "Gefängnis unter offenem Himmel“ und werfen der Politik vor, ihre Arbeit zu behindern. "Die Regierung von Bangladesch muss die Gewalt umgehend stoppen und den Menschen den Schutz bieten, der ihnen zusteht“, fordert Paul Critchley, Landeskoordinator der Organisation "Ärzte ohne Grenzen.“ Auch das UN-Hilfswerk nimmt er in die Pflicht: "Das UNHCR muss eine klare Strategie entwickeln, um das Problem zu lösen.“ Nur 6,85 Millionen Euro, berichtet die französische Wochenzeitung Courrier international, sind seit 2007 an Unterstützungshilfen ins Lager geflossen. Das macht pro Jahr gerade einmal 70 Euro für einen Bewohner - zu wenig, um ein ausreichendes Ernährung- und Elementarbildungsprogramm zu schaffen. Für Félix Léger, Missionschef der französischen Hilfsorganisation "Action contre la faim“, hat die missliche Lage in Birma primär strukturelle Ursachen. "Das Land ist reich an Ressourcen, doch diese sind ungleich verteilt.“ Ein paar wenige Großgrundbesitzer teilen die Bodenschätze unter sich auf und behandeln die Bauern wie moderne Sklaven. Die aufgeheizte Stimmung ist in dem Flüchtlingslager allenthalben spürbar. "Ich komme mir vor wie ein Stück Vieh, das durch den Schlamm getrieben wird“, zürnt Attu. Im Camp gibt es so gut wie keine Arbeit, und wenn, dann könne man nicht davon leben. "Wir werden überall ausgebeutet.“
Unkalkulierbares Risiko
So kommen die Eltern auch nicht umhin, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. "Die Jungen arbeiten alle illegal außerhalb des Camps“, sagt Imanshuri, ein Flüchtling. Beispielsweise durchpflügen sie Äcker oder fällen Holz in einem nahe gelegenen Waldstück, um es an die "registrierten“ Flüchtlinge zu verkaufen. Die Arbeit ist knochenhart, der Verdienst gering.
Bis zu zwölf Stunden am Tag schuften die Kinder. Die bengalischen Sicherheitskräfte sehen das freilich anders. Für sie sind die Flüchtlinge keine Opfer, sondern Täter. "Die Rohingyas besitzen keine eigene Geldquelle, also müssen sie arbeiten. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie eben kriminell“, behauptet Khalid Hossain, Polizeichef von Teknaf, einem Dorf an der Grenze zu Birma. "Sie begeben sich in ein unkalkulierbares Risiko.“
Fürwahr. Den Mädchen, die von ihren notgedrungenen Müttern losgeschickt werden, widerfährt zuweilen Schreckliches. Ein kleines Mädchen offenbart sich und erzählt von seinem grausamen Erlebnis: "Ich war mit fünf anderen Kameradinnen unterwegs im Wald, als zwei Polizisten auftauchten. Sie hielten mir ein Messer an die Kehle, dann flüchteten wir. Aber die Männer haben uns eingeholt. Und dann …“ Man muss nicht lange nachdenken, um zu verstehen, was passiert ist - Shazida wurde vergewaltigt. Trotz dieser furchtbaren Vorkommnisse gehen viele Frauen im Camp der Prostitution nach - es ist ihre einzige Möglichkeit, der Armut zu entfliehen. Die Freier kommen meist aus dem Dorf und bezahlen weniger als 200 Takas - das sind umgerechnet nicht einmal zwei Euro. Und doch ist es viel Geld für eine Rohingya. Das durchschnittliche Einkommen liegt bei etwa 20 Euro im Monat. Manchmal, sagen sie in Kutu Palong, sind die Hütten so klein, dass die Kinder dem Geschlechtsakt beiwohnen müssen. Es sind erschütternde Erzählungen, die an Rohheit nicht zu überbieten sind. "Ich bete“, sagt Zahera, "dass es einmal besser wird.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!