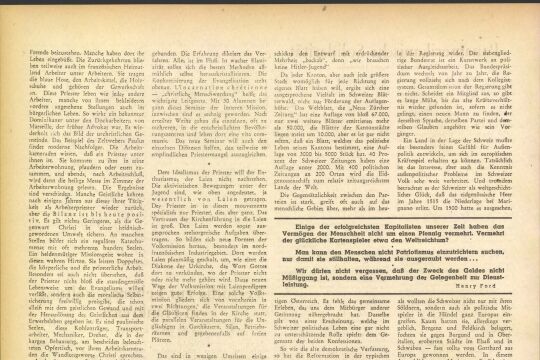Ursula Plassnik: „Die Schweiz ist eine Willensnation“
Ursula Plassnik und Botschaftsrätin Christina Bürgi Dellsperger vermessen die Tiefe des „Röstigrabens“, beschreiben den Kitt der Eidgenossen und pflichten Napoleon a posteriori bei. Ein Doppelinterview über die „Willensnation“ nebenan.
Ursula Plassnik und Botschaftsrätin Christina Bürgi Dellsperger vermessen die Tiefe des „Röstigrabens“, beschreiben den Kitt der Eidgenossen und pflichten Napoleon a posteriori bei. Ein Doppelinterview über die „Willensnation“ nebenan.
Christina Bürgi Dellsperger ist Schweizer Botschaftsrätin in Wien; Ursula Plassnik war nach ihrer Zeit als Außenministerin und Botschafterin in Paris die offizielle Stimme Österreichs in Bern. Beide verbinden Schweiz-Erfahrung von außen und innen und sehr viel Liebe zum Land mit den 26 Kantonen.
DIE FURCHE: Der Libanon wurde einmal die „Schweiz des Nahen Ostens“ genannt, Botswana trägt den Titel „Schweiz Afrikas“, Singapur beansprucht ihn für Asien … – ist die Schweiz der weltweite Maßstab für einen gelungenen Staat?
Christina Bürgi Dellsperger: Natürlich hört sich das für mich als Schweizerin, die ihr Land liebt, nett an. Es liegt ja auch einiges an Bewunderung drin. Aber jedes Land ist einzigartig und speziell. Deswegen können wir für uns nicht beanspruchen, wir sind der gelungenste Staat. Als Diplomatin habe ich das Privileg, viel herumzukommen. Ich denke mir oft, warum machen wir das in der Schweiz nicht so. Idyllische Schweiz-Bilder von unseren Bergen oder die Erinnerung an die Heidi-Filme machen die Schweiz vielleicht für Menschen anderswo zum Sehnsuchtsort und erzeugen ein verklärtes Bild von der Schweiz. Aber wir sind nicht der Nabel der Welt.
Ursula Plassnik: Es wäre schön, hätten wir weltweite Maßstäbe für „gelungene Staaten“! Nein, jede Gesellschaft ist auf der Suche nach den jeweils für sie passenden Lösungen. An der Schweiz fasziniert die anderen Bewohner des Weltdorfes, wie so unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Traditionen zusammenhalten und gemeinsam erfolgreich sein können. Auch ich bin als Botschafterin Österreichs durch die Schweiz gezogen und habe viele Gesprächspartner nach dem Erfolgsgeheimnis der Eidgenossen gefragt. Und woher diese Innovationskraft kommt in den Unternehmen, im starken Mittelstand wie auch bei den Riesen der Life Sciences und der Dienstleister.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
DIE FURCHE: Das Klein-aber-oho-Bild geht über das Politische hinaus. Die Schweiz wird mit Produkten wie Käse, Schokolade, Uhren, Messern assoziiert. Immer geht damit die Zuschreibung höchster Qualität einher. Geniales Marketing, oder können die Schweizer einfach vieles besser?
Plassnik: Kluges Marketing schadet nie, wir kämpfen doch alle um möglichst viel positive Aufmerksamkeit. Die Schweiz hat es geschafft, weltweit das Label „Qualität“ für sich in Anspruch nehmen zu können. Dahinter steckt harte Arbeit. Eine über Jahrzehnte durch Präzision und Verlässlichkeit erworbene Glaubwürdigkeit. Wenn man die Wahl hat zwischen zwei Produkten, traut man dem Schweizer Produkt quasi automatisch höhere Qualität zu. Ein wenig wie bei der französischen Küche. Oder Österreich bei der Musik.
Bürgi Dellsperger: Schweizerkreuz und „Swiss made“ sind natürlich starke Markenbotschafter. Am Ursprung liegt ein kleineres und ein größeres wirtschaftliches Problem der Schweiz. Das kleinere ist, wir haben keinen Zugang zum Meer, das größere, wir haben kaum Rohstoffe. Deshalb mussten wir uns auf etwas anderes konzentrieren und sind glücklicherweise sehr schnell, vor allem die reformierten Kantone, auf den Industrialisierungszug aufgesprungen. Die katholischen Kantone, viele sind ja auch in der bergigen Innerschweiz, blieben viel länger in der Landwirtschaft. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, Beispiel 1882 der erste Gotthard-Eisenbahntunnel, war ein Meilenstein für den Handel. Schließlich spielte für den wirtschaftlichen Erfolg auch eine wichtige Rolle, dass wir uns früh auf unsere Grenzen beschränkten und außenpolitisch neutral waren.
Es geht nicht um Aussöhnung von Gegensätzen, sondern um Respekt vor Andersartigkeit, ein Aushalten von Unterschiedlichkeiten.
DIE FURCHE: Wir reden über die Schweiz, aber die einzelnen Kantone bestehen vehement auf ihre Eigenständigkeit. Was ist der Kitt, der diese Vielfalt zusammenhält?
Plassnik: Der Wille zur Gemeinsamkeit. Die Schweiz ist eine beispielgebende Willensnation. Dazu gehört auch das nie erlahmende Bewusstsein, dass die Kantonsgrenzen zu eng sind für eine erfolgreiche Selbstbehauptung. Man muss „zusammenspannen“, auch mit Leuten, deren Mentalität einem vielleicht nicht ganz geheuer ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Schweizer fremdeln untereinander ganz ordentlich. Sie grenzen sich im Inneren geradezu lustvoll voneinander ab, das fängt beim Dialekt an. Da spielt vielleicht auch die Erfahrung der abgeschiedenen Alpentäler hinein.
Bürgi Dellsperger: Eine Erklärung ist unsere lange gemeinsame Vergangenheit, beginnend 1291 mit dem Rütlischwur. Unmittelbarer Grund dafür war damals die Befürchtung, fremdbestimmt zu werden, eine Einstellung, die sich bis heute durchgehalten hat. Dazu gehört der Stolz, dass unsere Vorfahren als einfache Bauern stolze Ritterheere besiegen konnten. Heute ist die Schweizer Vielfalt für uns eine geliebte Selbstverständlichkeit, die wir schätzen. Sie gehört einfach zu uns, wir hinterfragen sie nicht mehr.

Ursula Plassnik
Ursula Plassnik ist eine österreichische Diplomatin und Politikerin der ÖVP. Ab 2004 war sie als Nachfolgerin von Benita Ferrero-Waldner österreichische Außenministerin. Bis Dezember 2008 gehörte sie in dieser Funktion den Bundesregierungen Schüssel II und Gusenbauer an. Sie nahm seitdem ihr Abgeordnetenmandat im Nationalrat wahr. Am 6. Juli 2011 hielt sie ihre Abschiedsrede im Parlament und wechselte per Dezember 2011 als Botschafterin nach Paris. Im Dezember 2015 beschloss der österreichische Ministerrat ihren Wechsel als Botschafterin nach Bern.
Ursula Plassnik ist eine österreichische Diplomatin und Politikerin der ÖVP. Ab 2004 war sie als Nachfolgerin von Benita Ferrero-Waldner österreichische Außenministerin. Bis Dezember 2008 gehörte sie in dieser Funktion den Bundesregierungen Schüssel II und Gusenbauer an. Sie nahm seitdem ihr Abgeordnetenmandat im Nationalrat wahr. Am 6. Juli 2011 hielt sie ihre Abschiedsrede im Parlament und wechselte per Dezember 2011 als Botschafterin nach Paris. Im Dezember 2015 beschloss der österreichische Ministerrat ihren Wechsel als Botschafterin nach Bern.
DIE FURCHE: Ist die Schweiz neben dem geografischen auch das mentalitätsmäßige Scharnier zwischen dem französisch- und dem deutschsprachigen Europa?
Bürgi Dellsperger: Auf kleinem Raum haben wir tatsächlich mit den vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch auch entsprechend unterschiedliche kulturbedingte Mentalitäten.
Plassnik: „Scharnier“ drückt es für mich ganz gut aus, es geht um eine mechanische Brücke, nicht eine chemische Vermischung. Diese Differenz hat ja auch einen unglaublichen Reiz. Anfangs habe ich geglaubt, dass der Schweizer eine Mischung dieser beiden europäischen Großmentalitäten ist. Mein heutiger Vermutungsstand hingegen ist, dass doch jeder Schweizer mehrheitlich dem lateinischen oder dem germanischen Europa angehört. Mit der Sprachkompetenz hat das nichts oder nur wenig zu tun. Dazu kommt in Europa dann die byzantinisch-slawische Dimension, die wiederum den Österreichern eher geläufig ist als den Schweizern.
DIE FURCHE: „Röstigraben“ werden die Sprachgrenze sowie die damit einhergehenden kulturellen wie politischen Unterschiede zwischen dem deutsch- und dem französischsprachigen Teil der Schweiz genannt – wie tief ist dieser Graben?
Bürgi Dellsperger: Der hat sich mittlerweile nivelliert. Bei Abstimmungen in den 1970er, 1980er Jahren war er noch deutlich zu spüren. Die französischsprechende Bevölkerung war immer ein wenig fortschrittlicher. Vor allem sind sie auch europafreundlicher. In der deutschsprachigen Schweiz gibt es viele kleinere Kantone, die bei Initiativen dank des Abstimmungssystems ein Übergewicht gehabt haben, was für die anderen etwas schwierig zu akzeptieren war. Aber in letzter Zeit ist dieser Graben nicht mehr so ausgeprägt.
Plassnik: Ich gestehe, dass mich die französische Sprache und Kultur schon seit der Schule bezaubert hat, ich kann also da nicht objektiv sein. Und ich kenne die italienische Schweiz leider zu wenig. Während meiner Ehe mit einem Westschweizer war ich überzeugt davon, dass sich die tiefen Unterschiede versöhnen lassen, wenn man nur intensiv genug an ihrer Überwindung arbeitet. Später habe ich zu meiner Verblüffung wahrgenommen, dass auf beiden Seiten mit komplizenhafter, stillschweigender Inbrunst am Röstigraben festgehalten wird. Es geht also nicht um Aussöhnung von Gegensätzen, sondern um Respekt vor Andersartigkeit. Der tägliche lebendige Ausgleich zwischen den so unterschiedlichen „Schweizen“ hält das System auf Trab und „forever young“. Vielleicht liegt das Geheimnis der Schweizer im beharrlichen Aushalten ihrer Unterschiedlichkeiten. Einander gewogen bleiben, obwohl man einander wenig versteht, einander wohlwollend aushalten. Immer neu aufeinander zugehen. Im Wissen, dass alle Alternativen schlechter wären. Das hat aber jahrhundertelange Kämpfe, Rivalitäten und sogar kriegerische Auseinandersetzungen gebraucht.
DIE FURCHE: „Glückliche Ereignisse haben mich an die Spitze der französischen Regierung berufen, und doch würde ich mich für unfähig halten, die Schweizer zu regieren.“ Trifft der ansonsten wenig an sich zweifelnde Napoleon mit dieser 1802 ausgesprochenen Selbstbeschränkung einen richtigen Punkt?
Plassnik: Der Mann musste es wissen, er war ja ein geradezu fanatischer Ordnungsschaffer, auch vor den aus seiner Sicht zu wenig zentralistisch organisierten Eidgenossen hat er nicht haltgemacht. Aber Spaß beiseite: Ja, hohe Vielfalt verlangt – natürlich unter demokratischen Bedingungen – komplexe Organisationsformen. Und einen nie versiegenden Willen zur Kompromissfindung. Mit ein Grund, warum das politische Gesamtkunstwerk Schweiz so wenig leicht durchschaubar ist. Und schon gar nicht kopierfähig.
Bürgi Dellsperger: Für uns ist dieses System das optimale. Es ist nach und nach gewachsen, man hat sich durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder zusammengerauft. Es ist ein typisch schweizerischer Kompromiss.
Für uns ist dieses System das optimale. Es ist nach und nach gewachsen, man hat sich durch die Jahrhunderte hindurch zusammengerauft. Ein Kompromiss.
DIE FURCHE: Gilt das auch für die Schweizer Regierungsstruktur mit einem Kollektiv als Spitze?
Bürgi Dellsperger: Das ist schon sehr speziell und im Ausland oft erklärungsbedürftig. Für mich zeigt das vor allem: Wir wollen nicht eine Person mit der ganzen Macht. Wir hatten nie einen König. Wir wollten keinen Vogt. Wir hatten zwar einen Kaiser de facto bis 1499, aber der war weit weg. Das spiegelt sich in der jetzigen Regierung wider: Die besteht auf allen Ebenen aus fünf, sieben oder neun gewählten Mitgliedern, die zusammen Lösungen finden müssen, welche den größten Teil der Bevölkerung abdecken. Für mich ist das eine sehr pragmatische und ausgewogene Lösung, und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich die Schweiz diesbezüglich ändern wird.
Plassnik: Neben den hehren Motiven gehört zum Schweizer Politsystem auch eine gehörige Portion Wettbewerbslust und Eifersucht, etwa zwischen den Kantonen, darüber spricht man nur weniger gern. Herausragende Persönlichkeiten sind eher nicht erwünscht, Personenkult geht gar nicht. Risikominimierung ist Pflicht. Das legt kollektive Führung nahe, ob in der Bundesregierung oder über die kantonalen Direktorenkonferenzen. Es ist heutzutage in Politik und Wirtschaft eine Binsenweisheit, dass kollektive Entscheidungsfindung bessere Resultate bringt als solitäre Einzelentscheider. Wieweit das allerdings im Krisenmanagement Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Manchmal braucht die Vielfalt ein starkes Dach, das rasch entscheidet. Das hat man etwa bei der Terrorbekämpfung oder im Pandemiemanagement gesehen.

Christina Bürgi Dellsperger
Christina Bürgi Dellsperger ist Schweizer Botschaftsrätin in Wien.
Christina Bürgi Dellsperger ist Schweizer Botschaftsrätin in Wien.
DIE FURCHE: Das politische Aushängeschild der Schweiz ist die direkte Demokratie – gibt es dabei nur Licht, oder sehen Sie auch Schatten?
Bürgi Dellsperger: Wir Bürgerinnen und Bürger können mitentscheiden, das ist grundsätzlich gut, aber Entscheide brauchen länger, sind aber Mehrheitsentscheide. Eine sehr bedauerliche Entscheidung an der Urne war sicher, dass man(n) 1959 das Frauenstimmrecht abgelehnt hat. Erst 1971 wurde es relativ deutlich angenommen. Das zeigt die Problematik direkter Demokratie, wenn es um derartige Grundund Menschenrechte geht. Neben den Bundesabstimmungen gibt es auch noch die Abstimmungen auf Kantons- und Gemeindeebene. Vielen ist das zu viel, deswegen sind 50 Prozent Beteiligung bei Abstimmungen schon hoch. Das heißt aber auch: Letztlich entscheiden 26 Prozent der Bevölkerung mit einem Schweizer Pass.
Plassnik: Die Schweizer Ausprägung der direkten Demokratie hat viele sehr spezielle Facetten. Ein richtiges Uhrwerk ineinandergreifender Rädchen, dem aber auch ein ganz eigenes Verständnis von Gewaltentrennung zugrunde liegt. So kann beispielsweise jedes von Regierung und Parlament beschlossene Gesetz mit binnen 100 Tagen gesammelten 50.000 Stimmen in einem Referendum zu Fall gebracht werden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und wer binnen 18 Monaten 100.000 Stimmen sammelt, kann per Referendum unmittelbar die Verfassung ändern. Es gibt keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Wäre all das mit unserem Begriff von Rechtssicherheit zu vereinbaren? Am besten gefällt mir der permanente Druck auf die Politiker, persönlich hinzustehen und Mehrheiten zu schaffen, um ihre Projekte durch das Referendum zu bringen. Daran misst sich der Erfolg eines Politikers. Überzeugungsarbeit nah am Bürger.
DIE FURCHE: Ist die Schweiz mit ihrer Vielfalt in Einheit eine Art EU außerhalb der EU?
Plassnik: Ja. Das überrascht vielleicht viele Schweizer. Aber in beiden Fällen ist die Zielsetzung ident: Zusammenhalt dauerhaft über die Zeit organisieren, trotz aller Unterschiedlichkeiten, unter größtmöglicher Wahrung der Eigenheiten. Erfolgreiche Selbstbehauptung. Reichsein hilft natürlich, es geht immer auch um die als fair empfundene Verteilung finanzieller Mittel.
Man muss ‚zusammenspannen‘, auch mit Leuten, deren Mentalität einem nicht ganz geheuer ist. Keine Selbstverständlichkeit. Die Schweizer fremdeln untereinander ordentlich.
DIE FURCHE: Was könnte die EU von der Schweiz und was die Schweiz von der EU lernen?
Bürgi Dellsperger: Unsere bilateralen Verträge sind von beiderseitigem Interesse und miteinander ausgehandelt worden. Wir können der EU nichts aufoktroyieren. Deshalb entspricht der manchmal geäußerte Vorwurf der Rosinenpickerei nicht den Tatsachen. Die Verträge zwischen EU und Schweiz sind ausgeglichen. Zudem leisten wir unseren Beitrag zum gemeinsamen Europa. Beispiel die freiwillige Kohäsionsmilliarde an die EU-Erweiterungsländer oder unsere Unterstützung für die von der Migration stark betroffenen EU-Länder.
Plassnik: Im Grunde stehen Europa und die Schweiz in der Welt vor ein und denselben Herausforderungen. Wie bewahren wir unsere Selbstständigkeit? Wie befreien wir uns aus Abhängigkeiten? Wie tragen wir bei zu Frieden in einer zunehmend gewaltgeprägten Welt? Können wir Freiheit und Wohlstand wahren für unsere Bürger? Wie gehen wir um mit Partnern, die die Regeln nicht respektieren? Die Schweiz und die EU verschwenden zu viel politische Energie mit der Regelung ihres bilateralen Verhältnisses. Inzwischen bricht der Krieg aus, das Klima entgleist, und die Riesen schlucken uns. Daher sollten wir schleunigst aufräumen in unserer Beziehungskiste.
DIE FURCHE: Als sich der Bundesrat den Sanktionen der EU gegen Russland anschloss, schrieb die „Washington Post“ vom „scharfen Bruch“ der Schweiz mit ihrer Neutralität. Was meinen Sie, läutet Putins Krieg auch eine sicherheitspolitische Zeitenwende in der Schweiz ein?
Plassnik: Die Schweiz ist Russland gegenüber historisch vergleichsweise kritischer, die Schweizer Neutralität deutlich wehrhafter. Putins Angriffskrieg hat aber auch bei den pragmatischen Schweizern neue Türen aufgemacht für sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Da sollte sich Österreich aktiv einbringen. Etwa bei gemeinsamer Luftraumüberwachung. Oder bei der Zusammenarbeit mit der NATO bei Training und Ausbildung. Mit dem NATO-Beitritt der Schweden und der Finnen ist für uns beide das Feld unserer engen Partner sehr geschrumpft. Österreich und die Schweiz sollten jetzt gemeinsam Nägel mit Köpfen machen. Bürgi Dellsperger: Die Schweiz hat so wie Österreich einen gewissen Spielraum in der Neutralitätspolitik. In unserer Völkerrechtsabteilung wurde das Thema Sanktionen intensiv analysiert. Mit dem Ergebnis, dass wir die EU-Sanktionen mittragen. Ein Zeichen, wie nahe wir der EU sind. Wir sind wahrscheinlich näher, als die EU das glaubt. Die Schweiz ist ja auch Mitglied im Europarat und auch dadurch an europäische Werte gebunden.
DIE FURCHE: Ich habe das Gespräch mit dem „Sonderfall Schweiz“ begonnen. Gibt es etwas besonders Schweizerisches, was Sie anderswo vermissen?
Bürgi Dellsperger: Was mir fehlt, ist die Rigi, der Zugersee, Schokolade von Felchlin und die Zuger Kirschtorte.
Plassnik: Ein Wort der Erklärung zum Thema „Sonderfall“. Jedes Gemeinwesen, jeder Staat ist aus einzigartigen historischen Konstellationen entstanden, hat oft konfliktreiche Vergangenheiten, wir sind also alle „Sonderfälle“. Aber niemand steht über dem anderen, niemand darf für sich eine Art „Sonderfallbonus“ beanspruchen. Keiner ist der Sonderfall der Sonderfälle. Das sagt schon der Hausverstand, es sollte eigentlich kein Aufreger sein. Und trotzdem hören das manche Schweizer, vor allem in der rechten Ecke, gar nicht gern. Manche sehen das gar als Majestätsbeleidigung. Das ist natürlich Unsinn, vielleicht auch Unsicherheit. Und ja, ich vermisse vieles, das sommerliche Schwimmen in der Aare, das Erfrischungsgetränk „Rivella“, den erstklassigen Cappuccino überall, den Blick über den Genfersee im Herbst. Am meisten aber meine Schweizer Freunde. Sie haben ein besonderes Talent zur Treue in der Freundschaft.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!