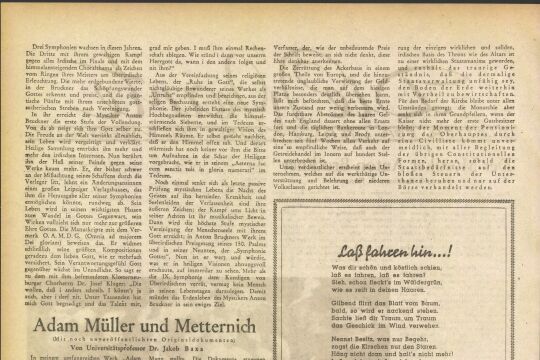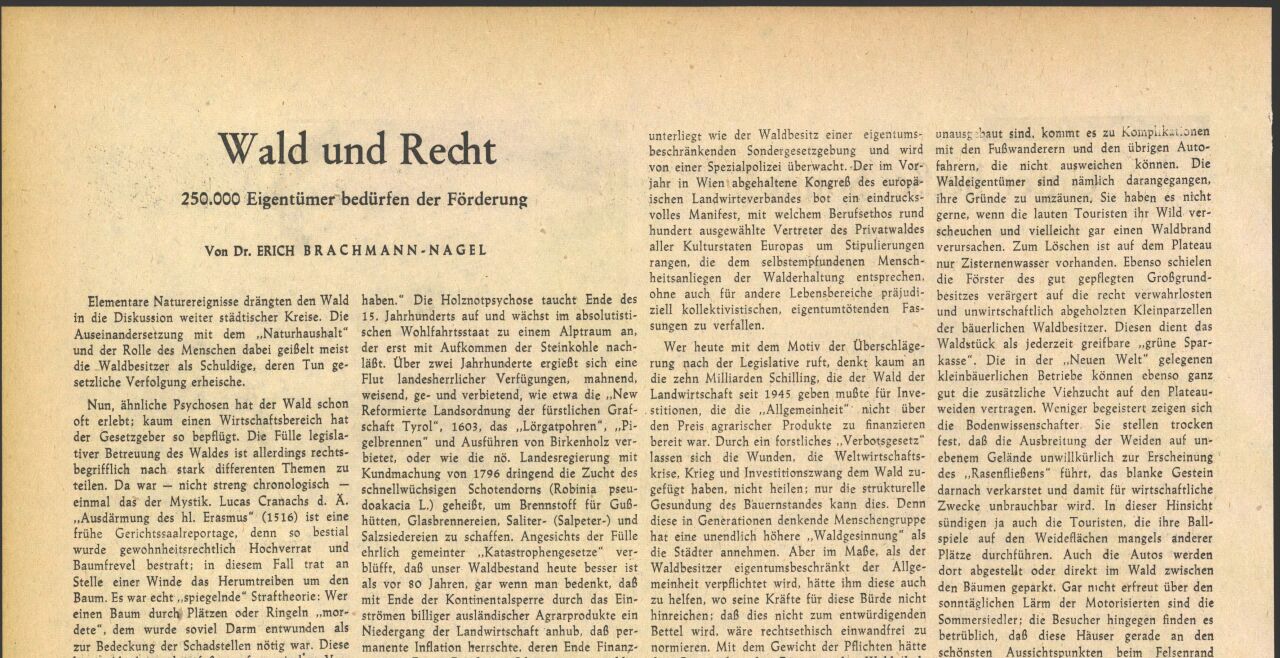
Über die Geschichte der Rechtsgebung des Waldes.
Elementare Naturereignisse drängten den Wald in die Diskussion weiter städtischer Kreise. Die Auseinandersetzung mit dem „Naturhaushalt“ und der Rolle des Menschen dabei geißelt meist die Waldbesitzer als Schuldige, deren Tun gesetzliche Verfolgung erheische.
Nun, ähnliche Psychosen hat der Wald schon oft erlebt; kaum einen Wirtschaftsbereich hat der Gesetzgeber so bepflügt. Die Fülle legislativer Betreuung des Waldes ist allerdings rechtsbegrifflich nach stark differenten Themen zu teilen. Da war — nicht streng chronologisch — einmal das der Mystik. Lucas Cranachs d. Ä. „Ausdärmung des hl. Erasmus“ (1516) ist eine frühe Gerichtssaalreportage, denn so bestial wurde gewohnheitsrechtlich Hochverrat und Baumfrevel bestraft; in diesem Fall trat an Stelle einer Winde das Herumtreiben um den Baum. Es war echt „spiegelnde“ Straftheorie: Wer einen Baum durch Plätzen oder Ringeln „mordete“, dem wurde soviel Darm entwunden als zur Bedeckung der Schadstellen nötig war. Diese harte Ahndung aber fußte auf mystisctier Verehrung, wie sie etwa Tacitus deutet: „Alt und vom Beile verschont seit Jahren stehet ein Wald da, glaublich ist es, der Ort werde von Göttern bewohnt“ oder Ovid berichtet: „Nach dem Aberglauben der lausitzischen Wenden gibt es Wälder, die jährlich ein Menschenopfer fordern.“ Ganz anderen Rechtsinhaltes waren die eigentumschützenden Bestimmungen eines Jahrtausends. Nach frühester deutschrechtlicher Auffassung hatte jeder Freie Anteil an der Gemeinnutzung der Wälder.
So wurden bei der Anweisung der Lusse ursprünglich die Wälder nicht mitverteilt. Nur Burgunder, Langobarden und Westgoten kannten Waldeigentum; vielleicht fanden sie in ihren Besatzungsgebieten dieses Verhältnis schon vor. Theoderich II. erlaubte aber den Siedlern, selbst aus Privatwald ihren Bedarf zu decken. Burgundisches, salfränkisches, bajuvarisches, ripuarisches und gemin-salisches Recht regelten etwa später ziemlich ähnlich Schadenerstaz und Strafe für die wichtigsten lässigen oder bewußten EigentumsdeIikte wie Holzdiebstahl oder Brand beim „Absang“. Neben der meist der Jagd dienenden Bannlegung vieler Wälder, gegen die Ludwig der Fromme, 819, einschritt, brachte das mittlere Mittelalter gesetzlich kaum Neues, außer der auf Karl des Großen „Wirtschaftsordnung für die Kronländereien“ fußenden Erhebung der „foresta“ über bloße „sil-vae“.
Auch im hohen Mittelalter ist das Eigentum Rechtsgegenstand. Der bildhaften Auffassung, „die Axt ist ein Melder, die Säge ein Dieb“ folgend, steht in Sachsen- und Schwabenspiegel auf Holzdiebstahl bei Tag Strafe „auf Haut und Haar“, bei Nacht aber die „Wyde“ (der Strang). Noch dem Eigentumsschutz dienten dann zahlreiche Taidinge, Weitümer und Rügbücher der anbrechenden Neuzeit — meist nur Niederschrift lang geübten Gewohnheitsrechtes. Daß man nicht zimperlich war, zeigt z. B. das Pantaiding von Hüning (1513): „wölcher einen felber abhaut, ist das recht, und von alters her erkent, dass er der mereren obrigkeit zu straff verfallen ist, ain Hand oder löss dieselb mit 5 Pfung Pfennig.“
Völlig anderes Rechtsgut bildet der Walderhaltungsgedanke, der erstmals mit den „silvae defensatae“ (Schutzforsten) im frühen Mittelalter aufkommt. Im Maß als Köhlerei, Erz-hüttung, Salzsud, und nach Erfindung des Tafelglases Glashütten und Pottaschebrennereien den Wäldern zusetzten, widmete sich der Gesetzgeber der. „Hayung“ (Pflege). Das Verbot des Erzbistums Salzburg der Waldweide auf Schlagflächen (1237) zur Sicherung der Naturverjüngung des für die Salzpfannen nötigen Waldes ist ein Grenzfall zwischen Eigentumsschutz und Pflegegebot. Albrecht I. dringt 1304 auf Wiederaufförstung, Erfurt erläßt 1350 einen Betriebsplan für die Stadtwälder und beim Großwald greift nun die Bestellung höherer Forstbeamter (ma-gistri foresti) um sich. Die Waldordnung der Herrschaft Garsten spricht 1578 erstmals aus: „damit die nachkommen auch was finden und haben.“ Die Holznotpsychose taucht Ende des 15. Jahrhunderts auf und wächst im absolutistischen Wohlfahrtsstaat zu einem Alptraum an, der erst mit Aufkommen der Steinkohle nachläßt.
Über zwei Jahrhunderte ergießt sich eine Flut landesherrlicher Verfügungen, mahnend, weisend, ge- und verbietend, wie etwa die „New Reformierte Landsordnung der fürstlichen Grafschaft Tyrol“, 1603, das „Lörgatpohren“, „Pi-gelbrennen“ und Ausführen von Birkenholz verbietet, oder wie die nö. Landesregierung mit Kundmachung von 1796 dringend die Zucht des schnellwüchsigen Schotendorns (Robinia pseu-doakacia L.) geheißt, um Brennstoff für Gußhütten, Glasbrennereien, Saliter- (Salpeter-) und Salzsiedereien zu schaffen.
Angesichts der Fülle ehrlich gemeinter „Katastrophengesetze“ verblüfft, daß unser Waldbestand heute besser ist als vor 80 Jahren, gar wenn man bedenkt, daß mit Ende der Kontinentalsperre durch das Einströmen billiger ausländischer Agrarprodukte ein Niedergang der Landwirtschaft anhub, daß permanente Inflation herrschte, deren Ende Finanzminister Baron Bruck erst Silvester 18 58 melden konnte, daß Manchester-Liberalismus und technische Revolution den Bauern schädigten, wie sie der Industrie nützten, und daß der Grundentlastung eine ungeheure Verschuldung und schwerste Krisis folgte: Bis 1892 wurden rund 180.000 Bauerngüter zwangsversteigert!
Daß seither der Wald erhalten, ja verbessert wurde, war nicht Gesetzeswerk, sondern Wille und Tat der Waldbesitzer, die längst Eigentumsansprüche dem Pflichtgefühl der Walderhaltung unterordneten. Das Rechtsprinzip des Eigentums, „die Befugnis, mit der Substanz einer Sache nach Willkür zu schalten“ ( 3 54 ABGB), gilt für die Forstwirtschaft nicht. Kein Wirtschaftsbereich unterliegt wie der Waldbesitz einer eigentumsbeschränkenden Sondergesetzgebung und wird von einer Spezialpolizei überwacht. Der im Vorjahr in Wien abgehaltene Kongreß des europäischen Landwirteverbandes bot ein eindrucksvolles Manifest, mit welchem Berufsethos rund hundert ausgewählte Vertreter des Privatwaldes aller Kulturstaten Europas um Stipulierungen rangen, die dem selbstempfundenen Menschheitsanliegen der Walderhaltung entsprechen, ohne auch für andere Lebensbereiche präjudiziell kollektivistischen, eigentumtötenden Fassungen zu verfallen.
Wer heute mit dem Motiv der Überschlägerung nach der Legislative ruft, denkt kaum an die zehn Milliarden Schilling, die der Wald der Landwirtschaft seit 1945 geben mußte für Investitionen, die die „Allgemeinheit“' nicht über den Preis agrarischer Produkte zu finanzieren bereit war. Durch ein forstliches „Verbotsgesetz“ lassen sich die Wunden, die Weltwirtschaftskrise, Krieg und Investitionszwang dem Wald zugefügt haben, nicht heilen; nur die strukturelle Gesundung des Bauernstandes kann dies. Denn diese in Generationen denkende Menschengruppe hat eine unendlich höhere „Waldgesinnung“ als die Städter annehmen. Aber im Maße, als der Waldbesitzer eigentumsbeschränkt der Allgemeinheit verpflichtet wird, hätte ihm diese auch zu helfen, wo seine Kräfte für diese Bürde nicht hinreichen; daß dies nicht zum entwürdigenden Bettel wird, wäre rechtsethisch einwandfrei zu normieren.
Mit dem Gewicht der Pflichten hätte der Gesetzgeber das Rüstzeug der Walderhaltung, also durch den Waldbesitz nach objektiven Kriterien ansprechbare Rechte verschiedenster wirtschaftspolitischer Art einzudämmen und zu kodifizieren. Das wäre echtes Forst recht, dem angemessen, daß Österreichs Wald von 245.000 immerhin formellen Eigentümern bewirtschaftet wird, die wohl weniger des Knüppels als der Förderung bedürfen. Denn „dank der natürlichen Hinfälligkeit des Menschengeschlechtes wirken die Heilmittel langsamer als die Übel, und wie der Leib unmerklich wächst, aber schnell zugrundegeht, so ist es auch leichter, Talent und Wettstreit zu ersticken als sie wieder zum Leben zu erwecken“ (Tacitus, Agricolae vita).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!