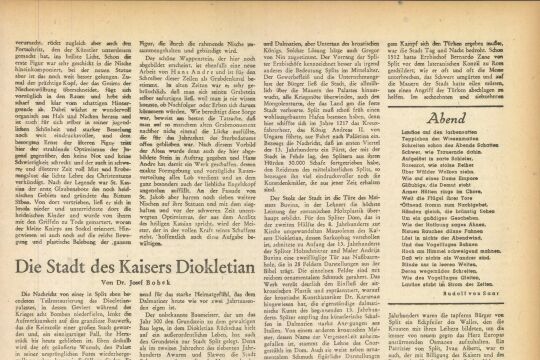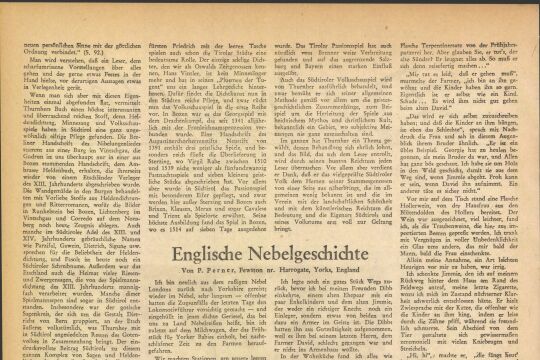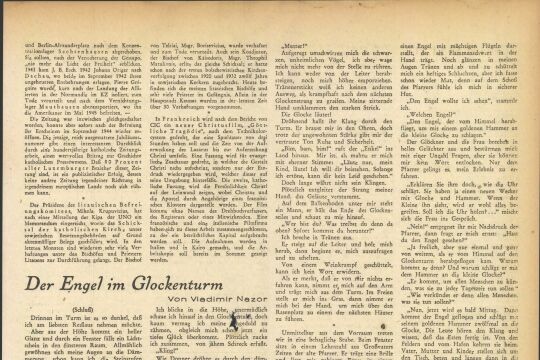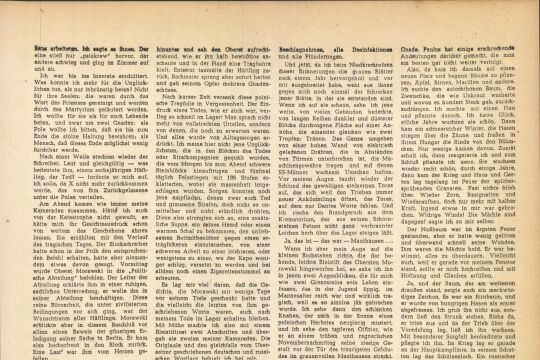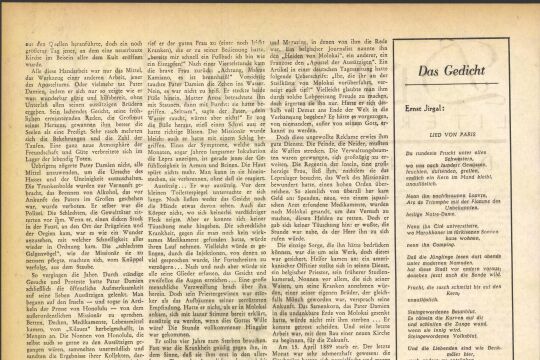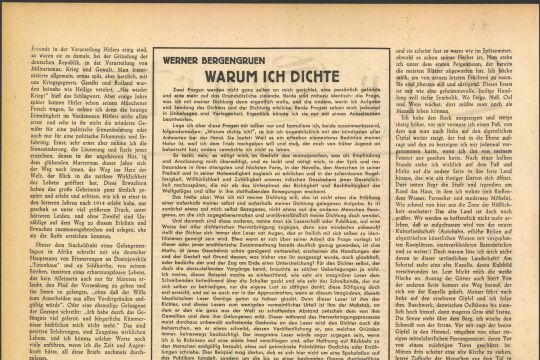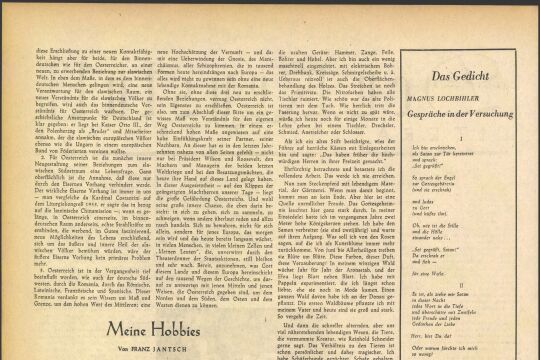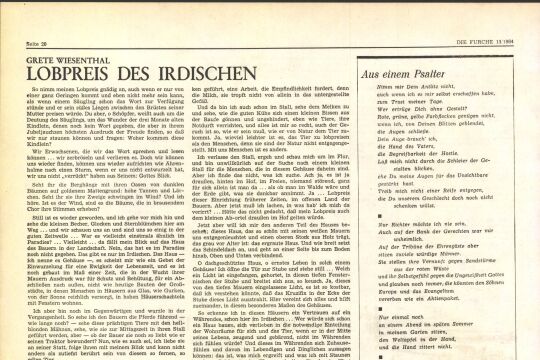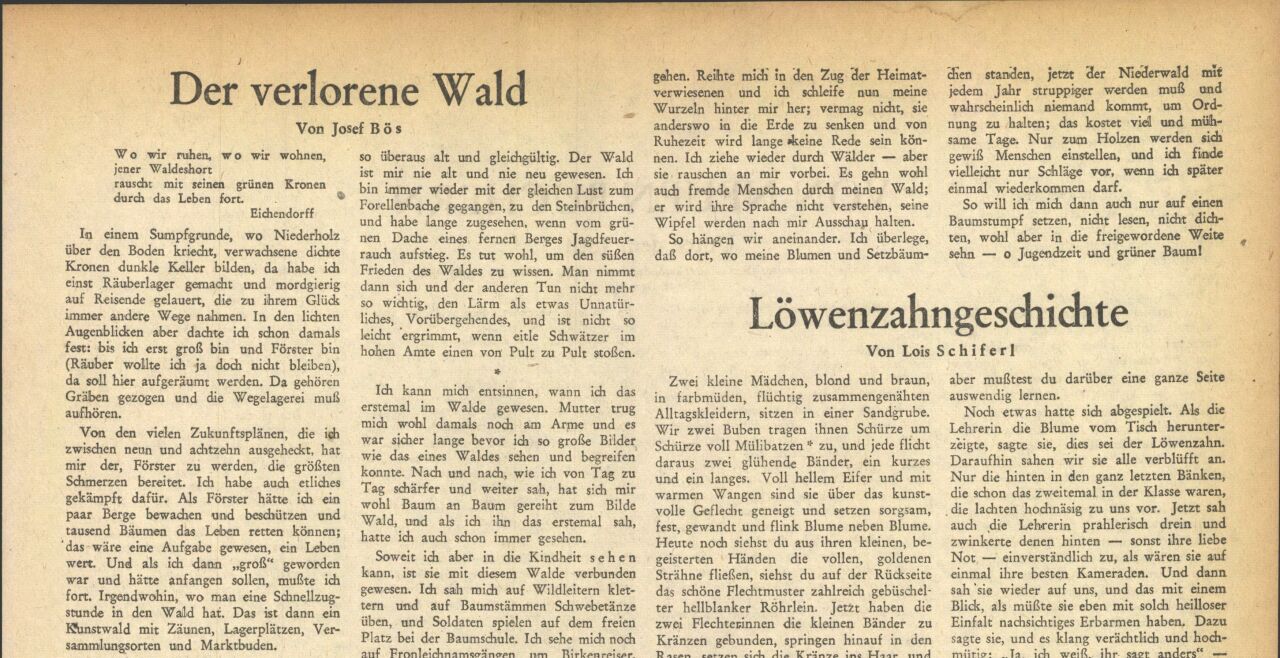
Eine Erzählung über Nähe und Distanz zum Wald.
"Wo wir ruhen, wo wir wohnen, jener Waldeshort rauscht mit seinen grünen Kronen durch das Leben fort." (Eichendorff)
In einem Sumpfgrunde, wo Niederholz über den Boden kriecht, verwachsene dichte Kronen dunkle Keller bilden, da habe ich einst Räuberlager gemacht und mordgierig auf Reisende gelauert, die zu ihrem Glück immer andere Wege nahmen. In den lichten Augenblicken aber dachte ich schon damals fest: bis ich erst groß bin und Förster bin (Räuber wollte ich ja doch nicht bleiben), da soll hier aufgeräumt werden. Da gehören Gräben gezogen und die Wegelagerei muß aufhören.
Von den vielen Zukunftsplänen, die ich zwischen neun und achtzehn ausgeheckt, hat mir der, Förster zu werden, die größten Schmerzen bereitet. Ich habe auch etliches gekämpft dafür. Als Förster hätte ich ein paar Berge bewachen und beschützen und tausend Bäumen das Leben retten können; das wäre eine Aufgabe gewesen, ein Leben wert. Und als ich dann „groß” geworden war und hätte anfangen sollen, mußte ich fort. Irgendwohin, wo man eine Schnellzugstunde in den Wald hat. Das ist dann ein Kunstwald mit Zäunen, Lagerplätzen, Versammlungsorten und Marktbuden.
In meinem Walde kann man stundenlang gehen, ohne jemanden zu treffen, da grasen noch Rehe wie in Eichendorffs Gedichten, da kann man sich noch verirren und fünf Stunden brauchen, bevor man einen Weg findet, der heimführt, und, wenn es darüber Abend wird, im Walde übernachten müssen.
Ja, Freunde, das ist ein Wald! Da sind Gründe und Gräben, wo der Schnee bis in den Mai liegt, sind Baumhallen, in denen man so still und klein wird, wie im Dom. Das ist ein Wald, durch den noch der liebe Gott geht; und er hat hier keine Eile, der liebe Gott, er ist stundenlang mit mir gegangen, hat mich ruhig und stadtgelbe Weltanschauungen wieder grün gemacht; hat mich auf Berge geführt, wo — mitten im Walde — nur die Kraft der Augen, die Welt aber keine Grenze mehr hat, wo grüne Seen wogen und seine, Gottes Klarheit ist. Dort sind mir alle Widersprüche verflogen, dort konnte ich wieder Verse und Lieder summen und ohne Störung an Vater und Mutter und liebste Frau denken. Gewiß: an solchen Tagen könnte man auch nichts Böses tun.
In meinem Walde sind Fichten und Tannen und einige Buchen und Birken zwischendrin. Der Boden ist hügelig, weich, feucht und duftet nach Moos und Harz. Hie und da sind Gräben, dort blüht weißer Klee und Vergißmeinnicht. In den Lichtungen sind Heidelbeeren, in den Schlägen Gestrüpp, man ritzt sich blutig an nadeligen Brombeerästen und sieht kaum über die hohen Himbeerstämmchen hinweg. Am Bach sind Vogelbeersträucher, dazwischen Ruten wilder Ebereschen und zwanzig oder mehr Blumen; hohe rote, gelbe, blaue.
Das Gestrüpp wind gerodet, Bäume werden gepflanzt, wieder wachsen Blumen und Kräuter mit, wachsen schneller als die Fichten. Aber Bäume sind fester als Blumen und leben länger. Sie siegen über schöne, begabte Streber ringsum.
Im Waldlande werden andere Menschen als in der Stadt. Die Stadt hindert das Kind am Träumen, der Wald begünstigt es. Und Träumer, Gottsucher wird man nicht nach zwanzig aus Überlegung oder durch schöne Literatur. Auch Denkart und Sprachtiefe bildet die Umwelt der ersten Jahre nach ihrer Art. Grün ist mir eine andere Farbengruppe als dem Städter, reicht vom Wiesenklee im Juni bis zum tiefen Grün des „Schwarzen” Berges, den ich vom Hause meines Vaters aus jeden Morgen sah. Wenn mir einer „Grün” sagt, so steht Feld und Wald dahinter; der Städter sieht Farbtafeln, Auslagen und Frauenkleider. Und jeder muß in seiner Richtung weiter denken, ich bin auf einmal vom Grün auf einen Berg daheim gekommen, der andere in sein Kaffeehaus.
Als ich das erstemal in die Stadt kam, dachte ich, mein ganzes Wesen werde sich ändern. Den lüsternen Augen tat das Neue wohl. Bald merkte ich, daß alles Künstliche, alle Park- und Baukünste nicht auf die Dauer erquicken können. Alles schien am ersten Tage so überaus neu und war bald so überaus alt und gleichgültig. Der Wald ist mir nie alt und nie neu gewesen. Ich bin immer wieder mit der gleichen Lust zum Forellenbache gegangen, zu den Steinbrüchen, und habe lange zugesehen, wenn vom grünen Dache eines fernen Berges Jagdfeuerrauch aufstieg. Es tut wohl, um den süßen Frieden des Waldes zu wissen. Man nimmt dann sich und der anderen Tun nicht mehr so wichtig, den Lärm als etwas Unnatürliches, Vorübergehendes, und ist nicht so leicht ergrimmt, wenn eitle Schwätzer im hohen Amte einen von Pult zu Pult stoßen.
Ich kann mich entsinnen, wann ich das erstemal im Walde gewesen. Mutter trug mich wohl damals noch am Arme und es war sicher lange bevor ich so große Bilder wie das eines Waldes sehen und begreifen konnte. Nach und nach, wie ich von Tag zu Tag schärfer und weiter sah, hat sich mir wohl Baum an Baum gereiht zum Bilde Wald, und als ich ihn das erstemal sah, hatte ich auch schon immer gesehen.
Soweit ich aber in die Kindheit sehen kann, ist sie mit diesem Walde verbunden gewesen. Ich sah mich auf Wildleitern klettern und auf Baumstämmen Schwebetänze üben, und Soldaten spielen auf dem freien Platz bei der Baumschule. Ich sehe mich noch auf Fronleichnamsgängen um Birkenreiser, auf verbotener, heiliger Dezembersuche; sehe mich die Breiten des Wildbaches zu Badetümpeln erweitern,, in deren Eiswasser sich dann mein Jugendfreund den Tod holt. Das ist schon lange her und ich kann mich kaum mehr erinnern, wie er eigentlich ausgesehen hat.
Ich bin in den letzten Jahren schon viel zu städterhaft in den Wald gegangen; es hängt doch an, wie sehr man sich auch dagegen wehren mag. Ich habe auch immer lange gebraucht, bevor ich wieder daheim war, und wenn es so weit war, mußte ich wieder fort. Aber einmal wollte ich ja daheim bleiben. Ich bin, ich darf das ja nur vertrauten Menschen sagen, einer, der sich, seit er nicht mehr ganz jung sein kann, nur auf Ruhezeit und Greisenalter freut. Das ist unnatürlich und blöde, aber es ist so. Es kommt vielleicht daher, weil ich mich nicht an die Stadt gewöhnen und sie doch nicht entbehren kann. Aber am ersten möglichen Tage wollte ich heimgehen. Mir eine Bank aus Birkenästen vor das Haus machen. Dann wollte ich wieder oft in meinem Walde sein und im Sommer ganze Tage. Mit Büchern allerdings, ohne die geht es doch nicht mehr; ich hatte schon einige vorbereitet, die dann endlich zu Ende zu lesen wären, und dann dachte ich, wenn der Jagdfeuerrauch einmal wieder ganz hoch stiege, würde ich vielleicht auch ein Gedicht schreiben. Das lag mir noch mehr am Herzen als der Förstertraum.
Aber während ich so von Traum zu Träumen plante, griff das Leben zu und ließ mir Wald und Dorf und Haus verlorengahen. Reihte mich in den Zug der Heimatverwiesenen und ich schleife nun meine Wurzeln hinter mir her; vermag nicht, sie anderswo in die Erde zu senken und von Ruhezeit wird lange keine Rede sein können. Ich ziehe wieder durch Wälder — aber sie rauschen an mir vorbei. Es gehn wohl auch fremde Menschen durch meinen Wald; er wird ihre Sprache nicht verstehen, seine Wipfel werden nach mir Ausschau halten.
So hängen wir aneinander. Ich überlege, daß dort, wo meine Blumen und Setzbäumdien standen, jetzt der Niederwald mit jedem Jahr struppiger werden muß und wahrscheinlich niemand kommt, um Ordnung zu halten; das kostet viel und mühsame Tage. Nur zum Holzen werden sich gewiß Menschen einstellen, und ich finde vielleicht nur Schläge vor, wenn ich später einmal wiederkommen darf.
So will ich mich dann auch nur auf einen Baumstumpf setzen, nicht lesen, nicht dichten, wohl aber in die freigewordene Weite sehn — o Jugendzeit und grüner Baum!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!