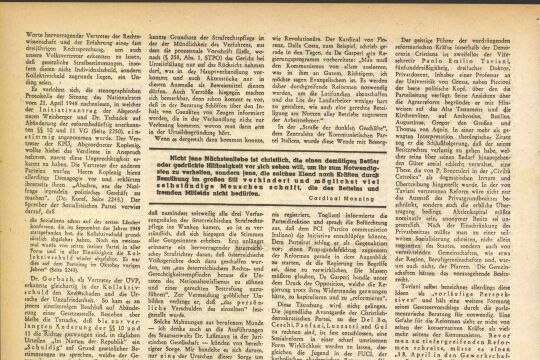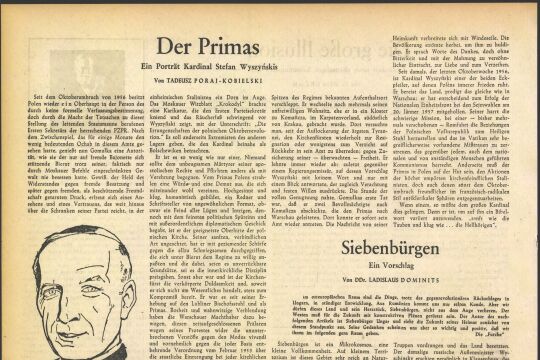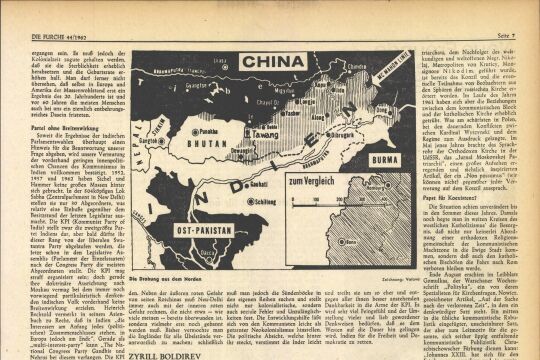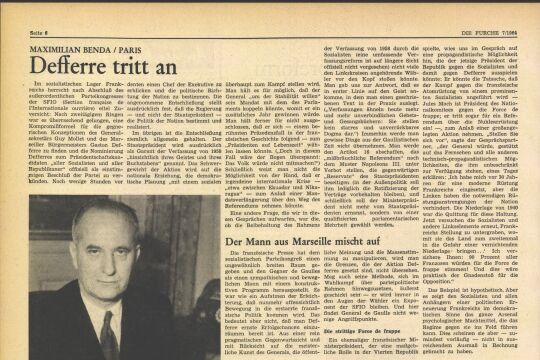Der nächstfällige Stichtag für die Politik der linken Mitte und das Schicksal der Regierung Fanfani ist der 8. Jänner: die Chefs der vier Koalitionsparteien — Aldo Moro für die Christlichen Demokraten Giuseppe Sa-ragat für die Sozialdemokraten, Euge-nio Reale für die Republikaner und Pietro Nenni für die Sozialisten — werden zusammentreffen, um festzustellen, ob die „linke Mitte“ noch vorhanden, oder ob sie in den zwölf Monaten auf der Strecke geblieben ist. Konkret besteht das Merkmal des noch vorhandenen Lebens in ihr darin, ob die Christliche Demokratie das Wahlgesetz für die Landtage der zu schaffenden Regionen mit Normalstatut, wie sie es den Sozialisten versprochen hatte, noch in dieser Legislaturperiode durchgebracht hat oder ob sie die Sache auf die lange Bank schieben will. Der Entscheidung der katholischen Regierungspartei entsprechend, wird dann zwei Tage später, am 10. Jänner, das Zentralkomitee der Nenni-Partei ihr Abkommen mit der DC lösen oder bestätigen.
Im kommenden Frühling wählt Italien sein Parlament neu. Die Frage, ob die Christliche Demokratie mit dem bekräftigten Bündnis mit den Sozialisten oder besser ohne es, ob also die Regierung Fanfani noch vor Auflösung des Parlaments gestürzt werden soll, wird in der Democrazia Cristiana selbst lebhaft diskutiert. Das Gesetz für die Regionen, dessen Beratung im Parlament den größten Teil der noch zur Verfügung stehenden Zeit für die legislative Tätigkeit in Anspruch nehmen würde, ist vielleicht nur ein Vorwand für die tiefer greifenden Auseinandersetzungen in der DC. Daß der von Moro und Fanfani beschrittene Weg angesichts der Entwicklungen in der italienischen Innenpolitik der einzig mögliche war, wird nicht einmal von ihren Gegnern in der Partei geleugnet. Die einzige Alternative für die „Linksöffnung“ zu den Nenni-Sozia-listen bestünde nur noch in einer Rechtskoalition mit den Monarchisten und Neofaschisten, aber die Idee nach einer Politik der sozialen Öffnung, den Kurs der Konservation, ja der Reaktion zu nehmen, ist unvorstellbar. Die Alternative wäre die des Bürgerkrieges. Eine christlichdemokratische Finparteienregierung, wie sie in der Vergangenheit erprobt wurde, ist ebenso undenkbar, denn heute würden sich nicht mehr jene labilen Unterstützungen finden, die auch seinerzeit nur ein Vegetieren, aber keine kräftigen Impulse ermöglicht hatten.
Es bleibt also nur — von den Hoffnungen auf Wahlerfolg abgesehen -die Politik der „linken Mitte“, des Zusammengehens mit den Sozialister Pietro Nennis. Es scheint so etwas wi< ein historisches Schicksal zu existieren das auf die Menschen und Lände: wirkt, wie die Nomen ihre Fäden spin nen. Die „Linksöffnung“ lebt unab hängig von dem Willen der Parteien lie sie gewollt haben. Das stimmt für lie Sozialisten ebenso wie für die DC. Die Sozialisten sitzen in der gleichen 3arke, und auszusteigen bringt für Menni keine geringeren Risiken mit sich als für Moro und Fanfani. War-im aber dann überhaupt die Diskussdon darüber, ob Fanfani noch vor den Wahlen den Hut nehmen soll oder licht? Wenn doch auch nach den Wahlen keine andere Politik möglich sein wird als die gegenwärtige?
Von persönlichen Antipathien abgesehen, die einen Teil der christlich-demokratischen Politiker gegen Fanfani einnehmen, herrscht unter den „Dorotheern“ — wie die Nachfahren von De Gasperis Zentrismus genannt werden — eine lebhafte und echte Besorgnis darüber, daß die Wählerschaft die großen Ambitionen und die großen Perspektiven der „Linksöffnung“, die vollständige Loslösung der Sozialisten von den Kommunisten und ihre Gewinnung für die Demokratie, nicht verstehen werde und ein empfindlicher Rückgang an Stimmen erfolgen würde, der die DC allen künftigen Forderungen seitens der Koalitionspartner gegenüber ohne schützenden Panzer läßt. Die Besorgnisse sind berechtigt, wie sich alle Sonntagsredner in den Provinzen überzeugen konnten, denn es ist nicht leicht, das komplexe, in mehreren Phasen erfolgende „Unternehmen Nenni“ einer Wählerschaft zu erklären, der bisher immer die Nenni-Sozialisten als Feinde des Menschengeschlechts 'hingestellt worden waren. Zum erstenmal würde die katholische Partei den Wahlgang ohne die Unterstützung und die gerade in Italien so kostbare moralische Hilfe des Klerus unternehmen müssen, denn wenn es auch wahr ist, daß einige Bischöfe und Pfarrer entschieden für Fanfanis Experiment eintreten, wenn es auch wahr ist, daß der Agnostizismus der römischen Kurie — der Papst will, daß die katholischen Politiker aus eigener Verantwortung handeln — die „Linksöffnung“ überhaupt erst ermöglicht hat, so ist es doch auch wahr, daß der hohe und der niedere Klerus mehrheitlich seine und seiner Herde Interessen eher bei den Rechtsparteien gewahrt sieht.
Das Zaudern der „Dorotheer“ ist verständlich, Moro selbst scheint viel von dem Schwung verloren zu haben, der ihn auf dem Parteikongreß in Neapel vor elf Monaten beseelt hat, Seine Unbestimmtheit ist derart, daf die Opposition, die Liberalen voi allem, versuchen kann, ihn gegen Fanfani auszuspielen, und Fanfani selbst überlegt ernsthaft, ob er nicht durch einen freiwilligen Rücktritt gegen die Lauheit der Parteiführung gegenüber seinem Kampf auftreten soll. Die Anhänger der „linken Mitte“ merken mit Bitterkeit, daß die positiven Resultate der Regierung Fanfani unbeachtet bleiben, während die Propagandathesen der Opposition von großer Wirkung in der Öffentlichkeit sind. Fanfani wird vorgeworfen, seine Politik habe die Preiserhöhungen provoziert, als ob die Preisspirale nicht auch die Wirtschaft anderer Länder charakterisieren würde; er habe mit seinen Zugeständnissen an Lohn- und Gehaltsempfänger die schleichende Inflation bewirkt, als ob nicht auch in den Ländern ohne „Linksöffnung“, in Frankreich und in der Deutschen Bundesrepublik, die Kaufkraft der Währung im Sinken sei. Man hat ihm vorgeworfen, er habe die Börse und den Aktienmarkt mit dei Nationalisierung der Elektrizitätswirtschaft in einen Abgrund gestürzt, als ob nicht auch Wallstreet, Paris, London und Frankfurt schwierige Tage hinter sich hätten. Hingegen bleibt ganz unberücksichtigt, daß das Einkommen der Italiener in einem einzigen Jahr um 5,5 Prozent gestiegen ist die Produktion um mehr als 9 Prozem zugenommen hat, während sich dei produktive Rhythmus in anderen Ländern, in der vielbeneideten Deutscher Bundesrepublik etwa, verlangsamt hat
Die Kirchenfürsten trafen um den 10. November in Rom ein, acht an der Zahl. Insgesamt war Polen auf der ersten Konzilssession durch fünfundzwanzig Bischöfe vertreten. Nur zwei seiner einundzwanzig Diözesen hatten keinen Repräsentanten nach Rom schicken können. Ein einziger Hierarch hatte offenkundig aus politischen Gründen im Lande bleiben müssen, der durch seine häufigen Zusammenstöße mit dem Regime bekannte Bischof von Kielce, Kaczmarek, an dessen Stelle Weihbischof Jaroszewicz erschien.
Die gesamte Berichterstattung aus Rom war auf freundlich-interessiert abgestimmt. Demgemäß waren die langen Depeschen des Sonderkorrespondenten der besten und von der gesamten geistigen Elite Polens gelesenen Tageszeitung „Zycie Warszawy“ von musterhafter Sachlichkeit, mit regelmäßigem Lob für den Papst, die „fortschrittliche“ Mehrheit des Konzils, dessen zeitgemäße, friedliche Tendenzen. Nur der „Reaktion“ und dem, um den neudeutschen Modeausdruck anzuwenden, als Buhmann auserkorenen Kardinal Ottaviani galten Kritik und Zorn, die jedoch in Grenzen anständiger Polemik gehalten waren. Graf Ignacy Krasicki — der nach seinem berühmten Ahnen, dem einstigen polnischen Primas und gefeierten Dichter des Rokokozeitalters, heißende Sonderkorrespondent, der vordem, kaum mit viel Vergnügen, aus Rom antiklerikalen Stunk hatte produzieren müssen — machte nun seinem Namen mehr Ehre denn zuvor. So nebenbei, für Polen ist bezeichnend, daß die beiden großen Spezialisten für römisch-vatikanische Angelegenheiten, die Grafen Krasicki und Breza, der glanzvolle, geistreiche Autor zweier Bestseller über die Kurie, mit den Wölfen heulten, doch sie lassen ihre Stimme lieber und besser in einem lieblichen Chor ertönen.
Wir dürfen noch weit wichtigere Tatsachen verzeichnen. Zunächst die besondere Gunst, die der Heilige Vater dem nach Rom gekommenen polnischen Episkopat bezeigte. Zweimal wurde dieser in Sonderaudienz empfangen. Die dabei vernommenen Äußerungen Johannes' XXIII. waTen Von überströmender Herzlichkeit. Eine davon hat eine kleine politische Sensation ausgelöst, wovon noch zu erzählen sein wird. Ein drittes Mal traf der Papst mit den polnischen Bischöfen, der Öffentlichkeit völlig unerwartet, in der polnischen Nationalkirche St. Andreas zusammen, wo die Gebeine des heiligen Stanislaw Kostka ruhen. Dabei richtete der Heilige Vater an die Oberhirten und an die herbeieilenden Polen Roms Worte voll liebevollen Wohlwollens im Rahmen eines ungezwungenen Gesprächs, das sich an ein Gebet am Grabe des polnischen Heiligen anschloß.
Daß sich dahinter nicht nur rein innerkirchliche Beweggründe verbergen, dazu seien nun einige Fakten berichtet. Am 20. November gewährte Johannes XXIII. dem Mitglied des polnischen Staatsrates (des kollektiven Staatsoberhaupts) Zawieyski eine halbstündige Privataudienz. Die Bedeutung uicst-i ucsic wiiu uauurcn unier-Strichen, daß der unmittelbar vorher erschienene japanische Ministerpräsident Ikeda auch nicht länger beim Heiligen Väter verweilte und daß seit langem keiner weltlichen Persönlichkeit von geringerem Rang als dem eines individuellen Staatsoberhauptes oder Regierungschefs ein so ausgedehnter Empfang beschert worden war. Zudem noch dieses: Zawieyski ist zwar frommer, praktizierender Katholik und Exponent der Gruppe „Znak“, doch immerhin Mitglied der obersten Körperschaft eines kommunistischen Landes, der sich wiederholt für engste Zusammenarbeit mit dem jetzigen Warschauer Regime eingesetzt hat. Zweitens: zugleich mit dem Konzil war in Rom der kommunistische Parteitag versammelt. Daß auf diesem Togliatti die freundlichsten und geradezu ehrerbietigen Worte über den Papst fand und sich für Kooperation mit der Kirche aussprach, wird durch eine sogar in politischen Kreisen kaum beachtete andere Tatsache an Bedeutung übertroffen.
Leiter der polnischen Delegation zum römischen Parteitag war das Polit-r büromitglied Kliszko. Er ist von jeher als Befürworter einer Verständigung mit der Kirche bekannt. Er war es, der den in einem Karpatenkloster internierten Kardinal Wyszynski im Oktober 1956 persönlich von dort nach Warschau holte und der beim später erzielten Modus vivendi zwischen Kirche und Staat Pate stand. Derselbe Kliszko hat nun in einem Interview für die kommunistische Hauptzeitung „Unitä“ sich für ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl erklärt. Daß seit einiger Zeit Verhandlungen über die Aufnahme, zunächst inoffizieller, diplomatischer Beziehungen zwischen dem
Vatikan und Warschau im Gange sind, übrigens auch zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Kreml, ist in Rom den eingeweihten Kreisen kein Geheimnis. Man bietet sogar den Namen des Kandidaten für die polnische Vertretung herum. Zwischen der polnischen Botschaft und dem Episkopat gab es während des Konzils ständige Kontakte. Um diese nach außen hin zu unsterstreichen, wurde in einem Kommunique mitgeteilt, der Botschafter Willmann sei beim Primas erschienen und dieser habe den Besuch in der Botschaft erwidert.