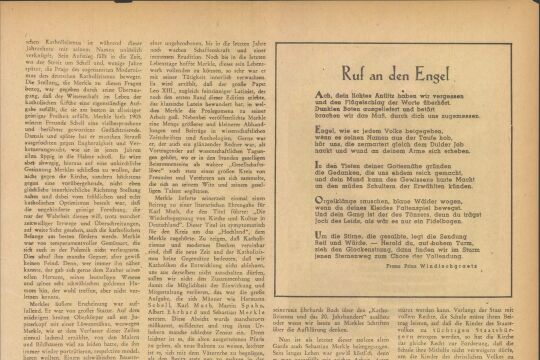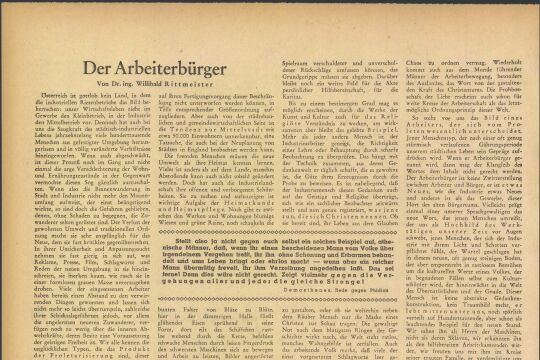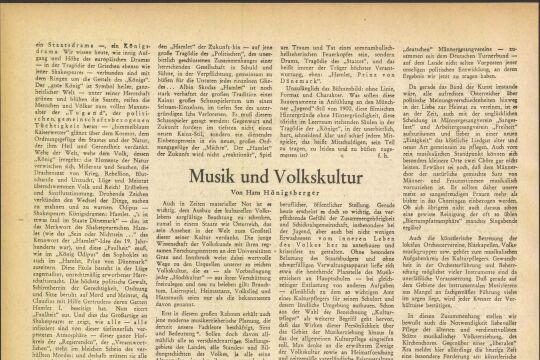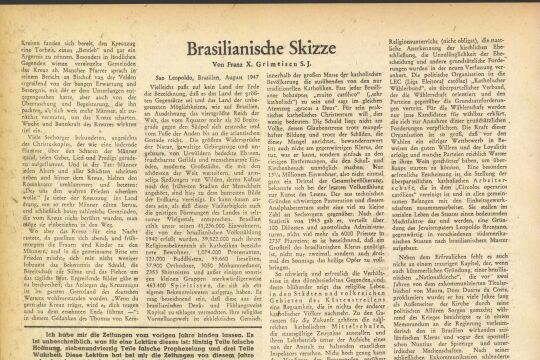Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DER MENSCH UND DIE KÜNSTE
Der Präsident der mit Recht gerühmten Harvard-Universität in den Vereinigten Staaten erklärte unlängst, die Freiheit im Staate könne nur von Bürgern mit Erlolg verteidigt werden, die hinreichend imstande sind, politische, wirtschaftliche und soziale Vorgänge einwandfrei zu analysieren Offenbar wollte der Präsident die Tatsache herausstellen, daß es unter dem Gesetz einer freiheitlichen Ordnung im Staate kein Spiel mit verteilten Rollen der Akteure auf der politischen Bühne und des mehr oder weniger teilnehmenden Publikums gäbe. Bei unbefangener Betrachtung der Verhältnisse, in denen wir leben, wird man dem Universitätspräsidenten wahrscheinlich nur recht geben können.
Bei solcher Betrachtung angelangt, wird man aber auch nicht umhin können, sich zu fragen, ob nicht etwa verwandte
Anforderungen auch für das Leben im Bereich des musischen Daseins Geltung haben oder jedenfalls Geltung haben sollten. Ohne Zweifel dürfen wir jenes Kunstwerk als aufs beste gelungen bezeichnen, das sich über einer ungebrochenen und in innerem Zusammenhang stehenden Verbindung erhebt, die sich von einer inspirativen Kraft des dazu befähigten Auftraggebers über die produzierende und reproduzierende Schaffensleistung der Künstler bis in die Reihen eines aufnahmefähigen Publikums erstreckt. Solche optimale Voraussetzungen hat es zum Beispiel in der Ära des Barocks in Österreich sowohl für die Architektur als auch für die Musik gegeben. Ich möchte das nicht einfach von der Qualität der Geschmacksbildung in der traditionsgebundenen Gesellschaft von einst ableiten, so wie ich die heute offenbar vorherrschende Störung dieser Verbindung nicht nur der verlorenen Einheit unserer Kultur zuschreiben darf. Was das von mir gewählte historische Beispiel anlangt, so darf ich nur kurz auf die wunderbare Trinität hinweisen, die etwa zwischen dem Prinzen Eugen von Savoyen, Lukas von Hildebrandt und dem Vienna gloriosa jener Tage bestand oder die noch 120 Jahre später bei Franz Schubert hinsichtlich Auftrag, Werk, Aufführung und Genuß unübersehbar war.
Unsere heutige offene Kultur, in der längst nicht mehr alle das gleiche zu denken gewohnt sind und es langsam verlernen, auch gleich denken zu können, läßt eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten offen und scheint in der Tat einen hohen Grad geistiger Unabhängigkeit zu bieten. Daraus ergeben sich — was das Musische anlangt — zwei Folgen für die Kultur unserer Zeit:
Erstens: Der Verlust der inneren Einheit unserer Kultur und die Vielzahl der sich aufdrängenden Wahlmöglichkeiten haben die einstens selbstverständliche Trinität zwischen Auftrag, Werkschöpfung und Nachschöpfung sowie Aufnahme des Werkes zerstört. Die geradezu sakrosankt gewordene Diskrepanz zwischen dem Ursprung der Produktion und den Fernwirkungen in der Konsumation — etwa bei Werken der bildenden Kunst — drängt einerseits die Kunstdarbietung In Enklaven esoterischer Liebhaberkreise ab und weist der Reproduktion, die nun allerdings einen nie gekannten Grad der Perfektion gewinnt, eine bis dahin ungewohnte dominante Stellung zu.
Zweitens: Es ergibt sich immer mehr, daß der einzelne, der im vollen Genuß der Wahlfreiheiten der offenen Kultur steht, dem Ausmaß der ihm gewährten Freiheit nicht gewachsen ist. Pflegte man vor einiger Zeit zu sagen, ein Intellektueller sei ein Mensch, der mit seiner Bildung nichts anzufangen weiß, dann hinterläßt das heute vorherrschende Prinzip der Freiheit in der Kunst zuweilen den Eindruck, daß hier die Gefahr einer Wiederholung dessen besteht, was in den letzten Generationen weite Bereiche des geistigen Lebens brillant, aber steril gemacht hat.
Da es nun von dem Verlust der Einheit der Kultur keinen Weg zurück gibt, es sei denn um den Preis einer aufgezwungenen Staatskultur oder ähnlichem, und da der einzelne im Gegensatz zu früheren Zeiten seine Individualisation mit den Gefahren der Beziehungs- und Haltlosigkeit in dieser Umwelt bezahlen muß, hängt alles weitere von der Art der Erziehung und Bildung dieses einzelnen ab. Der einzelne, das ist im Bereich des Musischen der Mensch„der im Umkreis seines höchstpersönlichen Daseins die bleibende und überzeugende Darstellung des Wahren, Guten und Schönen brauchen würde (auch wenn er sich dieses Verlangens nicht immer bewußt ist); der Mensch, der zuweilen die Begabung hat, diese Kunstwerke zu schaffen und darzubieten; der Mensch, der erst in einem Convivium mit anderen in der Mitteilung des Guten, Wahren und Schönen selbst genießt. Uns ist es selbstverständlich, daß der einzelne Kulturträger, die einzelne kulturelle Körperschaft zu ihrer Tätigkeit des größtmöglichen Ausmaßes an Freiheit bedürfen. Weniger .selbstverständlich bejahen wir aber die Tatsache, daß das Leben der dichtenden oder bildenden Künstler, der Musiker oder Theaterregisseure, der Lehrer, Universitätsprofessoren und Geistlichen von strengen geistigen Ordnungen bestimmt sein muß, soll es Gehalt und Ausdrucksfähigkeit haben. Die freie Wahl, die der einzelne bei seiner Bindung an die ihm gemäß erscheinende Ordnung vornimmt, ist nur dem möglich, der sich zuerst der Zucht in der Erziehung und Bildung seiner Persönlichkeit unterworfen hat.
Solche theoretischen Erwägungen sind am Beginn von Festspielen kein Spiel mit Worten und Begriffen. So wie der eingangs zitierte Universitätspräsident für den von ihm betrachteten Bereich des gesellschaftlichen Daseins eine starke analytische und wohl auch konstruktive Kraft verlangt hat, steht auch diese Festspielgemeinde unter einem verwandten Gesetz.
Ich spreche hier den engeren Krejs an. Würde es uns aber nicht gelingen, die vorhin erwähnte und scheinbar endgültig untergegangene Trinität wiederzugewinnen, dann wäre der Zerfall der Gemeinde in Producers, Interpreters und Consu-mers endgültig. In diesem Augenblick würde der Sieg des perfekten Mechanizis^us über die Idee der Festspielgemeinde endgültig. Um diese Gefahr zu umgehen, ist es notwendig, daß sich hinter dem Marmor höchster Vollendung die Ziegelbauten der Stätten der Erziehung des Gemütes, des Wissens und des Könnens erheben. Die Salzburger Festspiele entstanden in einer Zeit, da in der uralten Bischofsstadt das Conti-nuum seiner geistigen und geistlichen Tradition nahezu erloschen gewesen ist. Aber — so wie sich über dem im Krieg verwüsteten Dom aufs neue die Kuppel des erneuerten Gotteshauses erhoben hat, so wird sich nach Jahrzehnten und Jahrhunderten der Verödung der einstens blühenden Universität die erneuerte Universität erheben. Die neue Ordnung des Schulwesens unseres Landes gestattet es den Wurzeln des kulturellen Lebens, wieder tiefer in zukunftsträchtige Schichten in Land und Stadt zu dringen. So soll neben der gewohnten festlichen Repräsentanz eine erziehungsmächtige Neuordnung des Lebensraumes mit dichterer Streuung der dazu notwendigen Institutionen wachsen. Was jeder Künstler weiß, muß allen bewußt werden: Die bewunderte Leistung setzt die Askese im Jugendalter, die innere Sammlung, die behutsame Bildung voraus.
Bei der Eröffnung einer großen Wirtschaftsschau fiel kürzlich das Wort, die Österreicher seien nicht nur Tänzer und Geiger, sondern auch Menschen, die hart zu arbeiten verstehen. Lassen wir uns ob solcher Worte nicht den Ernst verdrießen,1 den wir brauchen, um als Werkleute in den uns anvertrauten Bereichen des geistigen Lebens bestehen zu können. Damit von hoher Bühne die Brillanz der Arie erklinge, bedarf es des ununterbrochenen Singens und Musizierens in täusenden Schulstuben landauf und landab; bedarf es unablässiger Bemühungen in allen Bereichen des kulturellen Lebens, nicht nur in den hohen Regionen der Geisteskultur; bedarf es des Augenblickes zu den höchsten Werten, bevor wir uns an die unvollkommene Nachahmung wagen.
Mögen diese Festspiele vielen Teilnehmern den Aufblick zu solchen Höhen bringen, mögen sie uns allen Mut machen in der Hütung des geistigen Klimas unseres Landes, mögen sie unseren kostbarsten Schatz bergen: die Begeisterungsfähigkeit der Jugend!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!