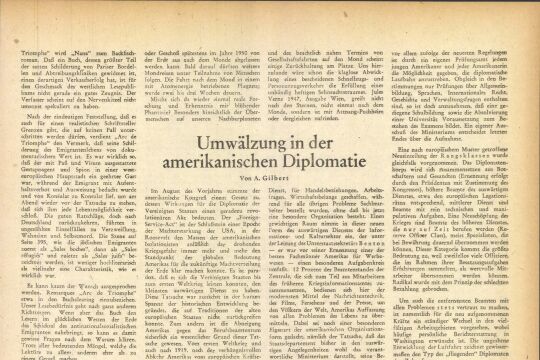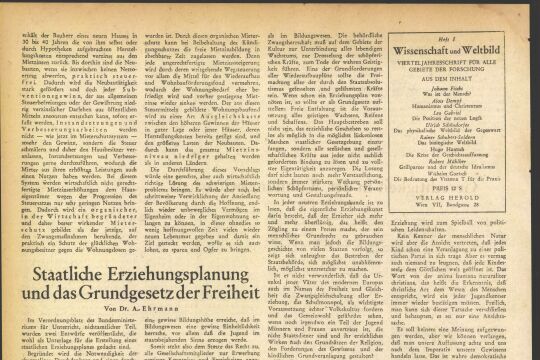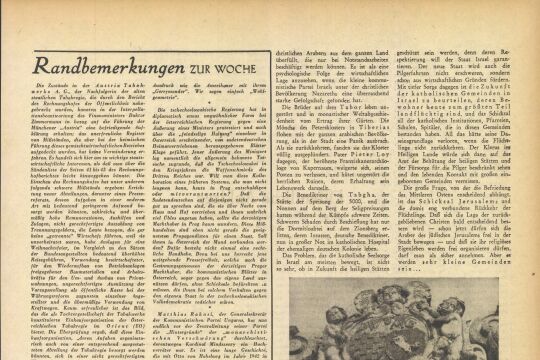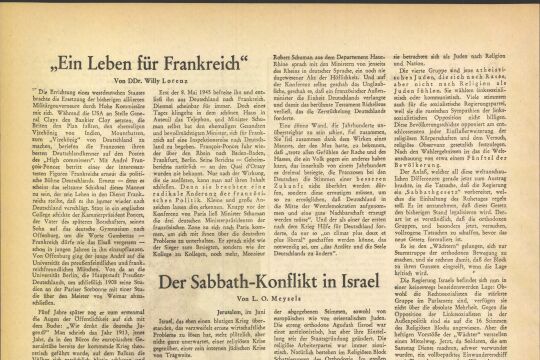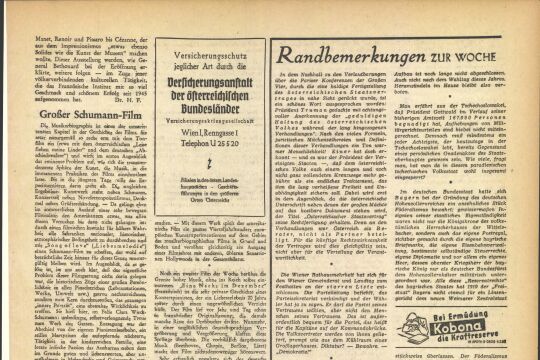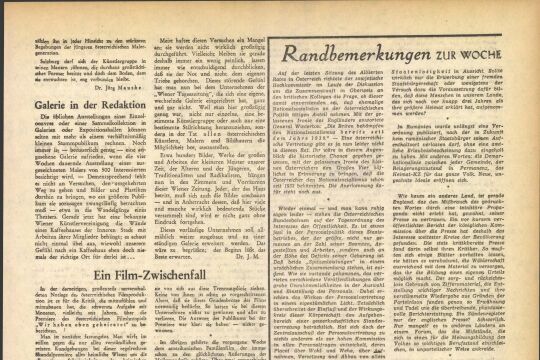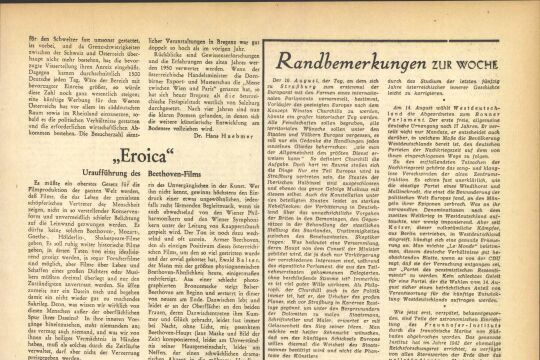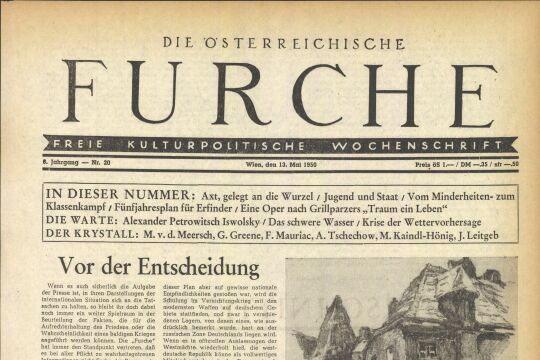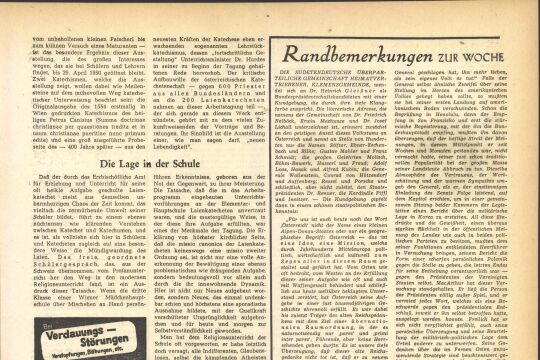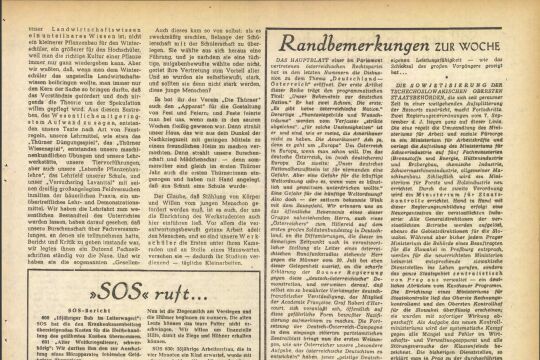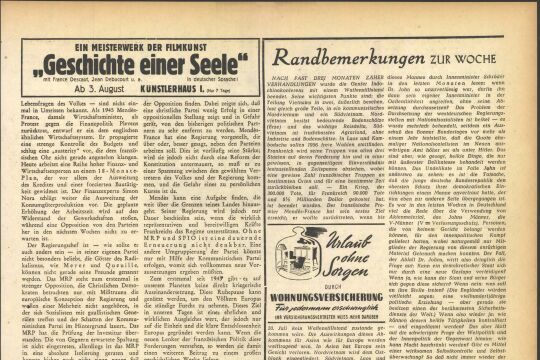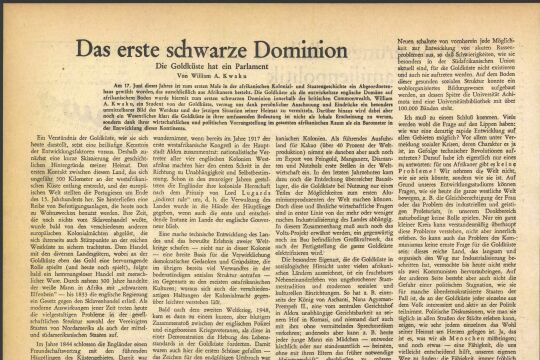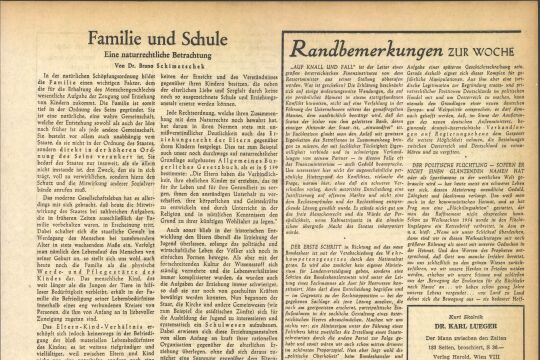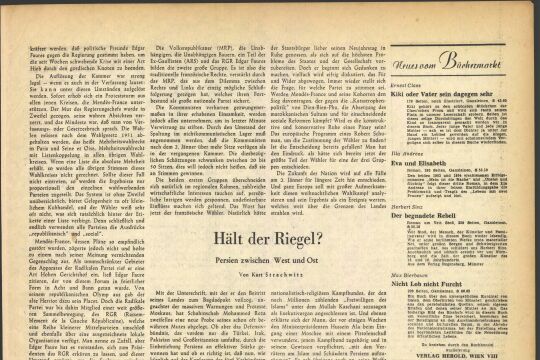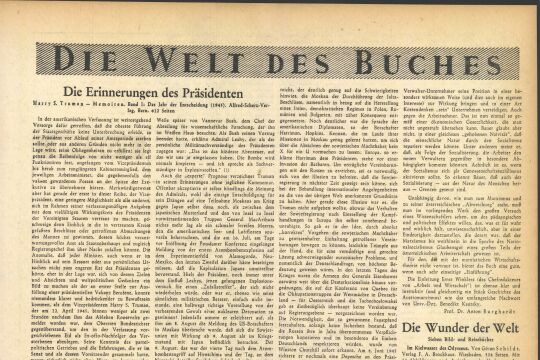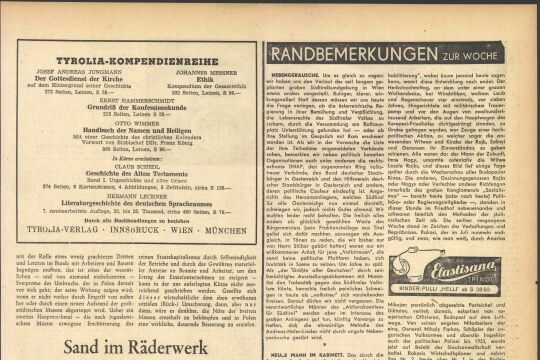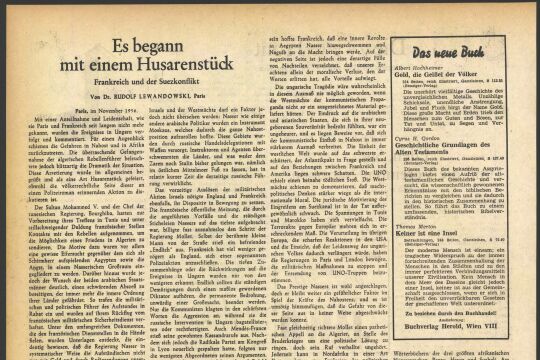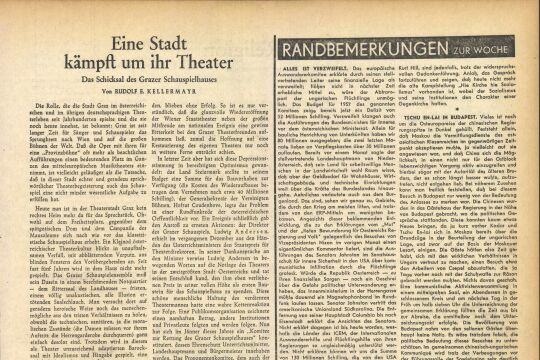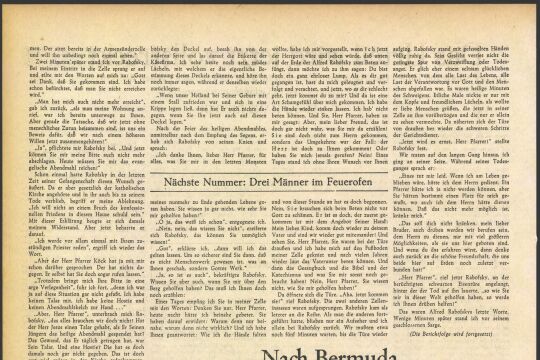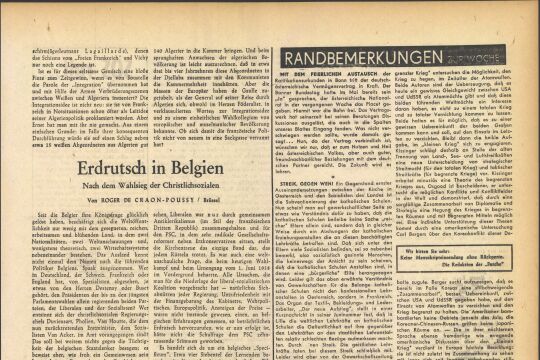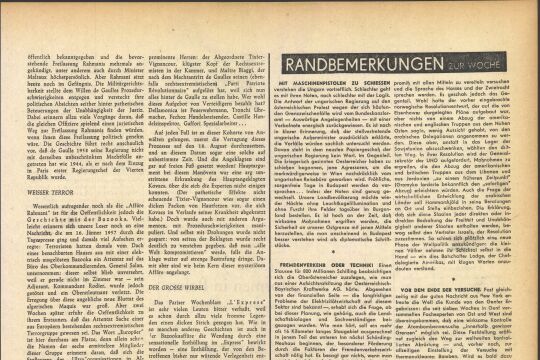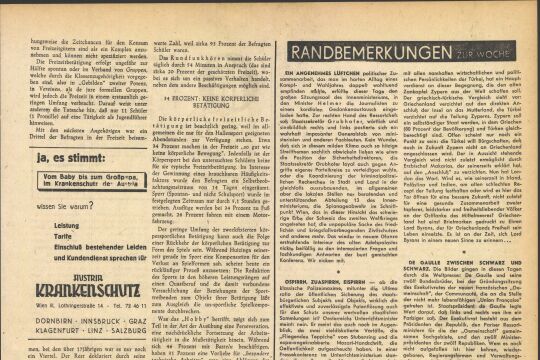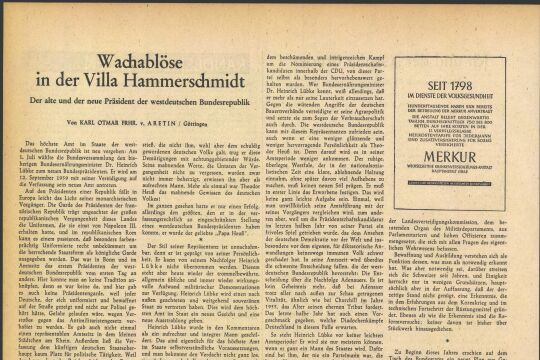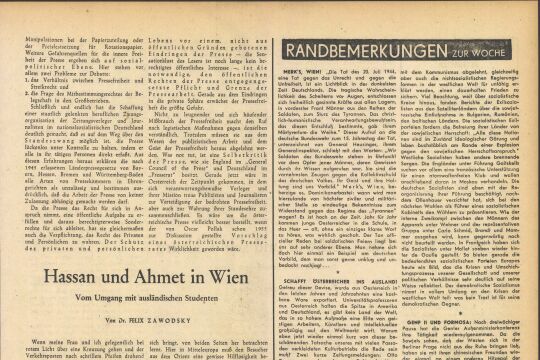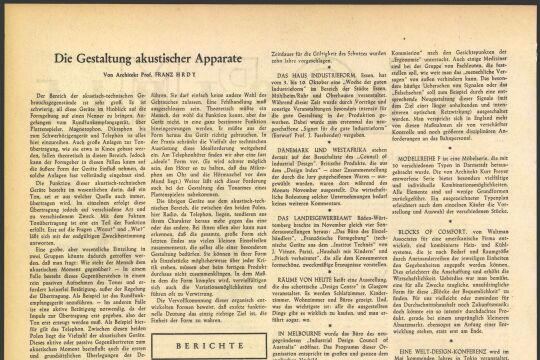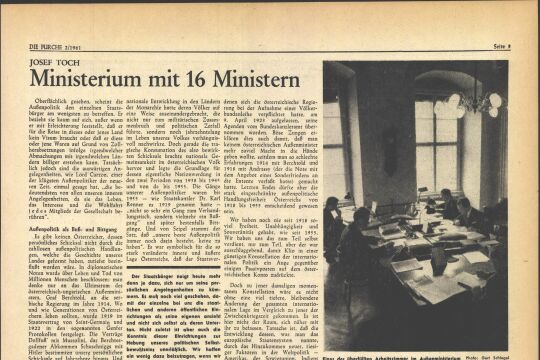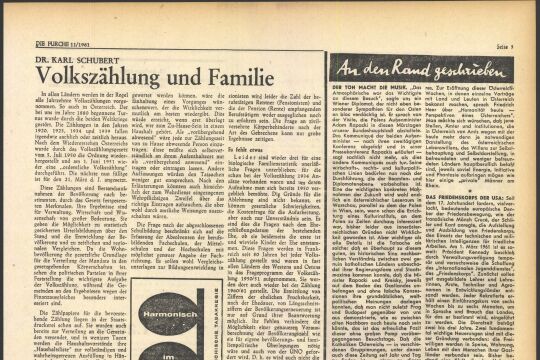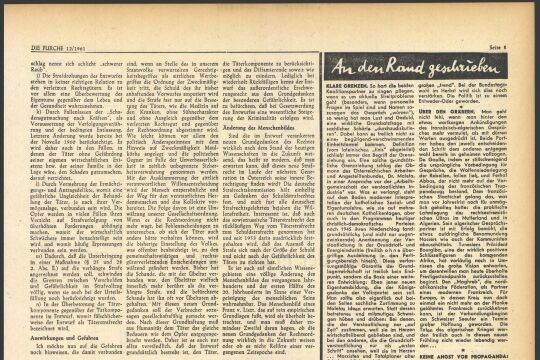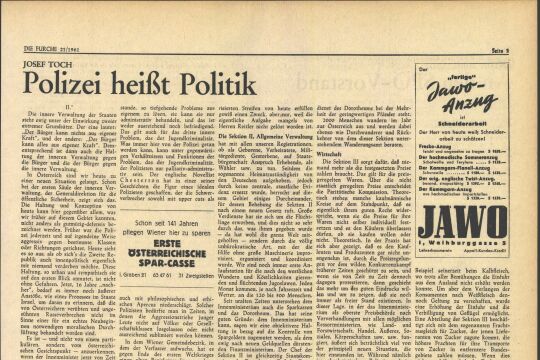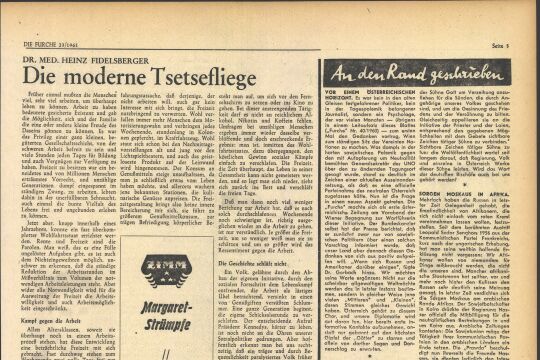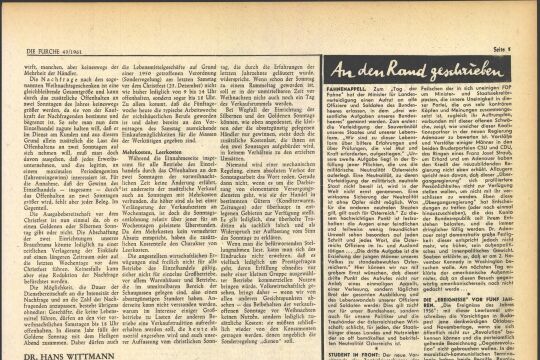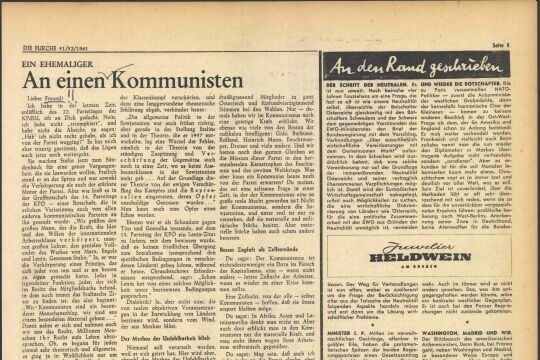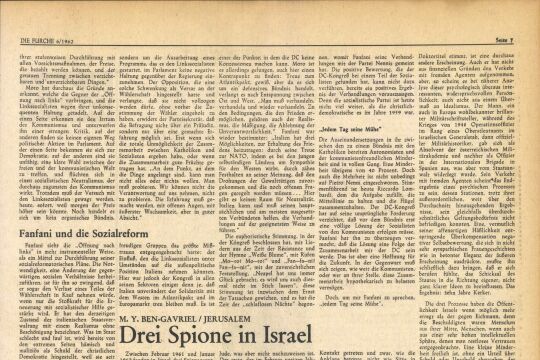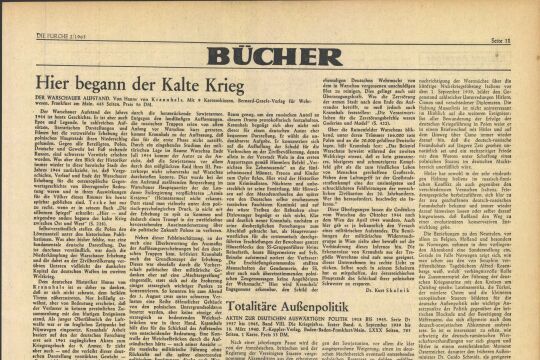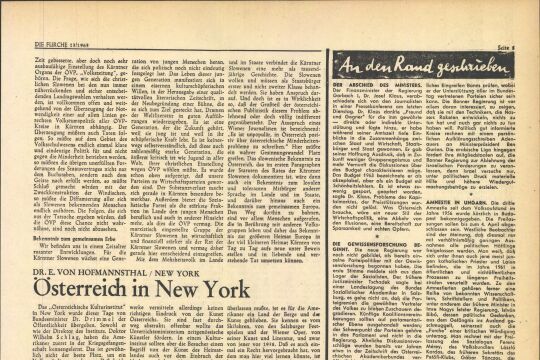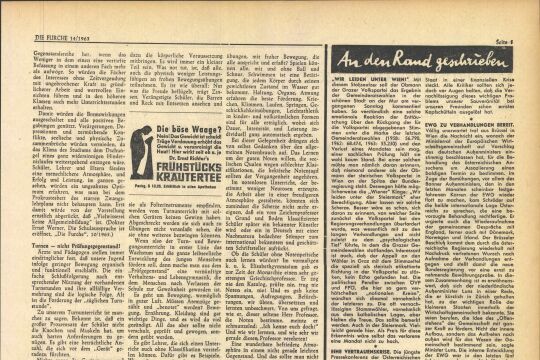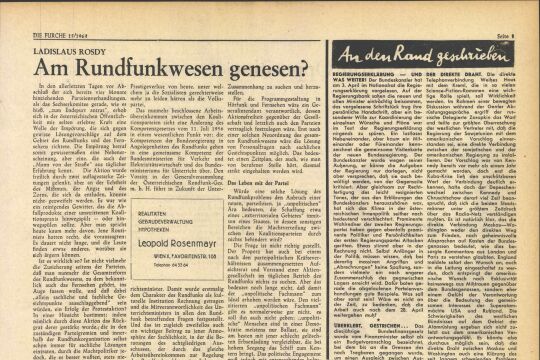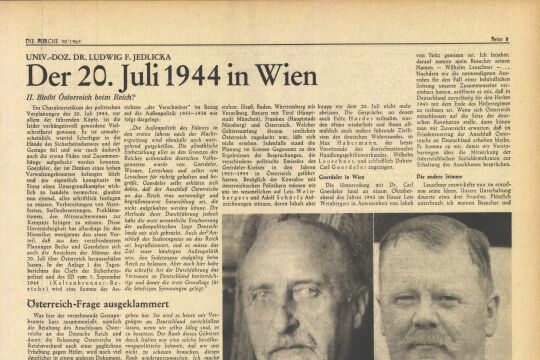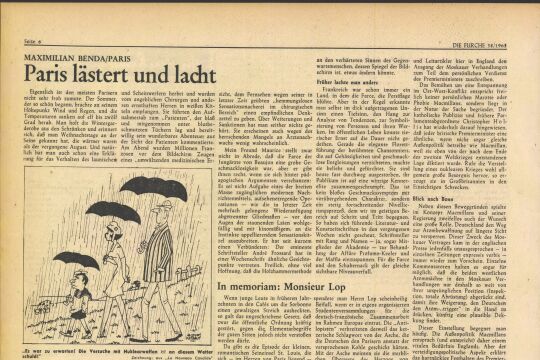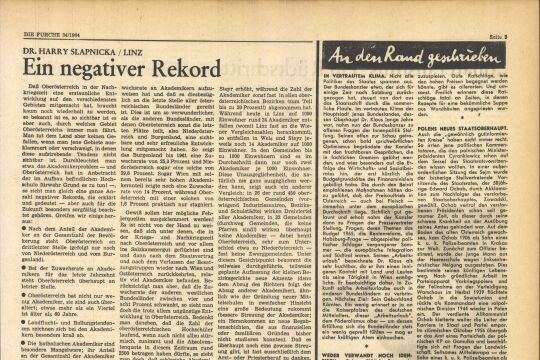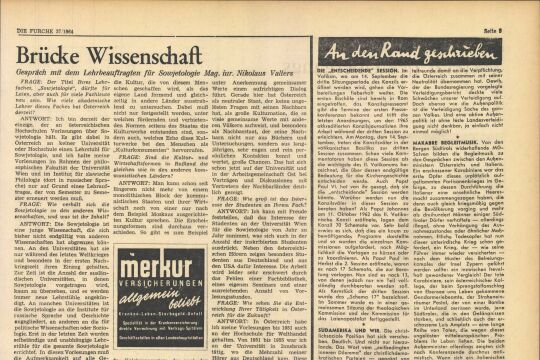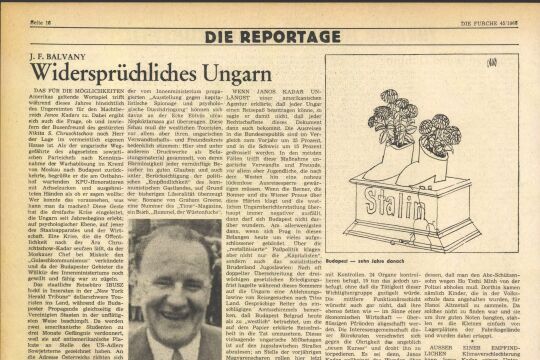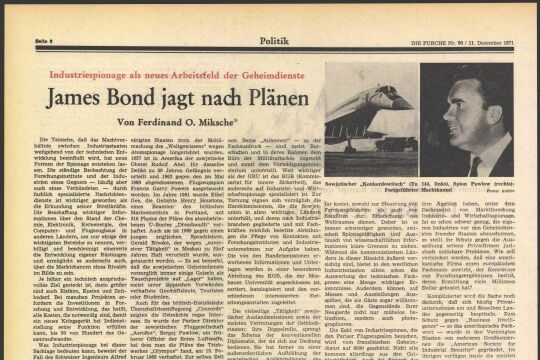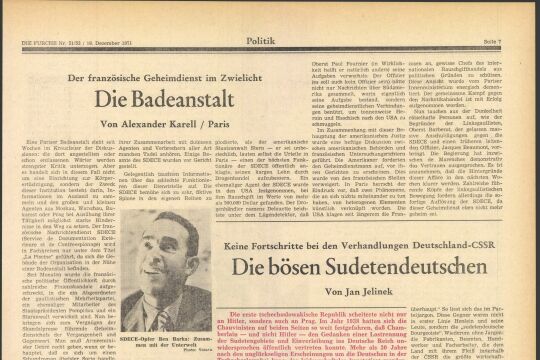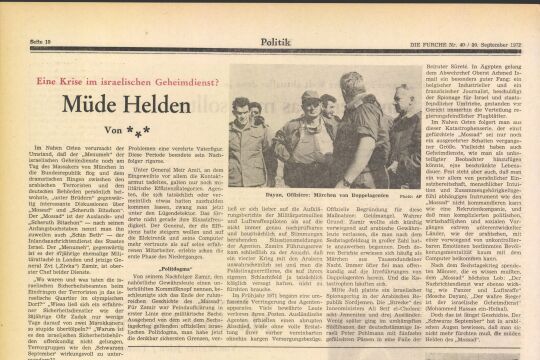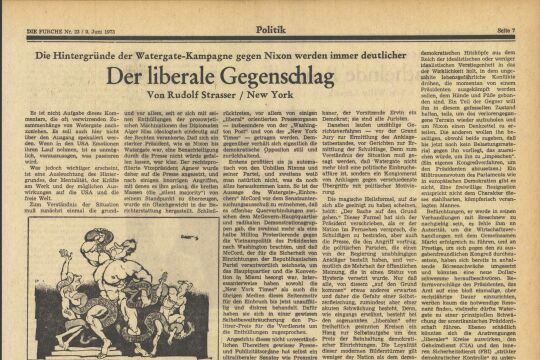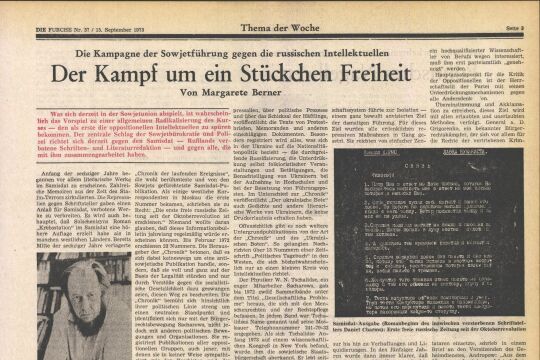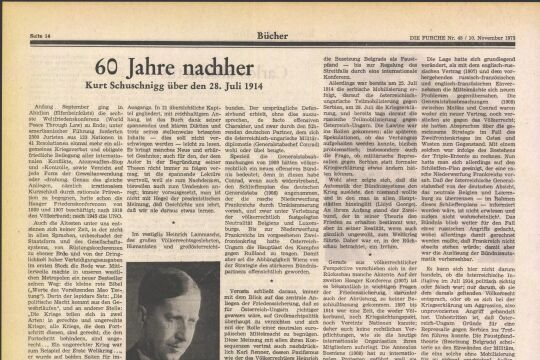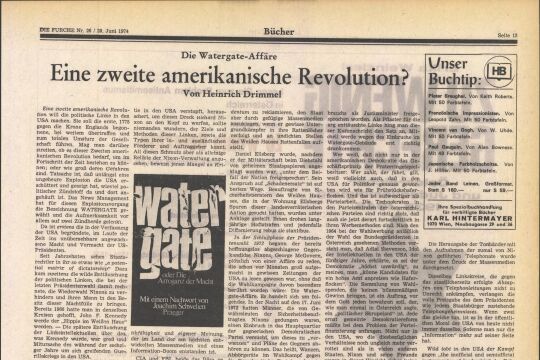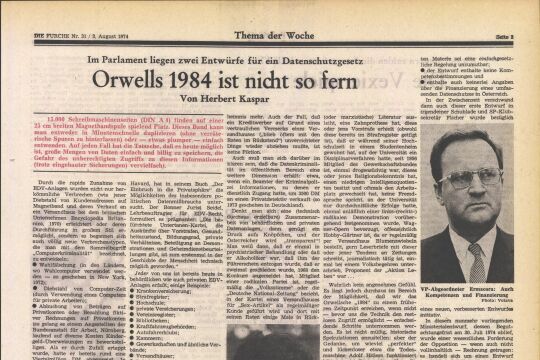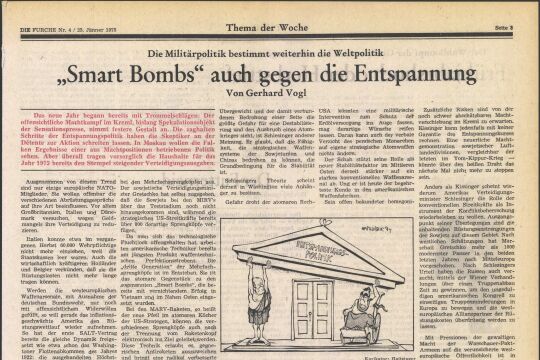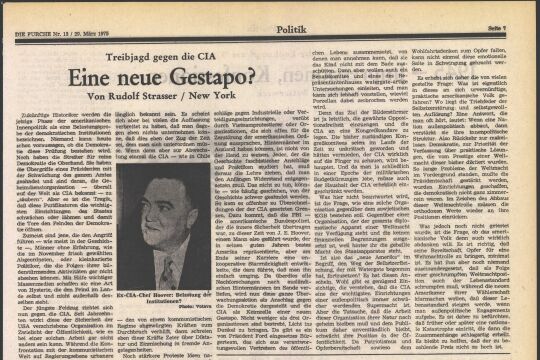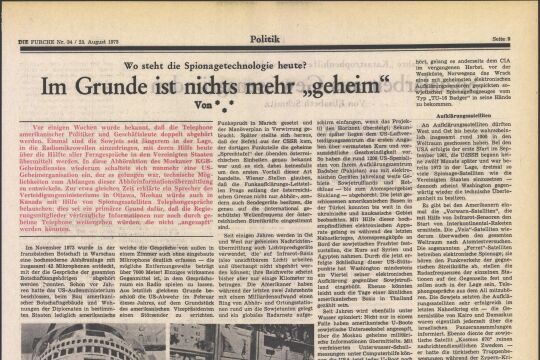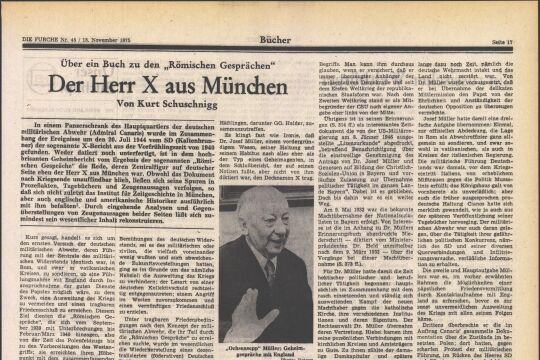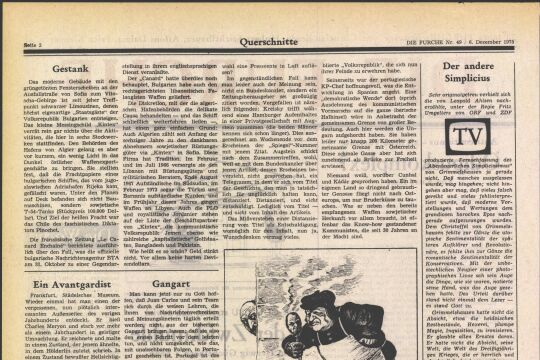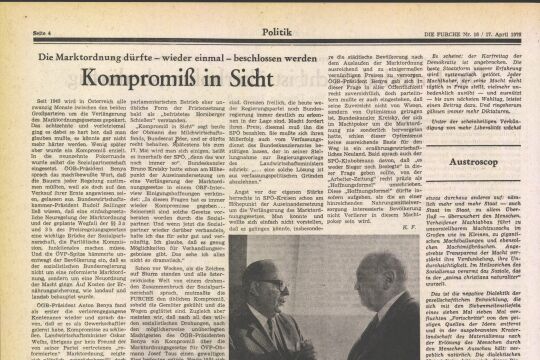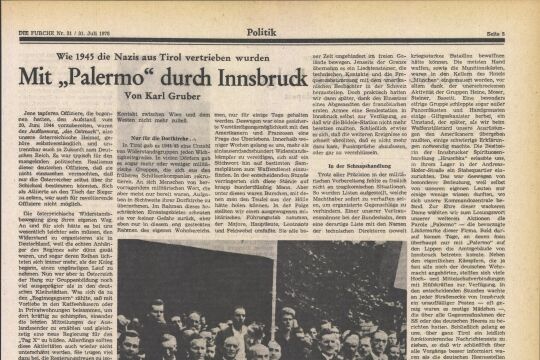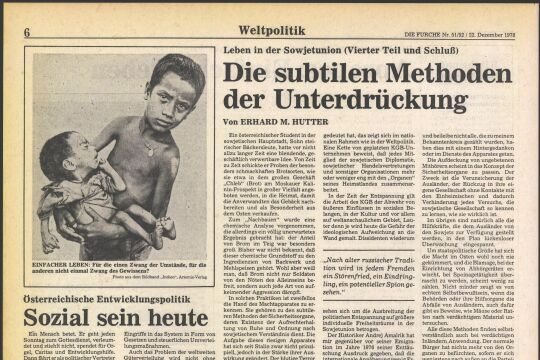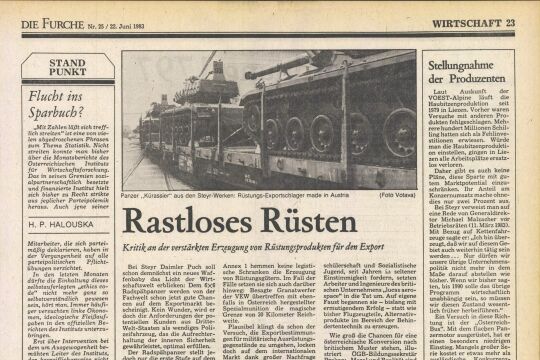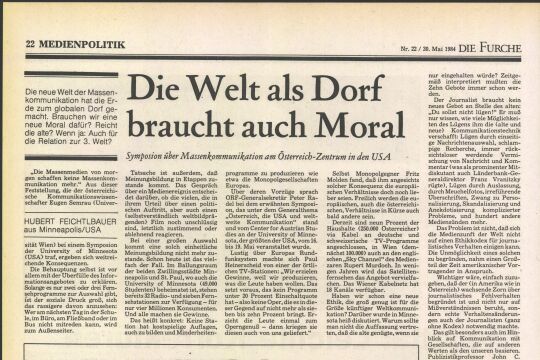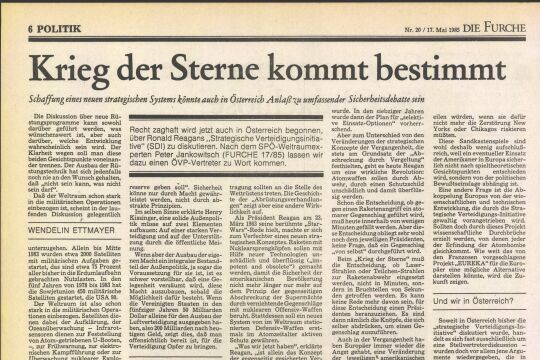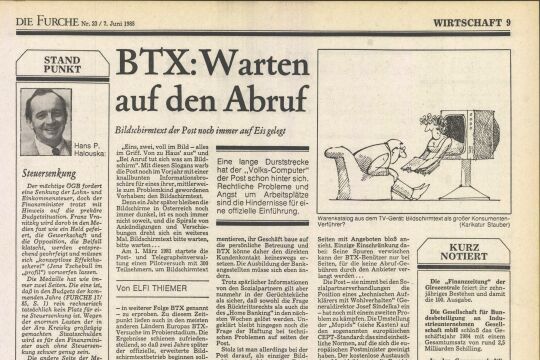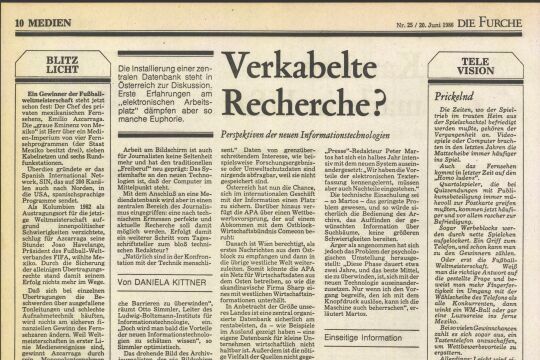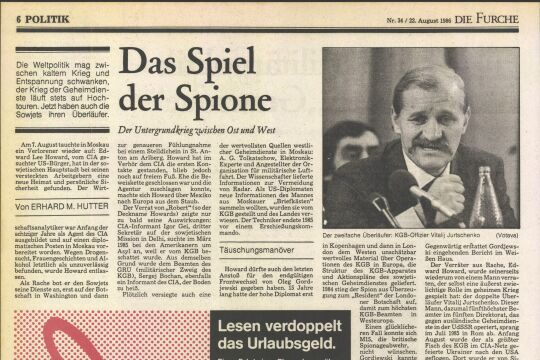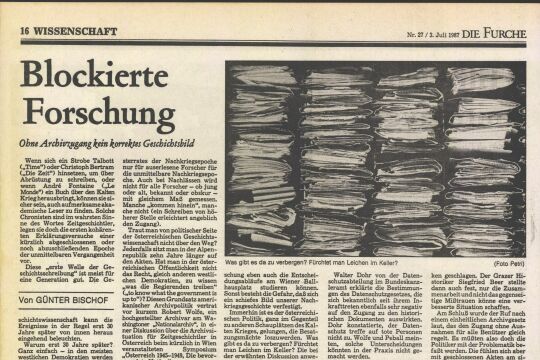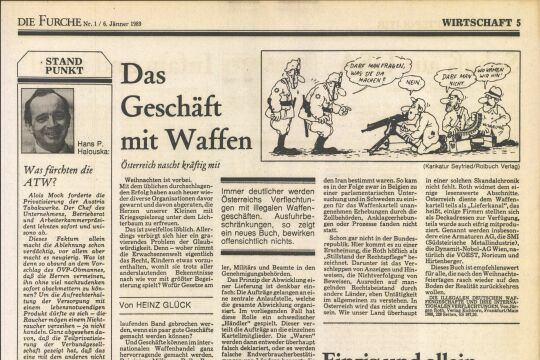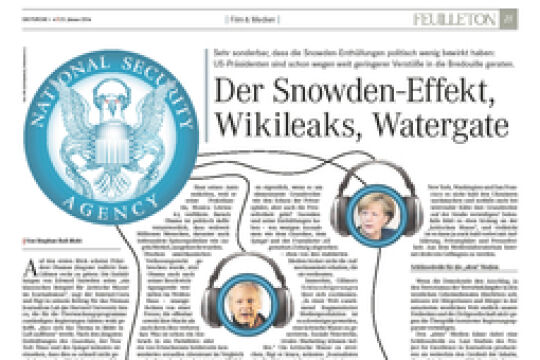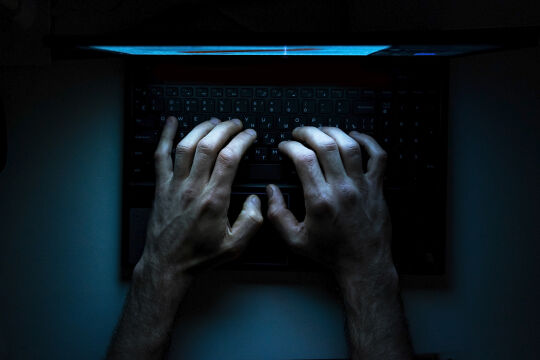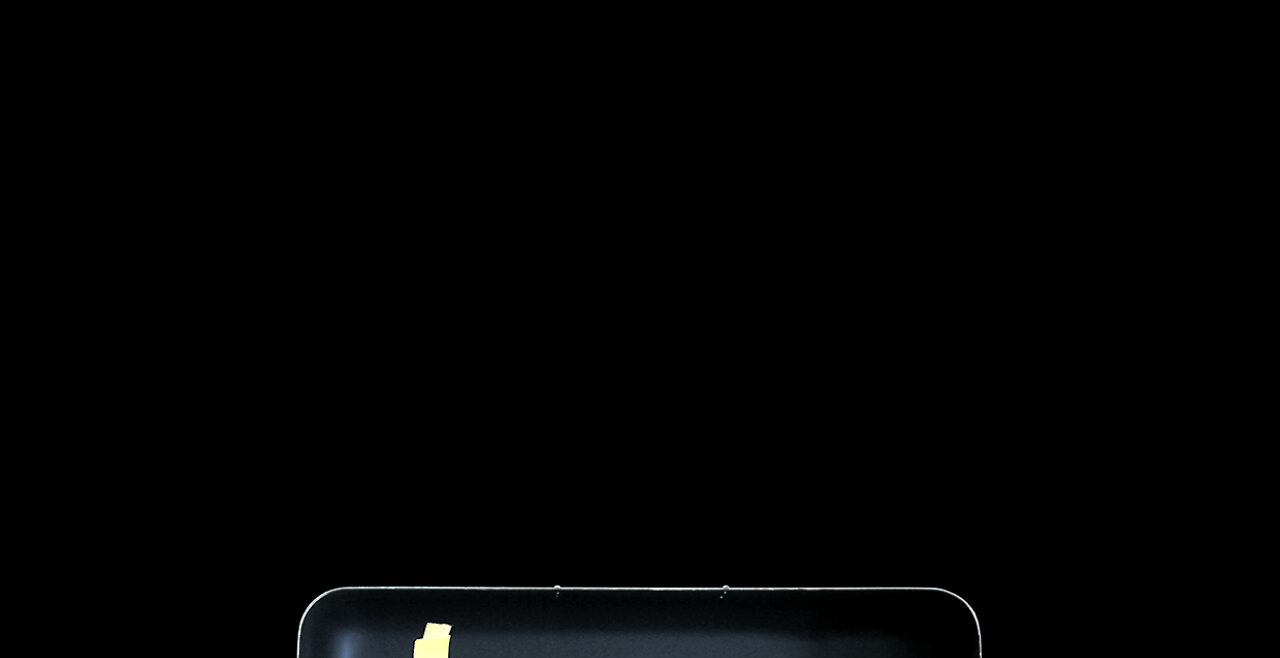
Österreich im Abhör-Sog
Die „Operation Rubikon“ um CIA und Bundesnachrichtendienst ist eine der größten Spionage-Affären der Weltgeschichte. Wie involviert war Österreich?
Die „Operation Rubikon“ um CIA und Bundesnachrichtendienst ist eine der größten Spionage-Affären der Weltgeschichte. Wie involviert war Österreich?
Geheimdienst-Enthüllungen haben es so an sich, spektakulär zu sein. Das, was kürzlich unter dem Titel „Cryptoleaks“ enthüllt wurde, hat dann aber doch eine weltpolitisch-historische Dimension von bisher ungeahntem Ausmaß: Über Jahrzehnte belauschten der US-Geheimdienst CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) in einer gigantischen gemeinsamen Abhör-Aktion die verschlüsselte Kommunikation von mehr als 100 Ländern. „Offiziell“ gestartet 1970, umfasste die „Operation Rubikon“ strategisch lohnende Ziele. Saudi-Arabien und der Iran waren laut gemeinsamer Recherche von ZDF, Washington Post und Schweizer Rundfunk ebenso unter den Belauschten, wie die Atommächte Indien und Pakistan, Argentiniens Militärjunta der 70er und 80er und der Vatikan. Aber auch verbündete EU- und Nato-Staaten wie Italien, Spanien und die Türkei gerieten ins Visier der Abhörer – ebenso wie das neutrale Österreich.
Wie die Nachrichtendienste zu ihren großflächigen Abhörmöglichkeiten kamen, klingt wie der Stoff aus einem Agententhriller: Alle betroffenen Staaten hatten Verschlüsselungsgeräte der Schweizer Firma Crypto AG gekauft. Was sie nicht ahnten: Das Unternehmen war längst in Besitz von CIA und BND. Die Dienste manipulierten die Geräte vor Auslieferung – und ermöglichten sich so das Mitlesen in Echtzeit bis in sensibelste politische Bereiche.
Wien im Fokus
Auch Österreich kaufte in den 1970er Jahren laut Recherchen der Presse Verschlüsselungstechniken der Crypto AG. Demnach hatten sowohl Außen- als auch Verteidigungsministerium entsprechende Geräte im Einsatz. Die Hintertür zum Mitlesen wurde aber entdeckt, ab den 1980ern sollen hierzulande keine manipulierten Geräte mehr im Einsatz gewesen sein. Auf Medienanfragen reagierten die Ministerien bislang zurückhaltend. Eine offizielle Bestätigung oder ein Dementi seitens österreichischer Behörden gibt es bis dato nicht.
Der Historiker und Geheimdienstexperte Thomas Riegler hält es für durchaus plausibel, dass die manipulierten Geräte entdeckt wurden. Allerdings: Er habe sich bemüht, im Archiv der Republik einen Beleg dafür zu bekommen, „es ist bislang aber nichts gefunden worden. Wahrscheinlich wurden solche Akten nie ans Archiv abgegeben.“ Der Hinweis auf Crypto-Gerätschaft in Österreich stammt aus einem CIA-Dokument, das das ZDF auswertete. Wichtig wäre im Sinne der historischen Einordnung aber, den Beleg der Entdeckung in einem österreichischen Dokument schwarz auf weiß zu haben, meint Riegler. Einen solchen Beleg vermisst auch der Historiker Siegfried Beer, der sich mittels des von ihm gegründeten „Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies“ seit langen Jahren der Erforschung der Nachrichtendienste widmet. Er verweist auf die mangelnde Aufarbeitung der eigenen Geschichte seitens der europäischen Dienste, die in den USA längst üblich ist: „Es wäre sinnvoll, hier möglichst transparent zu agieren.“
Ausspäh-Praktiken abseits der Firma Crypto von den 1980ern bis heute, die auch – und gerade – Österreich betreffen, stehen ohnehin auf einem anderen Blatt. „Die Stasi hörte einst mit einer eigenen Lauschstation von der Wiener Botschaft aus Politiker-Telefone ab“, sagt Riegler. „Solche Mittel setzte sie sonst nur in Brüssel ein.“ Denn seit dem Kalten Krieg spielt Wien eine besondere Rolle als internationale Spionage-Drehscheibe – die sich bis in die heutige Zeit erhalten hat. Die geopolitische Lage zwischen Ost und West trug dazu ebenso bei, wie die zahlreichen internationalen Organisationen, die das Belauschen der Hauptstadt besonders interessant machen. Erleichtert wurden die Operationen ausländischer Dienste von der österreichischen Neutralität, der traditionell schwachen Spionage-Abwehr und der laxen Gesetzgebung: Man ließ internationale Agenten tendenziell gewähren, solange sie nicht gegen österreichische Interessen agierten.
Befreundete Dienste
Die Digitalisierung der vergangenen Jahrzehnte bedeutete für geheimdienstliche Arbeit eine Revolution, die Lauschangriffe in gigantischem Ausmaß vereinfachte. „Heute wird mit dem Schleppnetz abgefangen“, sagt Riegler. Man könne ausländischen Diensten allerdings schwerlich vorwerfen, dass sie ihre Arbeit machen. Die Frage sei, warum die heimische Abwehr oft kaum in der Lage sei, die Ausspähungen zu verhindern.
Gleichzeitig ist bekannt, dass die heimischen Dienste zum BND wie zu den US-Diensten seit Langem ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Das Heeresnachrichtenamt (HNaA), Österreichs Auslandsgeheimdienst, arbeitet etwa seit Jahrzehnten mit dem US-Dienst NSA zusammen. So wurde in den 1950ern die Errichtung der üppigen, vom HNaA betreuten Abhöranlage auf der Königswarte durch die USA finanziert, wie inzwischen bekannte Dokumente belegen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!