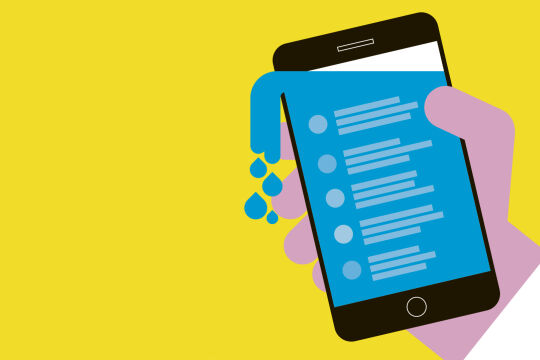Rettungsaktionen für die Gesprächskultur
Vor Kurzem hat die ORF-Journalistin Susanne Schnabl ein Aufsehen erregendes Interview mit Innenminister Herbert Kickl geführt. In ihrem Buch "Wir müssen reden" widmet sie sich -wie andere Zeitgenossen -den Voraussetzungen für konstruktives Streiten.
Vor Kurzem hat die ORF-Journalistin Susanne Schnabl ein Aufsehen erregendes Interview mit Innenminister Herbert Kickl geführt. In ihrem Buch "Wir müssen reden" widmet sie sich -wie andere Zeitgenossen -den Voraussetzungen für konstruktives Streiten.
Das Interview, das Report-Moderatorin Susanne Schnabl am 26. Juni mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geführt hat, sorgte für Diskussionen. Agierte die ORF-Journalistin "unhöflich" und mit mangelndem "Respekt", wie der bürgerliche Künstlermanager Herbert Fechter später im Programmausschuss des ORF-Stiftungsrates kritisierte? Oder war es gerade so, wie seriöser, guter Journalismus angesichts der Rhetorik eines habituellen "Diskurscrashers"(Armin Thurnher im Falter) auszusehen hat: freundlich im Ton, aber hart(näckig) in der Sache? Die Antworten sind geteilt - so geteilt und voneinander entfernt wie die ideologischen Beheimatungen derjenigen, die sie äußern.
Privat angesichts unterschiedlicher Positionen noch im Gespräch zu bleiben, ist freilich kaum einfacher, als ein professionelles Ministergespräch zu führen. Wie kultiviert streiten, damit der Kontakt nicht völlig abbricht? Diese Frage hat sich Schnabl in ihrem jüngsten Buch "Wir müssen reden" gestellt. Die ORF-Journalistin plädiert darin für eine neue Streitkultur und fragt sich, ob in aufwühlenden Zeiten tatsächlich die gesellschaftliche Diskursfähigkeit abhanden kommt -bzw. kommen muss.
"Man darf das nicht mehr sagen!"
Was bringt etwa die Besitzerin eines Nagelstudios dazu, ein Hassposting auf Facebook zu schreiben und darin ihrem Ärger freien Lauf zu lassen? Schnabl hat sich angehört, was die Wienerin aus dem 21. Gemeindebezirk zu sagen hatte. Als sie bei ihr anrief, brachte sie die Frau zum Staunen. Bisher war die Unternehmerin der Meinung gewesen, dass ihr ohnehin niemand zuhört. "Man darf das ja alles, was man sich so denkt, nicht mehr sagen", meinte sie.
"Ich mag solche Aufeinandertreffen, ein kontroversielles Gespräch, ein Streitgespräch", erzählt Schnabl in ihrem Buch. So gegensätzlich die Meinungen seien, am Ende habe sie etwas von ihrem Gegenüber mitgenommen, einen anderen, für sie neuen Blick auf die Welt gewonnen. Grundsätzlich sei ein Gespräch dann gelungen, wenn Menschen trotz unterschiedlicher Meinungen weiterhin miteinander reden können und wollen, meint Schnabl. Basis und Ziel erfolgreicher Gesprächskultur sei es folglich nicht, einer Meinung zu sein.
Mit ihrer Forderung "Wir müssen reden" schreibt Schnabl über die Sehnsucht nach dem Austausch und dem gleichzeitigen Rückzug ins digitale Biedermeier. "Filterblasen" nennt man dieses Phänomen. Doch auch im realen, analogen Leben bewegen sich Menschen oft wenig aus ihren "Komfortzonen", die den Blick auf die real existierende Meinungsvielfalt verdecken. Selbst die politischen Akteure bleiben immer bevorzugter unter sich. "Dass Politiker mittlerweile lieber ungefiltert auf ihren Accounts kommunizieren, ist bekannt", beschreibt Schnabl die Situation. Für sie selbst ist Reden und Argumentieren jedenfalls Alltag, und trotzdem war es für sie nicht immer leicht, ins Gespräch zu kommen. Eine große Hürde, die es für eine Vielzahl von Menschen zu überwinden gilt.
Miteinander reden will nämlich gelernt sein -und erst recht das Reden miteinander über konflikthafte Inhalte, weiß der Ökonom und Kulturhistoriker Walter Ötsch. Viele würden in solchen Fällen lieber schweigen und nur noch dort mitreden wollen, wo sie sich ohnehin verstanden fühlen. "Doch man muss versuchen, mit seinen Liebsten in Frieden zu leben, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist", meint Ötsch. Ob privat oder politisch: Ein Gespräch brauche jedenfalls klare Regeln, ist der Experte für politische Kommunikation überzeugt "Die Demokratie ist eine Diskursgemeinschaft - und Streit ist dann positiv besetzt, wenn er im Rahmen eines Regelwerks erfolgt."
Wahrheit oder Fake?
In Zeiten des aufkommenden Rechtspopulismus gehe allerdings die Basis, das Sachthema, verloren. Im Mittelpunkt stehe die Spaltung, die Zuordnung zu gut oder böse, zu Opfer oder Täter, zu Wahrheit oder Fake. Diese Spaltung und damit einhergehend der Abbau der Diskussionskultur lasse laut Ötsch eine neue Sehnsucht nach dem persönlichen Austausch, nach Gesprächen, nach dem gegenseitigen Zuhören entstehen. Im Alltag würde man freilich "viel zu wenig positiv aufeinander zugehen, um sich gegenseitig zu verstehen und sich miteinander auseinanderzusetzen". Welches Bild vom Gegenüber ist im eigenen Kopf? Wer ist dieser Andere? Diese geistige Vorstellungskraft sei entscheidend für den Verlauf und Ausgangs eines Gesprächs, betont Ötsch.
Wer sich in kunstvollen Auseinandersetzungen üben will, findet angesichts der aktuellen medialen Themenlage jedenfalls einen unerschöpflichen Übungspool: Die Palette reicht von Migration oder Klimawandel bis zu persönlicheren Reizthemen wie Impfen, Rad-versus Autofahren oder vegane Ernährung versus Fleisch. "Harmonie, eine Meinung in einer Gesellschaft, die alle teilen, erscheint utopisch oder gar undemokratisch", stellt Susanne Schnabl klar. Umso mehr brauche es eine kritische Öffentlichkeit -und damit auch Leidenschaft für die argumentative, mitunter harte, aber faire Auseinandersetzung. Im amerikanischen und britischen Schul- und Hochschulwesen gehören Debattierklubs zum Alltag. Dort wird mit rhetorischen Finessen geübt und trainiert. Österreich sei diesbezüglich ein Entwicklungsland, meint Schnabl.
Wie man adäquat und konstruktiv mit hiesigen "Stammtischparolen" umgehen könnte, hat der deutsche Politologe Klaus-Peter Hufer analysiert. Schon im Jahr 2000 hat er dazu ein eigenes "Argumentationstraining" gegen diskriminierende, generalisierende und schlagwortartig vorgebrachte Äußerungen publiziert, das heute aktueller ist denn je.
Rhetorische Gedankenspiele allein sind zur Vorbereitung auf solche Auseinandersetzungen zu wenig, weiß Hufer. Der Umgang mit Sprache, mit körperlichen Reaktionen und das Gefühl, persönlich angegriffen zu werden, müssten zuvor ausprobiert werden. Worum es am Ende geht? Nicht darum, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, meint Hufer, sondern darum, die Basis für ein Gespräch zu finden, in dem man einander zuhört und den anderen mit seiner Meinung tatsächlich wahrnimmt.
Kühlen Kopf bewahren
Dazu gehört auch, nicht sofort (Vor-)Urteile zu fällen. Journalistisch herausfordernd ist das insbesondere bei Sondersendungen zu Aufsehen erregenden Ereignissen, über die es noch wenige Informationen gibt, weiß Susanne Schnabl. Wie gefährlich die unüberlegte Verbreitung von Gerüchten und Vermutungen sein kann, erklärt die Report-Moderatorin in ihrem Buch anhand des Münchner Amoklaufs vom 22. Juli 2016, bei dem ein 18-Jähriger im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen getötet und fünf weitere verletzt hat. Der Vorfall war gekennzeichnet von einer Vielzahl von Gerüchten über Schießereien in der Münchner Innenstadt. Einen "kühlen Kopf zu bewahren fällt in emotionalen Ausnahmesituationen schwer", gibt die Journalistin zu und beschreibt damit nicht nur ihr Empfinden in der beruflichen Situation.
Werner Ötsch empfiehlt dazu, langsam von 10 bis 0 herunterzuzählen. Und dann zu überlegen: "Wie ist es mir ergangen, bevor ich mit einer unbegreiflichen Meldung konfrontiert worden bin?" Wer nach der emotionalen Aufruhr zur Ruhe zurückgefunden habe, könne die eigene Lage wieder realistischer beurteilen. Welchen Trick Susanne Schnabl am 26. Juni angewendet hat, um nicht die Fassung zu verlieren, weiß man nicht. Aber er hat jedenfalls weniger Zeit benötigt als zehn Sekunden.
Wir müssen reden. Warum wir eine neue Streitkultur brauchen. Von Susanne Schnabl. Brandstätter 2018.160 Seiten, geb., e 22,50