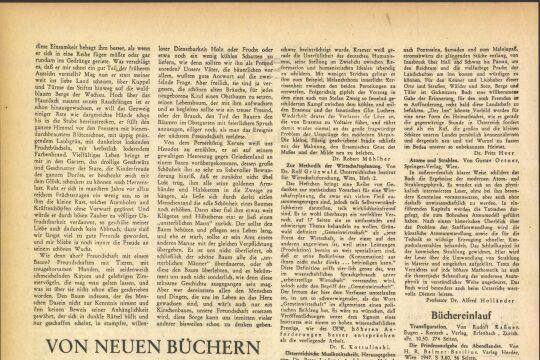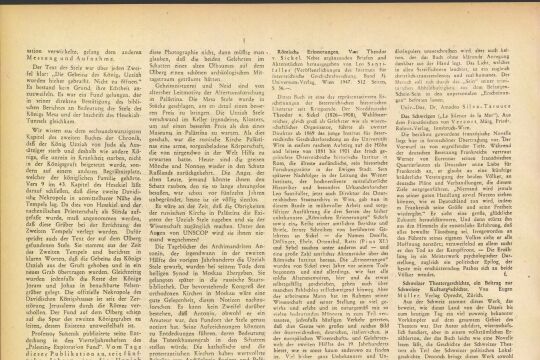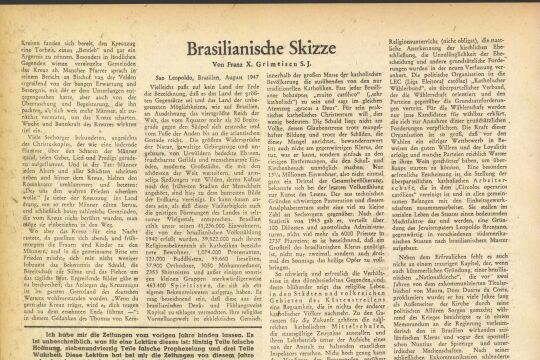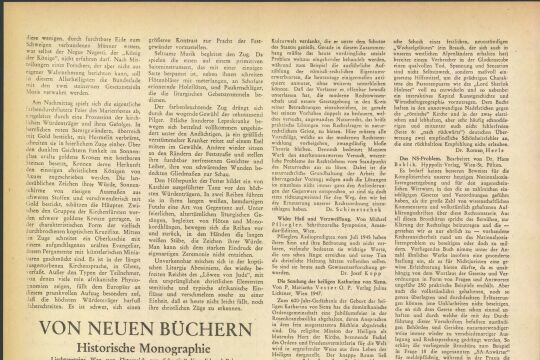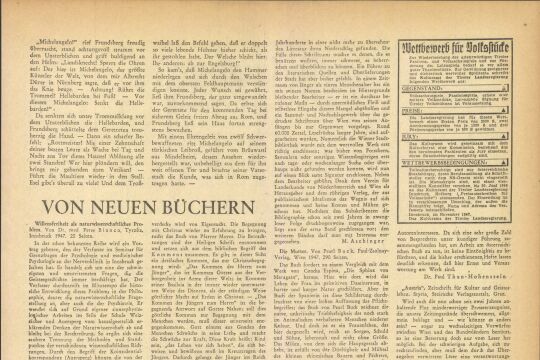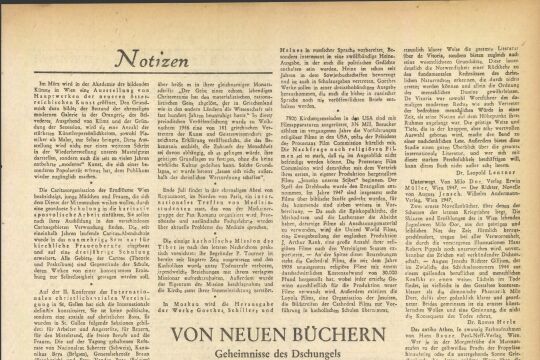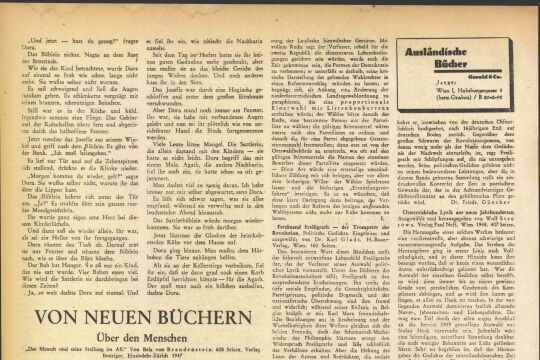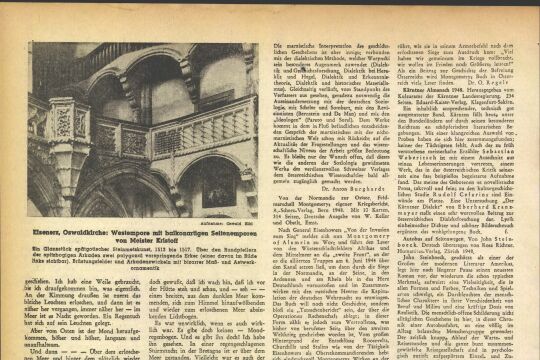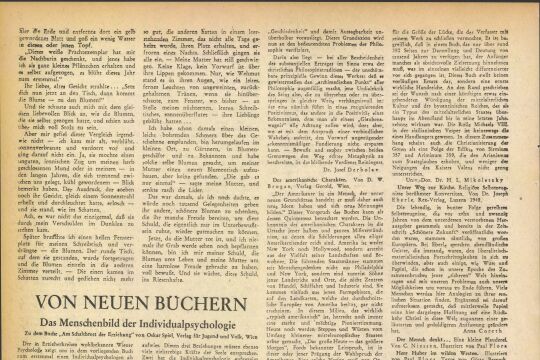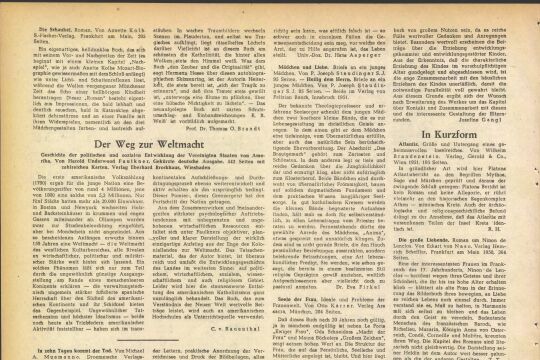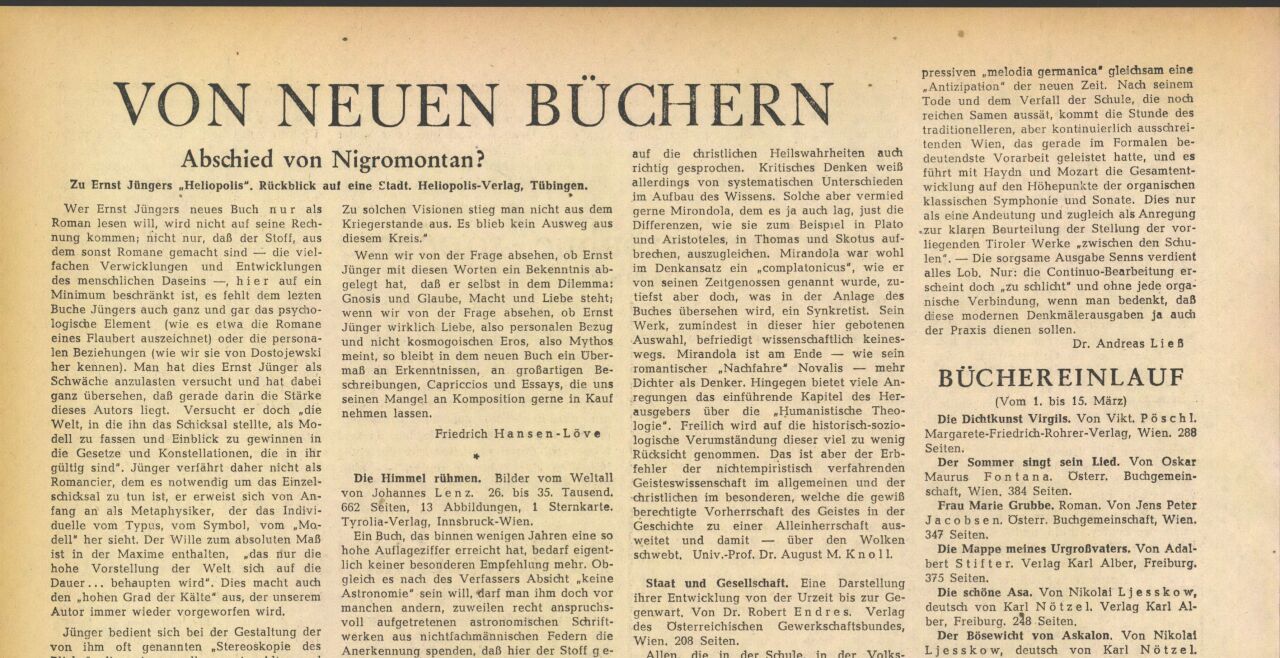
Wer Ernst Jüngsrs neues Buch nur als Roman lesen will, wird nicht auf seine Rechnung kommen; nicht nur, daß der Stoff, aus dem sonst Romane gemacht sind — die vielfachen Verwicklungen und Entwicklungen des menschlichen Daseins —, hier auf ein Minimum beschränkt ist, es fehlt dem lezten Buche Jüngers auch ganz und gar das psychologische Element (wie es etwa die Romane eines Flaubert auszeichnet) oder die personalen Beziehungen (wie wir sie von Dostojewski her kennen). Man hat dies Ernst Jünger als Schwäche anzulasten versucht und hat dabei ganz übersehen, daß gerade darin die Stärke dieses Autors liegt. Versucht er doch „die Welt, in die ihn das Sdiicksal stellte, als Modell zu fassen und Einblick zu gewinnen in die Gesetze und Konstellationen, die in ihr gültig sind“. Jünger verfährt daher nicht als Romancier, dem es notwendig um das Einzelschicksal zu tun ist, er erweist sich von Anfang an als Metaphysiker, der das Individuelle vom Typus, vom Symbol, vom „Modell“ her sieht. Der Wille zum absoluten Maß ist in der Maxime enthalten, „das nur die hohe Vorstellung der Welt sich auf die Dauer... behaupten wird“. Dies macht auch den „hohen Grad der Kälte“ aus, der unserem Autor immer wieder vorgeworfen wird.
Jünger bedient sich bei der Gestaltung der von ihm oft genannten „Stereoskopie des Blicks“, die, wie er selber sagt, „Altes und Neues überhöhend vereinigt. Rationale und metaphysische Elemente werden in eine neue Legierung überführt“. Das Neue aber, das in dem Buche als Utopie zur Sprache kommt, ist die Situation des Menschen am Ende aller Utopien: in der Perfektion der Technik. Jünger zeigt uns, wie die Technik, sich gleichsam selbst überschlagend, dem Fortschritt ein Ende gesetzt hat. Die Technik war aus dem anfänglich rationalen und titanischen Stadium in ein magisches übergegangen. „Der Mensch war damit völlig berechenbar geworden ... wenngleich nur auf der Ebene, auf der er organisierbar war.“ Die Erde war nach einem Zeitalter von Weltbürgerkriegen in einer einzigen Organisation zum Welteinheitsstaat zusammengewachsen. Aber schon drohen neue Auseinandersetzungen. „Die neue Einheit mit ihrer hohen Freiheit, den leichten Bauten und dem Komfort der großen Massen“ wird durch eine neue Spaltung aufgesprengt. Ein neues Interregnum, ein neues Zeitalter des Nihilismus bricht nach dem „Gesetz der Wiederholungen“ herauf. In einem der Diadochen-staaten, in Heliopolis, stehen zwei Parteien wider einander. Jede Partei will die Einheit wiederherstellen. Die eine, die Partei des Landvogts, „will außerhalb der Geschichte ein Kollektiv zum Staat erheben“; „sie richtet das Leben nach unten aus“; die andere, die Partei des Prokonsuls, strebt eine historische Ordnung und die Perfektion des Menschen an.
In dieser Auseinandersetzung zwischen den Mächten der alten Ordnung und der Anarchie gerät ein junger Adeliger aus dem konservativen „Burgenland“ in schwere Gewissenskonflikte. In der Gestalt des Haupthelden, des Kommandanten Lucius de Geer, hat Ernst Jünger ein'genaues Spiegelbild seiner selbst geschaffen, von dem das „Exemplarische“ seiner Existenz, die Stadien seiner Entwicklungen abzulesen sind. Nur daß Ernst Jünger auch seiner Person gegenüber jene „unbeteiligte Betrachtung“ bewahrt, so daß man in der Gestalt des Lucius keineswegs eine „Apologia pro vita sua“ sehen darf.
Der erste Konflikt Lucius' entsteht bei jenem Schürzungspunkt der Lebensschleife, wo die greifbare Macht in metaphysische Macht übergeführt werden soll. Es bedeutet dies den übertritt von den Mauretaniern, den reinen „Technikern der Macht“, zu den Lehren Nigromontans, des „Fürsten der Magier“. Der zweite Konflikt ergibt sich aber in dem Augenblick, wo Lucius in extremer Situation, „auf verlorenem Posten“ gleichsam, erkennen muß, daß Gnosis und Magie, daß „reine Humanität nicht mehr genügt“. Die Bekanntschaft des Kriegers Lucius mit dem christlichen Mönch Pater Fölix ist wie der Einbruch einer neuen Welt. Dem Mönch gegenüber ist die Starre, ist die kriegerische Tapferkeit nicht länger aufrechtzuerhalten. An die Stelle des rein Figuralen, des Typischen, tritt das Personale mit seinen Forderungen. „Das war ein Einbruch, der wie eine große Liebesentdeckung zugleich schmerzlich und fruchtbar in höchstem Maße war ... Mit Beben fühlte er (Lucius), daß er gebrochen wurde und daß ihn die Macht verließ, die 'hn umgürtete. Noch war das Treffen nicht entschieden, ja kaum begonnen... Es blieb die Frage, ob neue Erhebung möglich war. Zuweilen glaubte Lucius zu ahnen, daß Pater Fölix zu den sehr fernen, erhabenen Gestalten, die sich der Welt und ihren Wirren entzogen hatten, in Verbindung stand. Doch war es wohl vermessen, auf Hilfe dieser Art zu rechen; das war ein Vorrecht der Heiligen.
Zu solchen Visionen stieg man nicht aus dem Kriegerstande aus. Es blieb kein Ausweg aus diesem Kreis.“
Wenn wir von der Frage absehen, ob Ernst Jünger mit diesen Worten ein Bekenntnis abgelegt hat, daß er selbst in dem Dilemma: Gnosis und Glaube, Macht und Liebe steht; wenn wir von der Frage absehen, ob Ernst Jünger wirklich Liebe, also personalen Bezug und nicht kosmogoischen Eros, also Mythos meint, so bleibt in dem neuen Buch ein Ubermaß an Erkenntnissen, an großartigen Beschreibungen, Capriccios und Essays, die uns seinen Mangel an Komposition gerne in Kauf nehmen lassen.
Friedrich Hansen-Löve
Die Himmel rühmen. Bilder vom Weltall von Johannes Lenz. 26. bis 35. Tausend. 662 Seiten, 13 Abbildungen, 1 Sternkarte. Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien.
Ein Buch, das binnen wenigen Jahren eine so hohe Auflageziffer erreicht hat, bedarf eigentlich keiner besonderen Empfehlung mehr. Obgleich es nadi des Verfassers Absicht „keine Astronomie“ sein will, darf man ihm doch vor manchen andern, zuweilen recht anspruchsvoll aufgetretenen astronomischen Schriftwerken aus nichtfachmännischen Federn die Anerkennung spenden, daß hier der Stoff g e-Wissenhaft und ohne Verzeichnungen in wesentlichen Stücken dargestellt worden ist. Vereinzelte Versehen sind von untergeordneter Bedeutung. Auch wo die physikalische Wirklichkeit in lebhaften Bildern ausgemalt wird, hält sich die Phantasie in verantwortlichen Grenzen. Seitenblicke auf Nachbarwissenschaften und Anekdotisches bringt Abwechslung, Pseudowissenschaft und Aberglaube werden klar zurückgewiesen. Vor allem aber wird nirgends die im Titel ausgesprochene Generallinie aus dem Auge gelassen: die Ehre Gottes in der Natur. Die Bildbeigaben sind gut reproduziert. Für Leser ohne besondere Vorkenntnisse (und das wird die übergroße Mehrheit sein) ist die Erklärung zur Sternkarte leider unzulänglich knapp. Der Verlag hat dem Buch eine würdige Ausstattung gegeben. Univ.-Doz. Dr. K. Ferrari d'O c c h i e p p o
Die Würde des Menschen. Von Giovanni Pico della M i r a n d o 1 a. Ubersetzt von H. W. Rüssel. Band V der Schriftenreihe „Lux et humanitas“. Pantheon-Verlag Fribourg-Frankfurt (M.)-Wien. 2. Auflage 1949 126 Seiten.
Rüssel gibt eine Auswahl aus den Schriften des „Novalis der Renaissance“, des frühverstorbenen Fürsten Pico della Miranola [i 1494), der die auch heute wieder so aktuelle Frage von der „Würde des Menschen“ geistreich herausarbeitete. Bezeichnend für Mirandolas Schaffen ist sein bekanntes Wort über das Verhältnis von Philosophie, Theologie und Religion: „Die Philosophie sucht die Wahrheit, d'fl Theologie findet sie, die Religion besitzt sie!“ Das ist gewiß schön und in bezug auf die christlichen Heilswahrheiten auch richtig gesprochen. Kritisches Denken weiß allerdings von systematischen Unterschieden im Aufbau des Wissens. Solche aber vermied gerne Mirondola, dem es ja auch lag, just die Differenzen, wie sie zum Beispiel in Plato und Aristoteles, in Thomas und Skotus aufbrechen, auszugleichen. Mirandola war wohl im Denkansatz ein „complatonicus“, wie er von seinen Zeitgenossen genannt wurde, zutiefst aber doch, was in der Anlage des Buches übersehen wird, ein Synkretist. Sein Werk, zumindest in dieser hier gebotenen Auswahl, befriedigt wissenschaftlich keineswegs. Mirandola ist am Ende — wie sein romantischer „Nachfahre“ Novalis — mehr Dichter als Denker. Hingegen bietet viele Anregungen das einführende Kapitel des Herausgebers über die „Humanistische Theologie“. Freilich wird auf die historisch-soziologische Verumständung dieser viel zu wenig Rücksicht genommen. Das ist aber der Erbfehler der nichtempiristisch verfahrenden Geisteswissenschaft im allgemeinen und der christlichen im besonderen, welche die gewiß berechtigte Vorherrschaft des Geistes in der Geschichte zu einer Alleinherrschaft ausweitet und damit — über den Wolken schwebt. Univ.-Prof. Dr. August M. Knoll.
Staat und Gesellschaft. Eine Darstellung ihrer Entwicklung von der Urzeit bis zur Gegenwart. Von Dr. Robert E n d r e s. Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wien. 208 Seiten.
Allen, die in der Schule, in der Volksbildung und in der Gewerkschaftsbewegung als Lehrer und Vortragende wirken, und allen historisch Interessierten will der bekannte Wiener Historiker einen Überblick über Wesen und Entwicklung von Staat und Gesellschaft geben, in deren Werdegang er „einen dialektischen Prozeß im Sinne des historischen Materialismus“ (S. 7) erblickt. Von der klassenlosen Urgesellschaft ausgehend, führt er den Leser — stark von Karl Marx beeinflußt — über die Klassengesellschaft und den Klassenstaat im historischen Zeitalter zur Volldemokratie, worunter er die Ergänzung der politischen Demokratie durch die Wirtschaftsdemokratie (gesellschaftliches Eigentum an den Produktionsmitteln und Lenkung der Produktion zum allgemeinen Wohl), durch Bildungsdemokratie (gleiche Bildungsmöglichkeit für alle durch Gemeinschaftserziehung in Internaten statt Erziehung im Elternhaus) und durch die Betriebsdemokratie (alle in einem Betrieb Beschäftigten sind gleichberechtigte Kameraden) versteht. Diese Volldemokratie lasse „sich mit naturgesetzlicher Notwendigkeit aus dem bisherigen Ablauf der ... Gesellschaftsentwicklrjng“ (S. 195) erwarten. — In die angeführten Einzelheiten haben sich mehrfach Fehler und Ungenauig-keiten eingeschlichen (zum Beispiel: Staatsverträge erwachsen nicht in Rechtskraft, S. 168; der Oberste Gerichtshof war seit 1873 in Strafsachen zweite und nicht dritte Instanz, S. 159); der gedachte Leserkreis wird einen Index und die Erklärung mancher juridischer und volkswirtschaftlicher Begriffe (zum Beispiel den Unterschied von öffentlichem und privatem Recht, S. 90) vermissen.