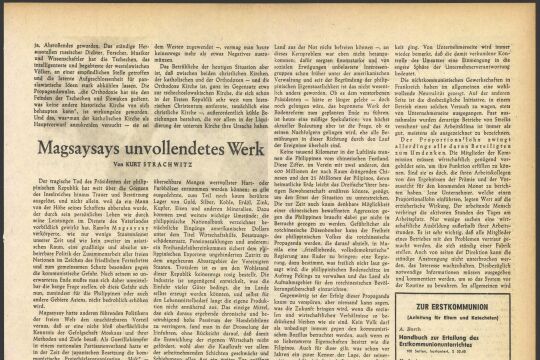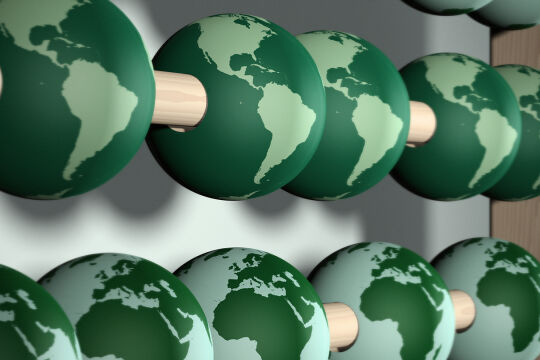Dieser Frage ging eine Diskussionsrunde heuer in Alpbach nach. Die Chefs internationaler Konzerne stellten sich der Kritik von Globalisierungsgegnern. Rückblick auf eine spannende Debatte.
Geld regiert die Welt" - ein Indiz dafür, dass diese alte Volksweisheit nach wie vor gültig ist, sieht Klaus Werner, Autor von "Schwarzbuch Markenfirmen", in den Statistiken des Washingtoner "Institute for Policy Studies". Danach befinden sich unter den 100 größten Wirtschaftsmächten der Welt mehr transnationale Unternehmen als souveräne Staaten. Die Regierungen der Staaten seien demokratisch legitimiert. Daher sei es nahe liegend, dass sie ihre Macht nützten, Konzerne an Spielregeln zu binden, die sich als erfolgreiche Grundlage für die Schaffung von Wohlstand erwiesen haben.
Zwar hielten sich transnationale Unternehmen wie "Adidas" oder "Siemens", die ihre Hauptsitze in Industrieländern haben, an die dort geltenden sozialen und ökologischen Vorschriften. Sie profitierten jedoch davon, dass es diese Regeln in anderen Ländern nicht gibt, also etwa von Kinderarbeit.
"Schuld an solchen Vorkommnissen seien nicht die Konzerne, sondern die jeweiligen Regierungen in den betreffenden Ländern", werde Werner auf seine Kritik stets erwidert. Er stimme dem zwar zu, weise aber darauf hin, dass die korrupten Regierungen vieler Länder ihre Macht erst durch das Geld der Konzerne erhielten. "Keine Instanz stellt sich ,Kraft Jacobs Suchard' oder ,Nestlé' in den Weg, die Kakao von achtjährigen Kindersklaven in Westafrika ernten lassen. Kein Gesetz sanktioniert den ,Bayer'-Konzern, der mit Rohstoffhandel den Krieg mitfinanziert, der im Kongo in drei Jahren drei Millionen Menschenleben gekostet hat. Kein Gericht verurteilt etwa ,Exxon Mobil', wenn er das Weltklima aufs Spiel setzt. Stattdessen setzen die Abnehmerländer der Konzerne auf den guten Willen der Profiteure." Wer glaubt, mit freiwilligen Selbstverpflichtungserklärungen sei die Situation zu ändern, könne gleich alle Gesetze abschaffen.
Die große Macht der Lobbys
In dieselbe Kerbe schlug die Attac'-Vertreterin Susan George. Es sei offensichtlich, dass private Unternehmen die Welt nach ihren Vorstellungen steuern wollten. Zu diesem Zweck hätten sie sich sehr gut organisiert. Als Beispiel für die einflussreichen Lobby-Gruppierungen nannte George den "European Round Table of Industrialists" in Brüssel, der nahe an den Ohren der Minister und EU-Kommissare sitzt.
Obwohl sie enormen Einfluss hätten, leisteten die transnationalen Unternehmen wenig für die Gesellschaft. Die größten Unternehmen der Welt erwirtschafteten zwar über 25 Prozent des Weltsozialprodukts, beschäftigten aber weit weniger als zehn Prozent der Arbeitnehmer, selbst wenn man für jeden direkten Arbeitsplatz drei indirekte hinzurechne. Die Steuerleistung bleibe ebenfalls weit hinter dem Anteil zurück, der eigentlich auf sie fiele. Eine Aussage, die auch von Carl Baudenbacher, Richter bei der EFTA in Luxemburg, bestätigt wurde: "Die Chefs der Multis brüsten sich heute damit, nur noch soviel Steuern zu zahlen, wie sie wollen!"
Hatte es früher einen Zusammenhang zwischen der Kaufkraft der Arbeitnehmer und der Nachfrage gegeben, analysierte Susan George, so sei diese Verbindung unter den Bedingungen der Globalisierung aufgelöst. Die Transnationalen suchten nur noch nach den geringsten Produktionskosten, wie man am Beispiel des "Nike"-Konzerns sehen könne: Er ließ zuerst in den USA produzieren, dann in Korea, zog weiter ins billigere Indonesien und dann nach Vietnam.
Selbstverständlich gäbe es in den transnationalen Unternehmen Manager, die nach ethischen Prinzipien handelten, doch generell würden diese Unternehmen erst dann soziale oder Umweltstandards beachten, wenn es für sie profitabel sei.
Die Institutionen, die legitimiert wären, steuernd einzugreifen, betrachtet George als Handlanger der privaten Unternehmer. So hätte etwa der ehemalige Leiter der Dienstleistungsabteilung der Welthandelsorganisation bekundet, das Abkommen zum internationalen Dienstleistungshandel (GATS) wäre ohne den enormen Druck des US-Finanzsektors, besonders von "American Express" und "Citicorp", nie zustande gekommen.
Wohin die transnationalen Unternehmen die Welt steuerten, sei klar: in eine Welt, in der immer mehr Bereiche den Marktprinzipien unterworfen und somit zur Quelle von Profiten gemacht werden. Dies habe zu riesiger Umweltzerstörung geführt, gefährde den Sozialstaat, schaffe eine gewaltige Ungleichheit zwischen Arm und Reich: "Die 358 Dollar-Milliardäre verfügen über gleich viel Vermögen wie die 2,5 Milliarden ärmsten Menschen der Welt", prangerte Werner diesen Missstand an.
Sich selbst Richtlinien geben
Die Unternehmenschefs wollten dieses düstere Bild der transnationalen Konzerne nicht unwidersprochen lassen. OMV-Chef Wolfgang Ruttensdorfer gestand zu, dass in den meisten Öl-Förderländern die Menschrechte nicht im wünschenswerten Maß beachtet würden, betonte aber, kaum jemand wolle auf deren Öl verzichten. Im Sudan, wo die OMV in Kritik geraten ist, habe man nur eine Minderheitenbeteilung von 25 Prozent an einem Konsortium, und seit Anfang des Jahres sei die Exploration suspendiert worden, um zu warten, bis der Friedensprozess Früchte trage. Auch sei nichts gewonnen, wenn die OMV den Sudan verlasse und stattdessen chinesische Firmen das Geschäft machten. Man nehme aber die Verantwortung ernst und werde sich entsprechende Richtlinien geben. Das sei immer noch besser, als untätig auf eine globale Instanz zu warten, die Regeln aufstelle.
Für völlig illusorisch hält Gerd Häusler, Direktor der Kapitalmarktabteilung beim Internationalen Währungsfonds, Pläne für eine Zentralinstanz, die die Einhaltung globaler Spielregeln überwachen soll. Die USA würden nichts von ihrer Souveränität abgeben. "Sie werden nach den jüngsten Skandalen einiges machen, davon mag manches gut sein, anderes schlecht, aber sie werden machen, was sie für sinnvoll halten und nicht auf die Weltgemeinschaft warten."
Für Ruttensdorfer bilden daher die Selbstverpflichtung der Unternehmen und die Steuerung über den Markt die einzigen Optionen. Unternehmen, so Ruttensdorfer, hätten mehrere Motive für ethisches Verhalten: Immer mehr Investoren (Anbieter von Ethik- oder Umweltfonds), würden nur in solche Unternehmen investieren, die diese Kriterien beachten. Außerdem sei die Zivilgesellschaft heute so gut informiert, dass man sofort großen Erklärungsbedarf hätte, wenn man bestimmte Regeln verletze. Auch würden Mitarbeiter vermehrt nur in Unternehmen arbeiten wollen, die ethische Prinzipien befolgen.
"Der Mensch braucht einen gesetzlichen Rahmen", stimmte "Böhler-Uddeholm"-Chef Claus Raidl im Prinzip der Forderung der Globalisierungskritiker zu. Er kritisierte jedoch, dass Autoren wie Klaus Werner nur die Verfehlungen bestimmter Konzerne skandalisierten, aber übersähen, dass es die "bösen Kapitalisten" gewesen seien, die Verbesserungen der Menschenrechtssituation in vielen Ländern herbeigeführt hätten. "Von sich aus ändert sich der Sudan nicht!"
IBM-Generaldirektor Ernst Nonhoff wies darauf hin, dass es in Europa 200 Jahre gedauert habe, um zu hohen sozialen Standards zu kommen. Man solle daher nicht erwarten, dass sich weltweit alles von heute auf morgen ändern könne.
Mit einer interessanten Analyse ließ der Philosoph Rudolf Burger aufhorchen: Im viktorianischen Zeitalter habe das Moralisieren den Imperialismus begleitet, heute begleite es einen Prozess der Entmoralisierung, der durch den tiefgreifenden und beschleunigten Umbau der Arbeitswelt herbeigeführt werde.
"Während für die Produktionsmitteleigner, die Shareholder, allein das Prinzip der egoistischen Nutzenverfolgung rational ist, würde die Ausdehnung dieser Rationalität auf jene, die von ihnen als Angestellte oder Arbeiter abhängig sind, den arbeitsteiligen Betrieb zerstören. Dessen Organisation zerfiele, wenn die in ihm Beschäftigten konsequent ihre je eigenen Interessen verfolgten, wie es das Marktprinzip verlangt. Heute, insbesondere in den USA, bei breiter Streuung des Aktienvermögens, geht dieser Riss oft mitten durch die Individuen selbst hindurch. Sie müssen daher durch eine moralisierende Gemeinschaftsrhetorik zur Identifikation mit Interessen gebracht werden, die zumindest unmittelbar ihren eigenen entgegenstehen. Der soziale Kitt der Moral wirkt der Anomie entgegen, zu der der Besitzindividualismus von sich aus tendiert."
"Das Lob des Yuppie erfordert als dialektische Ergänzung das Lob der neuen Mütterlichkeit," machte Burger die Widersprüchlichkeit zwischen den bestimmenden Werthaltungen und der kompensierenden Rhetorik deutlich. Die Rede von der Moral diene also dem Aufrechterhalten eines Mindestmaßes der gesamtgesellschaftlichen Integration, "substantielle Sittlichkeit wird durch mediale Sittlichkeit ersetzt."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!