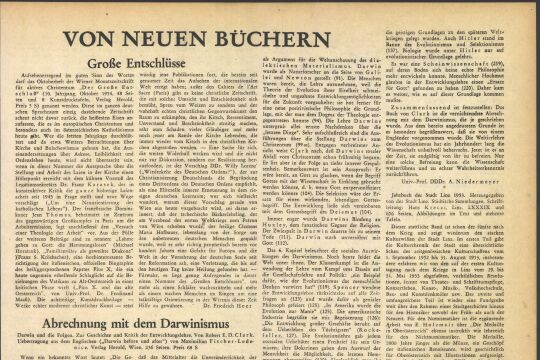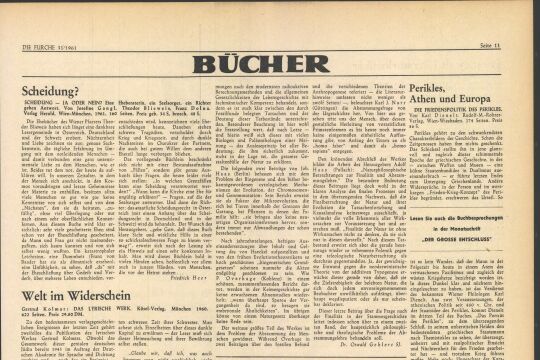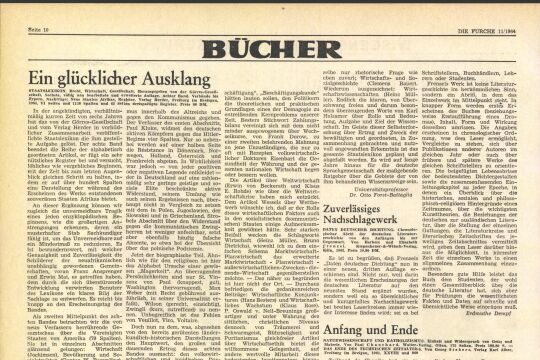Zu Darwins 125. Todestag: Günter Altner über eine denkbare Position Darwins in der Intelligent-Design-Debatte.
Im Verlauf der Konfliktgeschichte zwischen Theologie und Evolutionstheorie sind - teils aus apologetischen, teils aus methodischen Gründen - eine ganze Reihe von Vermittlungsversuchen entstanden, die in fünf Positionen zusammengefasst werden können:
1. Entweder - Oder
2. Verschiedene Sichtweisen
3. Das göttliche Kausalgesetz
4. Der Lückenbüßer und Zielsetzer
5. Gott ist ewig in wechselnden Gestalten
In den frühen Phasen der Auseinandersetzung um die Evolutionstheorie Darwins dominierten auf beiden Seiten die Argumente einer wechselseitigen Wahrheitsbestreitung: entweder Schöpfung oder Entwicklung.
Der Schweizer Theologe Karl Barth brachte in diesen Streit Ruhe, vielleicht zuviel Ruhe, indem er davon sprach, dass sich beide Methoden prinzipiell nicht berühren können. Berechnende Naturerschließung und existenzielle Glaubenserfahrung sind in der Tat zwei grundsätzlich verschiedene Erkenntniseinstellungen. Dennoch bleibt die Frage, ob sich die beiden Verfahren im gemeinsamen Gegenstandsfeld nicht irgendwo und irgendwie berühren.
Albert Einstein wiederum hatte bei seiner Suche nach der Weltformel die Vision, dass das umfassende Kausalgesetz (Gott würfelt nicht) eine göttliche Qualität habe.
Gott als Lückenbüßer?
Mit der Lückenbüßer- und Zielsetzertheorie, die in der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie seit Jahrzehnten bemüht werden, bis hin zur aktuellen Intelligent-Design-Theorie, handelt es sich um Formen der theologischen Einrede in naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Man gesteht der Evolutionstheorie einen begrenzten Wahrheitsgehalt zu, fordert dann aber die Anerkennung von Lücken (erstes Leben, Entstehung des Menschen) und die Ausweisbarkeit der Zielorientierungen.
Die fünfte Position verbindet die unterschiedlichen Sichtweisen von Theologie und Naturwissenschaften durch eine dialektische Komponente: Der ewige Geist persistiert im Wechsel der Zeitgestalten (Arthur Peacock).
Im Folgenden soll am Beispiel Darwins und seiner Frau Emma, aber auch an seinen Schülern demonstriert werden, wo der Weg für einen sinnvollen Diskurs zwischen Theologie und Naturwissenschaften verlaufen könnte.
Die meisten wissen nicht, dass Darwin eine theologische Ausbildung hatte und mit physiktheologischen Argumenten gut vertraut war: Gott als der große Uhrmacher. Unter dem Einfluss seiner Beobachtungen musste Darwin diese Position aufgeben.
In Charles Darwin und seiner Frau begegnen die klassischen Pole des Gesprächs zwischen christlichen Glauben und Evolutionstheorie. Emma war eine tief religiöse Frau mit einem in Christus gründenden Glauben. In ihr verkörpert sich die existenzielle Seite des christlichen Glaubens, bei der die Macht des Leben schenkenden Gottes in Christus erfahren wird. Diese existenzielle Grunderfahrung überträgt sich dann auch auf den Gesamtaspekt der Wirklichkeit im Sinne eines allgemeinen Schöpfungsglaubens im Alten und im Neuen Testament. Man muss also zwischen der primären Glaubenserfahrung und der sich daraus ergebenden sekundären Weltorientierung unterscheiden. Die sekundäre Orientierung geschieht im jeweiligen Weltbild der Zeit.
Darwins Glaubenszweifel …
Als Emma merkte, dass ihrem Mann Charles über seine Studien der Glaube zerbrach, war sie tief besorgt um sein Seelenheil. In einem ihrer Briefe beschwor sie ihn, das nicht zu vergessen, was Jesus für die Welt und für ihn persönlich getan habe. Aber da war für Darwin schon die Entscheidung gefallen. Er hatte sich auf dem Wege der wissenschaftlichen Empirie dem Schöpfungsgeheimnis genähert. Es ging ihm um die nachgewiesene Reihenfolge der Ereignisse in Raum und Zeit. Mit Vererbung und Auslese hatte er die beiden großen Faktorenfelder gefunden, die die Geschichte des Lebens bestimmen und gestalten. Und daran orientiert gestaltete er seine Evolutionstheorie aus. Wir müssen auch sagen, dass er auf diesem Wege Gott nicht finden konnte.
… und sein Agnostizismus
Darwin war klug genug, damit die Gottesfrage nicht als erledigt anzusehen. Sehr zugespitzt schreibt er: "Ich darf mir nicht anmaßen, auch nur das geringste Licht auf solche abstrusen Probleme zu werfen: Das Geheimnis des Anfangs aller Dinge ist für uns unlösbar; und ich für meinen Teil muss mich bescheiden, ein Agnostiker zu bleiben." Das war angemessen formuliert. Darwin konnte in der Tat mit seiner wissenschaftlichen Methodik die Gottesfrage nicht entscheiden.
Im Zusammenwirken von Vererbung und Auslese konnte Darwin auf der einen Seite viele regelhafte Prozesse ermitteln, die er als Gesetze der Evolution beschrieb. Auf der anderen Seite war der Evolutionsprozess durch Ereignisse bestimmt, die als zufällig bezeichnet werden mussten. Zufall und Plan, unter dieser Perspektive beschrieb Darwin den offenen und immer wieder variierenden Evolutionsprozess. Im Gegensatz zu den deutschen Evolutionstheoretikern dachte Darwin nicht deterministisch. Das war seine Überlegenheit. Im Grund war Darwin ein Vorläufer der Theorie der offenen Systeme, wie sie dann erst in den 1960er Jahren zur Anerkennung kamen.
Aber so weit war es noch nicht. Darwins Schüler verließen den pragmatisch-offenen Denkansatz ihres Vorbilds und zerrissen das von Darwin so subtil beschriebene Zusammenwirken von Zufall und Plan. Und so betonten sie einerseits, dass alles gesetzlich festgelegt sei (Plan), und andererseits, dass alles vom Zufall regiert wurde. In der deutschen Diskussion tat sich insbesondere der Jenaer Zoologe Ernst Haeckel hervor, der immer wieder vom ewigen und unabänderlichen Kausalgesetz sprach: "Die allgemeine Entwicklungslehre, die Progenesistheorie oder Evolutionstheorie, als umfassende philosophische Weltanschauung nimmt an, dass in der ganzen Natur ein großer einheitlicher, ununterbrochener und ewiger Entwicklungsvorgang stattfindet, und dass alle Naturerscheinungen ohne Ausnahme, von der Bewegung der Himmelskörper und dem Fall des rollenden Steines bis zum Wachsen der Pflanze und dem Bewusstsein des Menschen, nach einem und demselben Kausalgesetz erfolgen, daß alle schließlich auf Mechanik der Atome zurückzuführen sind."
Zufall und Plan
Das war in erstaunlicher Ignoranz an der Sache vorbeigedacht. Darwin hatte mit seinen Kategorien "Zufall und Plan" nicht eine Maschine, sondern einen offenen Prozess in der Zeit gedacht.
Aber es gab auch die andere Seite, die Überbetonung des Zufalls. Ein besonders markantes Beispiel bietet dafür der französische Nobelpreisträger Jacques Monod, der den Menschen als Zigeuner am Rande des Universums beschrieb: "Wir müssen immer vor diesem mächtigen Gefühl auf der Hut sein, dass alles vorbestimmt ist. Das Schicksal zeigt sich in dem Maße, wie es sich vollendet - nicht im voraus … Unsere Losnummer kam beim Glücksspiel heraus."
Charles Darwin hatte Zufall und Plan kunstvoll miteinander verbunden und vor weltanschaulicher Übersteigerung bewahrt, seine Adepten verdarben dieses programmatische Konzept, rissen die Begriffe auseinander und verabsolutierten sie. Unter solchen Voraussetzungen gab es kein weiterführendes Gespräch zwischen Theologie und Evolutionsbiologie.
Die Gesprächssituation änderte sich erst, als die Theorie der offenen Systeme Eingang in die Evolutionsbiologie fand. Damit lag ein wissenschaftliches Weltbild vor, in dessen Kontur auch die am Gespräch interessierten Theologen ihren Standpunkt vertreten konnten, ohne sich in biologische Sachverhalte direkt einzumischen.
Es war der französische Theologe und Paläontologe Teilhard de Chardin, der in den neuen Kategorien zu denken versuchte. Er interpretierte den sich immer wieder öffnenden Evolutionsprozess als "schöpferische Entwicklung", als Ausdruck der Schöpferwirklichkeit. Das von Teilhard de Chardin entfaltete Filigran der göttlichen Wirksamkeit durchzieht wie eine zweite unsichtbare Dimension das empirische Faktengefüge der Evolution. Teilhard überwindet auf diese Weise das alte Entweder-Oder zwischen Schöpfungstheologie und Evolutionstheorie.
Der evolvierende Gott
Interessanterweise wurde das Gespräch in der Folgezeit durch Beiträge aus den Reihen der Naturwissenschaften bereichert. Wir verweisen hier insbesondere auf den Physiker Ernst Jantsch, aber auch auf Friedrich Cramer und Erwin Laszlo. Jantsch vertrat den interessanten Gedanken, dass man auf die Vorstellung eines außerweltlichen Gottes verzichten könne und Gott im Kontext evolutionärer Prozesse denken müsse: "Gott ist also nicht absolut, sondern er evolviert selbst - er ist Evolution. Da wir aber die Selbstorganisations-Dynamik jedes Systems seinen Geist genannt haben, können wir nun sagen, Gott sei zwar nicht der Schöpfer, wohl aber der Geist des Universums."
Hier deutet sich die Diskussionslinie an, wie sie seit den 1960er Jahren bis in unsere Gegenwart reicht. Die sich auf die belegbare Empirie beschränkenden Biologen sprechen von der Selbstorganisation des Evolutionsprozesses im offenen Horizont der Zeit. Das interdisziplinäre Gespräch über Evolution und Schöpfung jedoch dreht sich um die Frage, wie der Schöpfergott im Horizont der Zeit gedacht werden kann.
Den wohl differenziertesten Beitrag zur Sache hat der anglikanische Theologe Arthur Peacock geliefert. Einerseits deutet er den Aspekt der Kreativität immanent unter den Hinweis auf den offenen Charakter biologischer und generell evolutionärer Ereignisse. Andererseits zeichnet er mit kategorialer Subtilität die Ewigkeit Gottes in die Zeitlichkeit evolutionärer Prozesse ein, so dass die Herausforderung durch die Theologie nicht in sachlicher Bestreitung, sondern in kategorialer Erweiterung zum Ausdruck kommt: "Evolution im allgemeinen Sinn tritt, so kann man sagen, auf der kosmologischen, anorganischen, geologischen, biologischen, sozialen und kulturellen Ebene auf … Im Verlauf der letzten Jahre ist immer deutlicher geworden, dass der Zufall, der innerhalb eines gesetzlichen Rahmens wirkt, die Grundlage der der natürlichen Ordnung innewohnenden Kreativität bildet … So gesehen wird die Wirklichkeit Gottes im Wirken Gottes in der Welt - in der Materie offener Prozesse - erfahrbar, erfahrbar für die Augen des Glaubens … Zusammenfassend können wir an folgenden Einsichten festhalten: Gott ist nicht zeitlos; Gott ist zeitlich in dem Sinn, dass das göttliche Leben in seiner Beziehung zu uns eine Folge kennt - Gott ist temporal auf uns bezogen."
Ohne Zweifel ist mit der Position von Peacock ein gewisser Abschluss in der langen Streitgeschichte zwischen Biologie und Theologie gegeben.
Der Autor ist studierter Biologe und Theologe und war Professor für Evangelische Theologie an der Universität Koblenz-Landau.