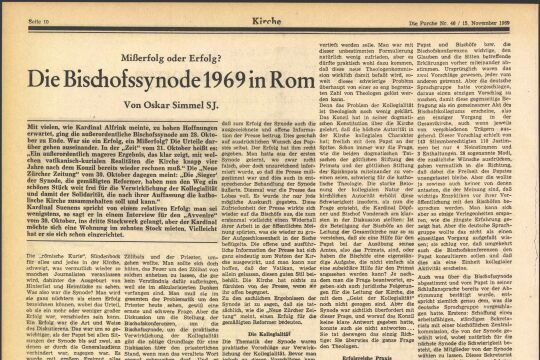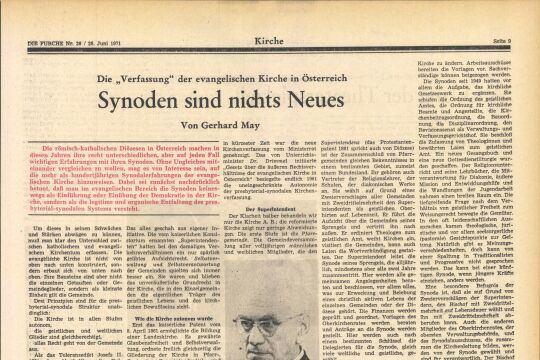Der nachkonziliare Synodenfrühling im Vergleich von Wien und Würzburg: Sichtbares Ergebnis des II. Vatikanums waren Synoden in vielen Diözesen und Ländern. Der Aufbruch in Rom trug auch in den Ortskirchen Früchte.
Die Wiener Diözesansynode (1969-71) ist ein herausragendes Beispiel, wie eine Diözese die Anliegen des Konzils programmatisch aufnimmt und lokal konkretisiert. Die sogenannte Würzburger Synode (Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, 1971-75) wiederum zeigt, zu welchen fruchtbaren Ergebnissen das landesweite Ringen um die Erneuerung der Kirche führen kann.
"Dass die ehrwürdigen Einrichtungen der Synoden und Konzilien mit neuer Kraft aufblühen“, war der ausdrückliche Wunsch des II. Vatikanums. Es ging darum, "den Gegebenheiten der Zeit“ entsprechend "besser und wirksamer für das Wachstum des Glaubens und die Erhaltung der Disziplin in den verschiedenen Kirchen“ zu sorgen.
Ein klarer Wunsch des Konzils
So wurde das erste Jahrzehnt nach dem Konzil zur Epoche lokaler und regionaler Synoden, der konziliare Geist des Aufbruchs und der Reform sollte in den lokalen Kirchen ankommen. Die nachkonziliaren Synoden im deutschsprachigen Raum versuchten erstmals dem Anliegen des Konzils nach Beteiligung aller, "die Kraft der Taufe berechtigt und verpflichtet“ sind, Rechnung zu tragen.
Die Stärke einer Diözesansynode zeigte sich in ihrer Nähe zur konkreten Kirche und den Gläubigen, damit in der raschen Umsetzbarkeit der Beschlüsse, ihre Schwäche, sich pragmatisch in Details zu verlieren. Die Stärke einer Nationalsynode lag in größeren Ressourcen und in der Konzentration auf zentrale Themen. Dabei waren in Wien und Würzburg dieselben Themen der Zeit wie Gemeinde oder Beteiligung der Laien auf der Tagesordnung, aber auch die heute so "heißen Themen“.
Da für eine österreichische Nationalsynode nach dem Konzil der bischöfliche Konsens fehlte, wurden in Wien die Weichen für eine Diözesansynode gestellt. Schon in der dreijährigen Vorbereitungszeit zeigte sich ein theologisches Bildungsdefizit, das keineswegs auf die Laien beschränkt war. Die Begleitung der Synode von einem breit angelegten Kommunikations- und Bildungsprozess ließ das Konzil und die Synode auch im letzten Winkel der Diözese ankommen.
Umsetzung der Konzilsbeschlüsse
Theologische Erwachsenenbildung als Beitrag zur qualifizierten Ausübung der neuen Mitsprachemöglichkeiten. Die Sitzungen fanden unter dem Motto "Dass die Gemeinschaft unseres Glaubens wirksam werde!“ in der Konzilsgedächtniskirche Wien-Lainz statt. Vertreter anderer Kirchen waren als Gäste und Beobachter eingeladen. Die 990 (!) Synodenbeschlüsse unterschiedlicher Verbindlichkeit hatten teilweise weitreichende Auswirkungen: So wurde die Diözese in drei Vikariate geteilt und die neuen "Leitungsgremien und ihre Ordnungen“ auf allen Ebenen der Diözese sollten "nach den Grundsätzen der Kollegialität, Subsidiarität und verantwortlichen Mitarbeit der Laien“ erstellt werden. Heute ist der damals etablierte Pfarrgemeinderat gewissermaßen zurückgestuft auf den vom Bischof eingesetzten "Pastoralrat (Beratungsgremium des Pfarrers) der Pfarrgemeinde zur Koordinierung und Förderung des christlichen Lebens in der Pfarrgemeinde“.
Im Gefolge des Essener Katholikentages 1968 fasste die Bischofskonferenz der Bundesrepublik Deutschland den Beschluss, eine gemeinsame Synode in Würzburg abzuhalten. 18 Dokumente wurden dort beschlossen und sechs Arbeitspapiere veröffentlicht, die heute noch relevant sind.
Wien und Würzburg lassen sich beim Thema "Christen und Juden“ besonders gut vergleichen. Die Bemühungen um die christlich-jüdische Begegnung erhielten durch die Wiener Synode eine starke Bekräftigung. Es wird "das Alte Testament (…) als Anrede und Weisung Gottes“ anerkannt, der "religiöse Eigenwert“ des Alten Testaments betont, dessen "Heilsbotschaft im theologischen Denken und für das religiöse Leben der Gemeinden heranzuziehen und auszuwerten“ ist. Christen müssen "die Existenz auch des heutigen Judentums heilsgeschichtlich verstehen“ und es ist ihnen "nicht erlaubt, die Juden zwar als ursprünglich auserwähltes, dann aber endgültig verworfenes Gottesvolk anzusehen.“
Absage an Antijudaismus
Mit Bezug auf Paulus (Röm 11) hält die Wiener Synode mit "sicherem Glauben (…) fest, dass der Neue Bund in Christus die Verheißungen des Alten Bundes nicht außer Kraft gesetzt hat“. Sie appelliert an alle Christen, sich "von antijüdischen Affekten frei(zu)halten und etwaigen antisemitischen Diskriminierungen seitens anderer entgegen(zu)treten“. Es widerspricht der Lehre der Kirche Christi, "die den Juden durch Jahrhunderte (…) zugefügten Leiden und Demütigungen als Folge einer Verstoßung durch Gott zu deuten.“ Die Katholiken sollten alles tun, "um die zwischen ihnen und den Juden bestehende und durch traditionelle Missverständnisse genährte Entfremdung zu überwinden.“ Ein Tabu blieb aber 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die jüngste Vergangenheit und das in der damals größten jüdischen Stadt des "Deutschen Reiches“.
Die Würzburger Synode hingegen nahm praktische Vorschläge zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Juden und Christen gar nicht in ihre Beschlüsse auf, weil man sie "als unangemessen, als hilflos und schal angesichts des erinnerten Grauens“ empfand. Dafür wird im wichtigsten Synodentext "Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit“ beklagt, dass "wir (…) eine kirchliche Gemeinschaft (waren), die zu sehr mit dem Rücken zum Schicksal dieses verfolgten jüdischen Volkes weiterlebte (…) und die zu den an Juden und Judentum verübten Verbrechen geschwiegen hat“. Zur "praktische(n) Redlichkeit unseres Erneuerungswillens“ gehört das "Eingeständnis dieser Schuld“ und die "Bereitschaft, aus dieser Schuldgeschichte unseres Landes und auch unserer Kirche schmerzlich zu lernen“, indem sie besondere Verpflichtungen "für ein neues Verhältnis zu Glaubensgeschichte des jüdischen Volkes“ übernimmt. Auch hier wird wie in Wien auf "den Heilszusammenhang zwischen dem altbundlichen und dem neubundlichen Gottesvolk“ verwiesen, doch dessen Verharmlosung oder Verleugnung gilt als Teil davon, dass "wir in unserem Land zu Schuldnern des jüdischen Volkes geworden“ sind. "Vom ‚Gott der Hoffnung‘ angesichts eines hoffnungslosen Grauens wie dem von Ausschwitz“ glaubwürdig reden zu können, hängt "vor allem daran, dass es Ungezählte gab, Juden und Christen, die diesen Gott sogar in (…) und nach dem Erlebnis einer solchen Hölle immer wieder genannt und angerufen haben.“
Ein gemeinsames Ringen
Kommunikationsstörungen zwischen verschiedenen Gruppierungen oder zwischen "oben“ und "unten“ sind keine Besonderheit heute. Den Synodenfrühling zeichnet aus, dass Synoden erfolgreiche Formen der Beteiligung bieten und etwa durch die strukturierte Form der Auseinandersetzung die Gesprächsfähigkeit fördern. Die Synoden boten Raum für die spirituelle Erfahrung des gemeinsamen, oft konfliktreichen Ringens. "Wir haben gelernt, miteinander zu streiten, ohne uns zu zerstreiten. Wir haben den Standpunkt des anderen geachtet, obwohl wir Gegner seiner Meinung waren“ resümiert der Kardinal Julius Döpfner am Ende der Würzburger Synode, die für ihn eine "gemeinsame Sprachschule des Glaubens“ war.
Synoden sind als Kirchenversammlungen und besondere Art der Kirchenleitung ein Teil der kirchlichen Tradition und durch wenig strukturierte, große Prozesse mit ungeklärter Teilnahmeberechtigung nicht ersetzbar, besonders wenn es um Wiedererlangung von Gesprächsfähigkeit und Formen wirksamer Partizipation geht.
Nachkonziliarer Synodenfrühling
Vortrag von Univ.-Prof. Martin Jäggle
Mi 9. 1., 18 Uhr 30, Theologische Kurse, 1010 Wien, Stephansplatz 3 www.theologischekurse.at
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!