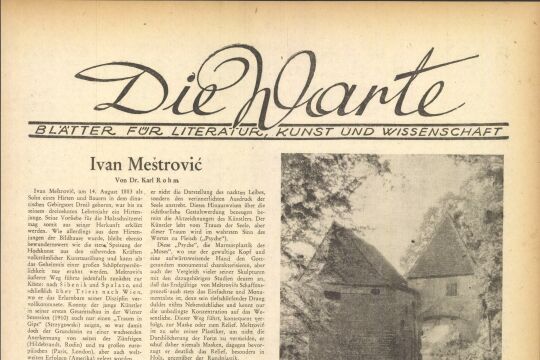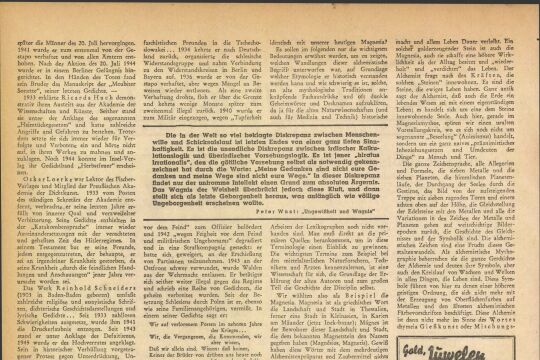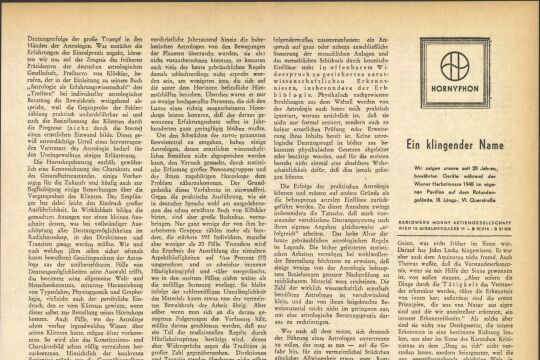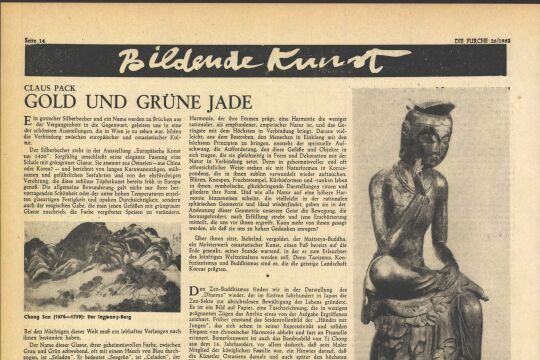Das Wort Element kann den einfachen, nicht weiter teilbaren Teil eines Ganzen bezeichnen. So bezeichnet man die jeweils als kleinste angenommenen Materieteilchen als Elemente, aber auch die Buchstaben oder Laute der Sprache und also auch der Dichtung. (Das griechische Wort stoicheion bedeutet bekanntlich sowohl Buchstabe als auch Element und Atom.)
Eine andere Weise, das Wort zu gebrauchen, geht auf die Vorsokratiker zurück. Für sie sind Elemente schöpferische Prinzipien, das, was alle Dinge hervorbringt. Die Philosophiegeschichte berichtet, dass Thales von Milet das Wasser zu einem solchen Prinzip erklärt hat, Anaximenes die Luft und Heraklit das Feuer. Empedokles schliesslich soll die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft als Urprinzipien angenommen haben und zudem zwei äußerst unbestimmte Stoffe, nämlich Philia (die Liebe) und Neikos (den Streit), die in den Elementen wirken sollen.
Das ungreifbare Wasser
Das Wasser, das Thales und Empedokles meinen, ist aber nicht das Wasser, nach dem wir mit Händen greifen können, ebenso wenig ist es H2O, es ist auch nicht Materie, die aus bestimmten Atomen zusammengesetzt ist.
In dieser Ungreifbarkeit und in seinem Anspruch, den Grund oder die Gründe aller Erscheinungen zu erklären, gleicht es, wie die anderen drei Elemente, metaphysischen Kategorien, von denen es sich doch auch wesentlich unterscheidet: Während etwa Raum, Zeit, Kausalität und Subs-tanz abstrakt und unanschaulich sind, lässt sich das Prinzip Wasser auch mit bestimmten sinnlich wahrnehmbaren Dingen identifizieren: Mit dem Meer und seinen Wellen zum Beispiel, mit Flüssen und Strömen, mit Regen und Schnee, aber auch mit den Säften von Früchten oder des menschlichen Körpers. Es ist diese starke und wählerische Identifikation, die nahelegt, dass sich die elementaren Prinzipien in bestimmten Erscheinungen in besonderem Maß verkörpern; in der Erhabenheit des anbrandenden Meeres zum Beispiel reiner und klarer als in einer schmutzigen Pfütze.
Poseidon und Leviathan
Anschaulichkeit und Verkörperung in den Dingen unterscheiden die Elemente von metaphysischen Kategorien, doch haben sie beides mit Mythologischem gemeinsam: Meeresgötter wie Poseidon, ein Ungeheuer wie der alttestamentarische Leviathan, Nixen und Nereiden scheinen etwa besonders urkräftige Verkörperungen des Prinzips Wasser und werden deshalb auch oft als schöpferisch und zerstörerisch begriffen.
Weil sich ein Prinzip, mag es sich auch in wahrnehmbaren Erscheinungen verkörpern, dennoch mit diesen nicht identisch ist, und sich also nicht auf Räumliches und Zeitliches reduzieren lässt, kann es sich in allen Arten von Gegenständen verkörpern: Die vier Elemente verkörpern sich daher nicht nur in Materiellem, sondern etwa auch in inneren mentalen Zuständen - die Lehre von den vier Temperamenten bezeugt dies - aber auch in jeder Rede; in Dingen also, deren (ausschließliche) Materialität und deshalb naturwissenschaftliche Beschreibbarkeit ebenso wenig feststeht wie ihre Raumzeitlichkeit. Das Prinzip Wasser etwa kann nicht nur in Meeren, Strömen oder Säften wirksam sein, sondern auch in überströmenden Gefühlen, in fließendem Sprechen oder in zerrinnenden Schriftzeichen, in einer verschwommenen Wahrnehmung ebenso wie in dem Wort Wasserzeichen.
Zudem soll Wasser in allem und jedem und also nicht nur in Flüssigem enthalten sein, denn nach Empedokles sind alle Dinge Mischungsverhältnisse der vier Elemente. Selbst das reine Feuer einer Flamme, die dünne Luft über höchsten Gipfeln oder der trockenste Wüstensand enthielten dann (wenn auch geringe) Anteile von Wasser. Irgendwie, in irgendeinem Sinn fließt eben alles, wie gerade der Vorsokratiker einst festgestellt hat, der das Feuer zu dem einen Urprinzip erklärt hat.
Elemente als poetische Möglichkeit
Dass die vier Elemente anschaulich sind und bestimmte Eigenschaften sowohl mit metaphysischen Kategorien wie auch mit Mythologemen teilen, erklärt vielleicht, warum die Poesie, auch wenn sie heute explizite Mythologeme zumeist scheut, von der Lehre der vier Elemente angezogen wurde, ja, immer noch angezogen wird: Als böten die Elemente die Möglichkeit, das Mythologische und das Metaphysische wie auch das Anschauliche und das Theoretische als Momente einer sie umfassenden poetischen Erkenntnis hervorzurufen. Es wäre eine Art von Erkenntnis, für die Verkörperung charakteristisch ist. Denn nicht nur die Elemente werden in allen möglichen Dingen verkörpert, auch das poetische, ja das ästhetische Zeichen überhaupt sucht zu Verkörperndes. Wie bestimmten Mythen zufolge in einem Fluss ein Gott oder in einem Menschen oder in einem Tier ein Engel oder ein Dämon, kann sich auch in Kunstwerken etwas verkörpern; vielleicht, wenn überhaupt, nur ausnahmsweise Götter, Engel oder Dämonen, aber sehr häufig Prinzipien und Kategorien; sie sind dann in dem Kunstwerk wirksam und zugleich das, worauf das Kunstwerk hinweist. Mit dem Wasser etwa, das gebunden an bestimmte Stoffe, Umstände oder Kontexte in unterschiedlichen Graden von Wirksamkeit erscheint, könnte daher das Prinzip oder die Kategorie dieses Erscheinens erfahrbar und bezeichnet werden und damit eine allgemeine und fundamentale Ordnung wenigstens zu erahnen sein.
Wie aber, wenn die vier Elemente als schöpferische Prinzipien überhaupt nicht einleuchten? Wenn man die empedokleische Intuition nicht teilt?
Wird ihr Wirken in wissenschaftlichen oder philosophischen Thesen verkündet, in Thesen also, die theoretischen Anspruch haben, dann fällt es schwer, sie nicht als vorrational oder vorwissenschaftlich abzulehnen (und so ist die Geschichte der Philosophie und der Wissenschaften im großen und ganzen auch verfahren). Kann aber aber vielleicht die Poesie ihre immer noch andauernde Wirksamkeit bezeugen? Kann sie die Quelle sein, die sich von Grund auf selbst angibt und eben damit auch ansonsten nicht erfahrbare Prinzipen, aus denen sie schöpft?
Wasser, Sonett
das meer, es wird durchkreuzt im eignen namen laut,
da im glas wasser stürmt, als öffnung vor zu schweben,
wie all die schäume sich mit lippen selbst beleben,
dass wasser unsre farben spielt, zusammenbraut
sein bild als aug: aus blauem sich das durch uns staut,
blick bis zum rand zu füllen, da auf die see wir heben,
von grund auf schwall ausschöpfend, wir auch fliessend geben
dem meer, den wellen wort, das unsern lauf rein schaut:
gestrichen wird, auch an- wie aus-, das ganze segel
an jedem punkt, dass tränen, tropfen sich durchdringen,
aus einem guss, in einem boot auf uns zu bringen,
ja, lösend ruder, blatt mit dieser zunge: pegel
auf- es und angibt mit der quelle, die in dingen
und zwischen zügen, zeilen fasst: stillt dies die regel?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!